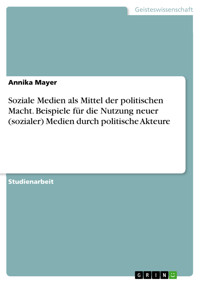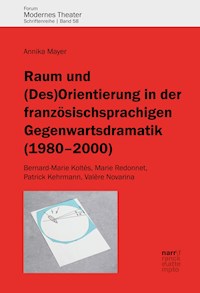
Raum und (Des)Orientierung in der französischsprachigen Gegenwartsdramatik (1980-2000) E-Book
Annika Mayer
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Narr Francke Attempto Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Forum Modernes Theater
- Sprache: Deutsch
Zeitgenössische französischsprachige Theatertexte gelten als vielfältig und unzugänglich. Unter der Perspektive des Raumes geht die Autorin der Frage nach der menschlichen Handlungsfähigkeit in der Postmoderne nach und untersucht Raum-Figuren-Verhältnisse in Kontinuität und Differenz zu den Experimenten der Avantgarden. Die Studie zeigt, wie Räume statt über szenische Anweisungen perzeptiv-sprachlich via Figurenrede evoziert werden. Es werden offene, weite und strukturlose Raumentwürfe ausgemacht, die mit Desorientierungssituationen einhergehen und dennoch Orientierungs- und Handlungspotenzial aufzeigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 676
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Annika Mayer
Raum und (Des)Orientierung in der französischsprachigen Gegenwartsdramatik (1980–2000)
Bernard-Marie Koltès, Marie Redonnet, Patrick Kehrmann, Valère Novarina
Umschlagabbildung: © Romina Abate, Ohne Titel (Kurs), 2018.
Die Arbeit wurde als Dissertationsschrift im Fachbereich 02 Geistes- und Kulturwissenschaften der Universität Kassel eingereicht und am 17.10.2019 verteidigt.
https://doi.org/10.24053/9783823395683
© 2022 • Narr Francke Attempto Verlag GmbH + Co. KGDischingerweg 5 • D-72070 Tübingen
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetztes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Alle Informationen in diesem Buch wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Fehler können dennoch nicht völlig ausgeschlossen werden. Weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen übernehmen deshalb eine Gewährleistung für die Korrektheit des Inhaltes und haften nicht für fehlerhafte Angaben und deren Folgen. Diese Publikation enthält gegebenenfalls Links zu externen Inhalten Dritter, auf die weder Verlag noch Autor:innen oder Herausgeber:innen Einfluss haben. Für die Inhalte der verlinkten Seiten sind stets die jeweiligen Anbieter oder Betreibenden der Seiten verantwortlich.
Internet: www.narr.deeMail: [email protected]
ISSN 0935-0012
ISBN 978-3-8233-8568-4 (Print)
ISBN 978-3-8233-0383-1 (ePub)
Inhalt
Ich widme diese Arbeit Adelheit und Marianne, die diese Welt während meiner Promotion verlassen haben.
Ich widme diese Arbeit Yuna-Lou und Bruna, die diese Welt mit Spiel, Intelligenz und Sensibilität bereichern.
Ich widme diese Arbeit Anita, die sich, ihren Kindern und Enkelkindern diese Welt mit Neugier und Lust an Sprachen, Kulturen und Begegnungen immer wieder neu eröffnet.
Danksagung:
An dieser Stelle möchte ich den Menschen danken, die mich auf meinem Weg zur Dissertation begleitet haben.
Mein erster Dank gilt Prof. Dr. Franziska Sick für das Vertrauen in meine Textauswahl, meinen Ansatz und die kritische Begleitung, sowie die großzügige Unterstützung dieser Publikation.
Mein zweiter Dank geht an meinen Zweitgutachter, Prof. Dr. Jan Henrick Witthaus für die unvoreingenommene, respektvolle Lektüre sowie an die Kasseler Mitstreiter_innen und Weggefährt_innen aus Mittelbau und Administration der Romanistik: Antonio, Gabriele, Josselyne, Katherina, Katja, Marta, Patrick und Rita sowie an meine finale Bürogenossin Andrea.
Meinen Eltern und Geschwistern danke ich für den vielseitigen Rückhalt, den langen Atem und das Respektieren meiner Entscheidungen.
Ich danke Aki, Astrid, Janna, Jean Loïc, Laura, Leonie, Romina und Susanne für die künstlerische und persönliche Verbundenheit über räumliche Entfernungen und Lebensphasen hinweg.
Bugi, Christian, Liset, Marianna, Marina, Martin, Nadine, Natalie, Ole und Yoshi danke ich für die schönen Gespräche, humorvollen Pausen, die kleinen und großen Ausflüge.
Abschließend geht mein Dank an Björn, Carmen, Corinna, Eduardo, Thomas und Valeria fürs Erheitern und Mitfiebern auf den letzten Metern.
Mannheim, im April 2022 Annika Mayer
1Einleitung
Nach Samuel Becketts radikalen Experimenten der 1950er bis 1970er Jahre sowie dem visuellen, medialen und transartialen postdramatischen Paradigma, welches mit einem regiezentrierten Theater und einer Herabsetzung des Textes zugunsten nichtsprachlicher Aufführungskomponenten einherging, setzte sich in den 1980er und 1990er Jahren eine neue Aufmerksamkeit auf den Sprechtext durch. In dem Zuge lässt sich auch eine erneute Auseinandersetzung mit dem Drama und seinen Konstituenten verzeichnen. In dieser Phase der Positionsbestimmung zeitgenössischer Dramatik entstehen Theatertexte,1 die einerseits die experimentellen Formen der Theateravantgarden weiterführen, andererseits aus der Reibung mit einer postdramatischen und regiedominierten Aufführungspraxis hervorgehen. Entdramatisierende und redramatisierenderedramatisierend Verfahren schließen sich nicht länger aus, sondern werden kombiniert. Dabei wird auch das Verhältnis zwischen Text und Bühne neu verhandelt. Die zeitgenössischen Theaterautor_innen fahren eine Mehrfachstrategie: sie bekräftigen das Drama als literarische Gattung und schreiben ihren Theatertexten ebenso nonverbale und intermediale Aufführungselemente und -dispositive ein. Zudem nehmen sie Einfluss auf die Aufführungen ihrer Texte – sei es durch Kooperationen mit Regiseur_innen (z.B. Bernard-Marie Koltès und Patrice Chereau) oder Eigeninszenierungen (z.B. Pierre Guyotat, Valère Novarina). Damit wird auf den Doppelstatus des Theatertextes als eigenständigen literarischen Lesetext sowie als einer zur Aufführung bestimmten Partitur insistiert.2
Die Theatertexte der in den 1940er und 1950er Jahren geborenen Theaterautor_innen sind schwer zu gruppieren und ästhetisch einzuordnen. Es liegt eine Heterogenität von Dramaturgien und Schreibweisen vor, die während der Zeit ihrer Erscheinung und noch bis in die Forschung der 2000er Jahre als Defizit und als Problemlage diskutiert wird. Die Theatertexte der 1980er und 1990er Jahre werden selten anders als negativ bestimmt: über den Bruch mit der (konventionellen) Handlung, der Figur und dem Dialog. Dabei lässt sich die Vielfalt der Gegenwartsdramatik als eine ernstzunehmende poetologische Recherche nach Umgangsweisen mit dramatischen Versatzstücken und Möglichkeiten gattungsüberschreitender und medienreflexiver Textverfahren hervorheben. Die weiträumig angelegte Anthologie französischsprachiger Theaterautor_innen von Michel AzamaAzama, Michel leistet bereits eine Zusammenschau und positive Bestimmung anhand chronologisch gegliederter, kleinteiliger Tendenzen, die in Aufführungs- und Publikationskontexte eingebettet sind.3 An zwei Kernaussagen Azamas lässt sich ansetzen. Erstens wird das Handlungstheater durch ein RedetheaterRedetheater abgelöst: „Nous sommes passés d’un théâtre de l’action, du ‚faire‘ à un théâtre du ‚dire’“.4 Zweitens führt er für die Spezifität des generisch geöffneten zeitgenössischen Theatertextes folgende Grundzüge an: das „devenir parole“ als das ‚Atmen‘ des Textes, dem – ähnlich wie der Lyrik – durch Rhythmus, KlangKlang, Ansprache, Sprachbilder, Brüche und Beschleunigung ein Potenzial zum Vortragen und Vorführen eingeschrieben ist und das „devenir scénique“, worunter er die Dramaturgie als AnordnungAnordnung fragmentierter, multiplizierter Redeeinheiten und -varianten versteht.5 Mit diesem Verständnis von Dramaturgie grenzt Azama die zeitgenössischen Theatertexte von Becketts geschriebener ‚Regie‘ ab.6 In der Tat fällt im Vergleich zu avantgardistischen Theatertexten eine deutliche Differenz ins Auge. Die Gegenwartstexte enthalten, wenn überhaupt, nur minimale Bühnenanweisungen und dafür z.T. klassische Tiraden übertreffende Repliken und Aufführungsformate sprengende Sprechtextlängen. Während im Avantgardetheater das gestische Bühnenspiel, das Hantieren mit Requisiten, die Pantomime und alltägliche oder ritualisierte Mikrohandlungen, mimetische Verdopplungen, Spiel im Spiel-Trucagen sowie Medien- und Raumexperimente die konventionelle Handlung ersetzen, verhandelt die Gegenwartsdramatik Handlungen und Nichthandlungen auf der Ebene der Rede. Damit können nicht nur Redeweisen wie das Erzählen, Vortragen, Reflektieren, Rückblicken, Beschreiben als RedehandelnRedehandeln geltend gemacht werden. Auch werden Handlungen rekapituliert und situative oder künftige Handlungsmöglichkeiten eruiert und besprochen. Ebenso wie in den avantgardistischen Theatertexten verschwindet auch in der Gegenwartsdramatik nicht die Handlung, sondern das Handlungsverständnis ändert sich – hier nun zugunsten von Redesituationen. Wird zeitgenössische Dramaturgie als Anordnung von Rede verstanden, liegt es nahe, zu denken, dass durch Rhythmus, Geschwindigkeit und Abfolge von Rede- und Erzählsequenzen die Zeit, die Zeitrichtung und das Zeiterleben in den Vordergrund und räumliche Erfahrungs- und WahrnehmungWahrnehmungsverhältnisse in den Hintergrund rücken. Dem ist jedoch nicht so. Ende des 20. Jahrhunderts setzt sich die Untersuchung und Reflexion des Raumes in den Theatertexten fort. Raum bestimmt das menschliche Sein auch in der Gegenwartsdramatik, ist Voraussetzung für Handeln und damit auch Grundbedingung von Redesituationen.
In den avantgardistischen Theatertexten wird der geschlossene Schauplatz von topologischen Anordnungen abgelöst. Es geht um die Lagebeziehungen von Figuren und Objekten, um Raumgrenzen und Raumstrecken, um das Davor und Dahinter und das Drinnen und Draußen. Die durch Raumelemente und Requisiten geschaffenen Raumstrukturen bedingen und regeln motorische und perzeptive Handlungsfähigkeiten. Raumwege, Raumgrenzen, Raumöffnungen und Schwellen wie Wände, Fenster und Türen werden hervorgehoben und organisieren das Geschehen. So bestimmt in Maurice Maeterlincks Interieur die durch das Fenster in den handlungsarmen Innenraum einer Familie gerichtete Teichoskopie die Dramaturgie des Wartens.7 Via Bühnenanweisung werden szenisch-gestische Umgangsweisen von Figuren mit solchen Raumverhältnissen zu metaphorischen ‚Raumbildern‘. Anstelle einer progressiven Zeit sind es statische oder zyklische Dramaturgien, in denen es zu Erkundungen, Verschiebungen und Dynamisierungen von Räumen kommt. In Samuel Becketts Fin de partie wird der begrenzte szenische Raum erlaufen und vermessen,8 in Jean Genets Les Paravents werden Stellwände umgestellt und vielseitig eingesetzt.9 Anhand des szenischen Raumes erforschen die avantgardistischen Theaterautoren nicht nur die Bedingungen menschlichen Seins jenseits progressiver Handlung und Zeiterfahrung, sondern sie gehen dabei bis an die Grenzen szenischer Darstellungsmittel, entwerfen Architekturen und Apparaturen, setzen auf Sound und Licht – wie insbesondere Antonin ArtaudArtaud, Antonin – und beziehen das Off, die Hinterbühne und den Zuschauerraum mit ein.
Noch deutlicher als in den avantgardistischen Raumstücken zeigt sich in der Gegenwartsdramatik die Konstruiertheit, Pluralität und Relativität des Raumes. Vor dem Hintergrund der Öffnung von Landesgrenzen und Märkten, der Beschleunigung von Kommunikations- und Reisewegen im Zuge der Globalisierung sowie der Ausweitung des mundanen Lebensraumes durch Kosmonautik und virtuelle Realitäten werden Raumgrenzen relativiert und entmaterialisiert. Die vielfältigen, dynamisierten und entgrenzten Räume eröffnen neue Handlungsmöglichkeiten, fordern jedoch ebenso Orientierung, WahrnehmungWahrnehmung, Richtungs- und Handlungsentscheidungen sowie auch Raumtheorien heraus. In den Gegenwartstexten werden offene Räume in metaphorischer, modellhafter und metatheoretischer Weise verhandelt. Im Unterschied zu den szenisch zu materialisierenden, bespielbaren und mit Raumelementen manipulierbaren Räume der Avantgarden überwiegen in der Gegenwartsdramatik, wenn nicht gänzlich auf ein szenisches Raumkonzept verzichtet wird, minimalistische, horizontale, flächige Raumkonzepte der StrukturlosigkeitStrukturlosigkeit und LeereLeere. So beginnt Eugène Durifs Conversation sur la montagne mit den Worten „Ce fut au début de l’hiver qu’il arriva ici. La route avait été coupé par la neige. […] Lacérés déchiré, contours des roches et des ombres que je croyais distinguer dans la neige“.10 Der Raum wird vage, unzuverlässig und bietet keine Situierungsmöglichkeit. Plurale und unzusammenhängende Räume bieten keine Rast, Transit und Instabilitäten herrschen vor wie das ziellose Umherziehen in Philippe Minyanas Où vas tu Jeremie? vorführt.11 Die Räume werden jedoch weniger szenisch-visuell realisiert und gestisch bespielt, sondern insbesondere sprachlich erzeugt, besprochen, zum Thema gemacht. Beispielhaft dafür steht die Radiostimme, die Jean Luc Lagarces Carthage, encore eröffnet:
La Radio. – …et de plus, il fait beau. Ailleurs, l’herbe n’est pas plus verte, le ciel n’est pas plus bleu. Dans les champs de plastique, courent sans fin des enfants ivres de bonheur […] Et sur la fantastique et merveilleuse route de béton, arrive à grands pas la jeunesse pure de demain. Et de plus il fait beau…12
Raumwahrnehmungen und Raumerfahrungen werden beschrieben, erzählt und reflektiert. Dabei gehen entgrenzte und orientierungswidrige Räume mit offenen Situationen und fehlenden übergeleiteten Zielen und Handlungsoptionen einher. Die Suche nach Anhalts- und Bezugspunkten steht in engem Zusammenhang mit postmodernen, die sich durch Pluralismen, Ungewissheiten und KontingenzKontingenz ausweisen. Die großen Ziele, Ereignisse und Ideologien dienen längst nicht mehr als Fluchtlinien für Handlung und Dramaturgie. In der Gegenwartsdramatik werden offene Raumflächen, Raumbewegungen und Handlungsmöglichkeiten auf der Ebene des Sprechtextes verhandelt.
Mit dem Ziel, sowohl aktuell noch gültige als auch autorenspezifische Funktionsweisen und Merkmale der Gegenwartsdramatik aufzuzeigen, werden vier komplexe und vielschichtige Theatertexte eingehend unter die Lupe genommen, in denen insbesondere das Verhältnis von Raum und menschlichem Handeln besprochen und reflektiert wird: Quai Ouest (1985) von Bernard-Marie Koltès, Mobie-Diq (1989) von Marie Redonnet, De quelques choses vues la nuit (1992) von Patrick Kermann und L’Espace furieux (1997) von Valère Novarina. Diese Autor_innen legen eine avantgardebezogene wie auch textbetonte Dramatik vor, operieren mit Monolog, Redefluss, Ausschweifungen, überlangen Texten, Intertexten und unzuverlässigen Formen des Erzählens. Ihren Theatertexten liegen offene Raumkonzepte zu Grunde. Räumliche DesorientierungDesorientierung wird besprochen und auf der Ebene einer je spezifischen RaumanordnungRaumanordnung auch dramaturgisch umgesetzt. Deutlich wird eine teleologieskeptische Geschehenskonfiguration, die den szenischen Raum zugleich zum ErwartungsraumRaumErwartungsraum und MöglichkeitsraumRaumMöglichkeitsraum für sprachliche Handlungsentwürfe werden lässt. Es gilt Art und Weisen der Erschließung orientierungswidriger Räume und des Zurechtfindens in offenen Situationen aus dem Sprechtext herauszuarbeiten. Welche Anhaltspunkte sind vorhanden, welche Orientierungsmittel sind verfügbar? Welche räumlichen oder andersgearteten Orientierungsverfahren greifen (nicht)? Inwieweit lassen sich, ausgehend vom besprochenen Raum-Figuren-Verhältnis und der damit einhergehenden Handlungsfähigkeit, auch Aussagen über Figurenkonzeptionen treffen?
Methodisch basiert die Untersuchung auf der Vorannahme, dass weder ein einheitliches Orientierungssystem noch ein statischer Orientierungsbegriff vorherrschen. Entgegen einer statischen, festgelegten Ausrichtung auf ein Ziel kann ein unter postmodernen Bedingungen zu fassendes, zeitgenössisches Orientierungsverständnis nur dynamisch und plural geartet sein. Orientierung als leibliche und kulturelle Technik der wahrnehmenden und handelnden Bewältigung einer verfahrenen oder offenen Lage ist situativ, prozessual und dynamisch zu verstehen und unterliegt jeweils Aushandlungen, Relativierungen, Perspektivierungen. Eine übergeordnete Orientierungstheorie für die Untersuchung der vier Texte wird damit obsolet. Anstatt Raum- und Orientierungstheorien an die Stücke heranzutragen, erscheint es als sinnvoll, die je spezifischen Raum- und OrientierungskonzeptionenOrientierungskonzeption herauszuarbeiten. Damit wird von einem eigenständigen Raum- und Orientierungsdenken der zeitgenössischen Theatertexte ausgegangen, welches jeweils in Bezug zu dramen- und theatertheoretischen wie philosophischen Ansätzen gesetzt und damit geschärft wird.
Zeitgenössische Theatertexte stellen bereits eine Herausforderung dar, was die Angabe von Inhalt und Gehalt anbelangt. Auch die Organisationsstruktur der Texte lässt sich nicht auf den ersten Blick ersehen und muss Stück für Stück herausgearbeitet werden. Novarinas Texte beispielsweise werden in der Forschung als ‚Dramaturgien der NegationNegation‘ bezeichnet.13 Etwaige Hypothesen einer Negation von Inhalt und Struktur, seien sie begrüßend wie seitens CorvinCorvin, Michel oder mit dem Vorwurf der Sinn-LeereLeere versehen und an eine „postmoderne“ oder „postdramatische“ Ästhetik geknüpft,14 geben Anlass zu einer Überprüfung auf Bedeutungsangebote hin. Dazu ist eine eingehende, textnahe Untersuchung nötig. Insbesondere die hier zu untersuchenden Texte zeichnen sich durch eine Dichte von Sprachfiguren, intertextuellen Anspielungen, ineinandergreifenden Ebenen, Verschiebungen, Mehrdeutigkeiten und metatheoretischen Momenten aus und verwehren sich einer makrostrukturellen Untersuchung. Sie erfordern eine ‚mikroskopische‘ Lektüremethode, wie es Jean-Pierre Ryngaert postuliert: „Lire c’est donc aussi, ou surtout, travailler au microscope“.15 Es gilt die Möglichkeit der wiederholten, eingehenden philologischen Studie auszuschöpfen, ein Vorteil, den die verschriftlichten Theatertexte gegenüber ihren Aufführungen bieten:
L’implicite, les réseaux d’images, les niveaux de lecture, les cheminements souterrains de la pensée, les associations d’idées, les chocs poétiques, les inattendus de toute sorte – dans la langue autant que dans la structure – exigent un travail d’attention particulier dans lequel s’élaborent peu à peu les sensations et les significations.16
Dazu liefert die Mikroebene nicht nur Motive und Bedeutungskomplexe, sondern steht in einem je spezifischen Verhältnis zur Ebene der Struktur und AnordnungAnordnung der Rede.
2Tendenzen der Gegenwartsdramatik
Die Heterogenität der zeitgenössischen französischsprachigen Theatertexte der 1980er und 1990er Jahre bedingt eine begriffliche und konzeptuelle Vagheit und Uneinheitlichkeit in der Forschungsliteratur. Drei Paradigmen zur Einordnung lassen sich heranziehen und in Bezug auf die Theatertexte überprüfen und diskutieren: das der „Krise“, das der Postdramatik und das der Rückbesinnung auf den Text. Bereits hier deuten sich ästhetische Ambivalenzen an, die sich in einem Folgeschritt anhand von entdramatisierenden und redramatisierenden Verfahren zur einer Sowohl-als-auch-These zusammenführen lassen.
2.1Forschungsstand ”Krise“ versus Postdramatisches Theater
Die Situation des französischsprachigen Theatertextes zu Beginn der 1980er Jahre wird in der Forschung als „Krise“ gehandelt. Eine solche wird zurückgeführt auf die Dominanz der Regie sowie der creation collective beispielsweise eines Théâtre du Soleil.1 Postuliert Antoine Vitez schon in den 1960er Jahren „Faire théâtre de tout“ und leitet damit eine Ära der Profilierung von Regisseur_innen über Neuinszenierungen von Klassikern sowie nichttheatralischer Textvorlagen ein, spitzt sich die „condition malaisée de l’auteur dramatique“ in den 1980er Jahren zu, was sich auch kulturpolitisch abzeichnet.2 Auch die beschleunigte Konkurrenz durch populäre audiovisuelle Medien (Kino und Fernsehen) wird als äußerer, negativer Einflussfaktor für die Produktion und Rezeption von Theatertexten angeführt.3 Den Argumentationen, die die „Krise“ an den Theatertexten selbst verzeichnen, lässt sich die Beobachtung von Disparatheit und Heterogenität der Schreibweisen als Symptom Nummer eins entnehmen, sowie Diagnosen der Suchbewegung nach neuen Formen und des Mangels an Richtung, Kontur und Kontinuität.4 Etwas optimistischer ist die Beobachtung einer zweischneidigen Freiheit des Gegenwartstheaters zwischen dem Verwerfen alter Grenzen, Gewissheiten und der Gefahr einer ästhetischen Beliebigkeit.5 Michel CorvinCorvin, Michel stellt die These von einem ‚desorientierten Theater‘ auf, die er in der radikale Abschaffung von Handlung (und Figur) manifestiert sieht:
supprimer le personnage c’est supprimer la fictionalité […] supprimer la fable ce n’est pas seulement supprimer le ‚faire‘, mais c’est aussi – si l’on donne à la fable sa valeur pleine d’action et à l’action sa valeur intérieur […] de stratégie discursive – supprimer le sens, l’orientation. On a affaire aujourd’hui à un théâtre désorienté.6
Ein solcher poetologischer Krisenbegriff als mögliches Paradigma zeitgenössischer Dramatik wird jedoch bereits durch Forschungsbeiträge relativiert, die den Beginn der Krise von Figur und Handlung in der ersten Theateravantgarde um das Jahr 1900 ansetzen und in der Folge die Erneuerungspotenziale unterstreichen.7 Ein Rückbezug auf die Avantgarden macht deutlich, dass die moderne Theatergeschichte von Krisendiskussionen bestimmt ist.8 Im Zuge dessen werden gegenwärtige dramenpoetische Umwälzungen als ‚Echo‛ der „Krise“ um 1900 veranschlagt,9 bzw. in vorläufiger Zeitperspektive die „Krise“ als fortwirkend und bereichernd gewertet.10 Ins FeldFeld geführt werden insbesondere zwei Form- und Strukturelemente, die noch bis in die Gegenwartsdramatik wirken: aufgesplitterte Räume und einander gegengerichtete Zeitverläufe.11 Mit dem optimistischen Verständnis von „Krise“ als einem auf Ungewissheit folgender Umwandlungsprozess eröffnet Jean-Pierre Ryngaert eine optimistische Feier des wiedergewonnenen Textes nach einer Ära der regie- und körperzentrierten Theaterarbeit.12
Das seit den 1970er Jahren in Frankreich vorherrschende Theater erweitert Status und Aufgabenfeld des_er Regisseurs_in. Diese_r ‚in-szeniert‘ nicht länger einen vollständigen dramatischen Text, sondern wird selbst zum_r ‚Autor_in‘ einer Aufführung, für die ein Aufführungstext, häufig eine Zusammenstellung aus verschiedenen Textquellen, Materialien und Probenelementen entwickelt wird. Die Aufwertung der Regie geht mit der Emanzipation der Aufführung gegenüber dem Dramentext als alleiniger Spielvorlage einher.13 Das Theater wird dabei zur Kunst, die alle verbalen und insbesondere nichtverbalen Künste vereinigt.14 Alle Konstituenten der Aufführung werden zu autonomen Zeichen, eine festgelegte, organisierte Sinnstruktur wird abgelöst, stattdessen die Syntheseleistung und Bedeutungskonstruktion auf die Seite der Rezipient_innen verlagert.15 Verfahren der Auflösung von Text und Handlung zugunsten der Ausstellung der Einzelkomponenten des Theaters in ihrer Zeichenhaftigkeit lassen sich mit Helga FinterFinter, Helga als postmodernpostmodern oder dekonstruktivistisch bezeichnen.16 Damit klingt an, was Hans-Thies LehmannLehmann, Hans-Thies in seiner groß angelegten Studie zum postdramatischen Theater nach deskriptiver Methode ausarbeitet: Die Aufführung emanzipiert sich vom Text und entledigt sich der Funktion, eine Handlung darzustellen. Die verbalen und nonverbalen Konstituenten werden gleichrangig und wirken autonom. Lehmann konsolidiert den von Andrzej Wirth vorgeprägten Begriff „post-dramatisch“,17 indem er ihn auf eine präsenzbetonte, voraristotelische Theaterpraxis gründet. Sich auf Antonin Artauds Théâtre de la Cruauté beziehend, wertet er gestische, räumliche, visuelle und technische Elemente auf und setzt die Performanz, das Bühnengeschehen im Hier und Jetzt, an die oberste Stelle. Die Wirkungskraft der Aufführung sieht er durch das Primat des Textes eingeschränkt und postuliert das Ende des Lesetheaters. Lehmann baut seine Argumentation auf einem überwiegend engen, linearen und kausallogischen Dramaturgiebegriff auf, entsprechend siedelt er die ästhetischen Neuerungen vor allem in den darstellenden Künsten an.18 Er nennt nur wenige Autoren wie Heiner Müller, Rainald Goetz, Peter Handke und Elfriede Jelinek, deren Werk er für „mindestens teilweise mit dem postdramatischen Paradigma verwandt“ ansieht.19 In aktuellen Forschungsbeiträgen wird Lehmanns textvernachlässigende bis textfeindliche Haltung zunehmend kritisch überprüft und die Übertragbarkeit seines Konzeptes mangels griffiger Analysekategorien in ihre Schranken verwiesen.20 Seitens der französischen Forschung wird die medien- und kunstübergreifende Verwendung des Begriffes Postdramatisches Theater als „fourre-tout théorique“ kritisiert, der den Theaterbegriff aushöhle, anstatt eine begrenzende Definition zu bieten.21 Zudem bleiben Autor_innen wie Bernard-Marie KoltèsKoltès, Bernard-Marie, die bereits vor den 1990er Jahren in ihren Theatertexten zeitgenössische Bühnenästhetik einbinden, unberücksichtigt.22 Eine solche Lücke versucht Hanna Klessinger zu schließen und unterfüttert Lehmanns Ansatz durch ihre philologische Studie zur „Postdramatik“ der von Lehmann angeführten Autor_innnen.23 Ausgehend vom Prinzip der Ansprache in Handkes Publikumsbeschimpfung, die sie als postdramatischen Gründungstext ausmacht, zeigt sie, dass die Theaterautor_innen bereits seit den 1960er Jahren performative Strukturen aus den Nachbarkünsten in ihre Texte einfließen lassen und ebenso auf epische Mittel der Metatheatralität zurückgreifen.24 Hingegen erarbeitet Franziska SickSick, Franziska eine andere Konzeption des Postdramatischen, die für Theatertexte wie auch für Filme Gültigkeit beansprucht. Von den postmodernen Prämissen „Spiel“ und „VirtualitätVirtualität“ ausgehend, zielt sie auf das Drama und seine Geschehensanordnungen ab. Als „postdramatisches Drama“ bezeichnet sie räumliche, ludische und virtuelle Konfigurationen, wie sie bereits bei Samuel BeckettBeckett, Samuel vorliegen.25 Entgegen der von Lehmann behaupteten Ablösung des Textes durch das Postdramatische vertritt Sick den Ansatz eines sowohl Dramatischen als auch Postdramatischen.
2.2Tendenz 1: Text(q)ualität
Das französischsprachige Theater der 1980er und 1990er wird unter dem Vorzeichen der ‚Rückwende zum Text‘,1 bzw. als „Texttheater“ diskutiert.2 Die neue Gewichtung des Textes wird in der Forschung nicht nur auf unterschiedlichen Ebenen verzeichnet. Auch zeigt sich, dass der Textbegriff je nach fachlicher und methodischer Ausrichtung divergiert. Von der Warte der Produktions- und Rezeptionsbedingungen her wird nachgezeichnet, dass Verlage, Theaterfestivals und Theaterhäuser den zeitgenössischen Theatertexten als Lektüre- und Aufführungsobjekt mehr Aufmerksamkeit schenken.3 Es entstehen szenisch reduzierte Vortrags- und Medienformate für zeitgenössisches Sprechtheater wie die mise en espace, die mise en voix und La radio sur un plateau.4 Die ‚neue‘ Konzentration auf die Theatertexte und Autor_innen wird mit der Ausschöpfung visueller und spektakulärer Aufführungsmittel in Zusammenhang gestellt.5 Dass regiebetontes und Autor_innentheater sich nicht gegenseitig ablösen, sondern koexistieren, führt zu überkreuzten Feststellungen.6 Postuliert LehmannLehmann, Hans-Thies 1999 die Emanzipation der Aufführung vom Dramentext, konstatiert CorvinCorvin, Michel bereits 1989: „Le texte conquiert, ou reconquiert, son autonomie et se libère du spectacle“.7
Theaterphänomenologisch ist zunächst zwischen literarischem und szenischem Text zu unterscheiden.8LehmannLehmann, Hans-Thies trennt scharf in den Text, der „im Fall jedes großen Dramas auch schon als Sprachwerk vollendet ist“,9 d.h. in sich geschlossen, fertig und verschriftlicht, und in den erweiterten Begriff von Text als MaterialMaterial für Theater und Performance. Letzterer interessiert ihn ob der szenischen Spiel- und Umgangsweisen anhand akustischer und körperlicher Darbietungsmittel (Stimme, KlangKlang und Rhythmus, Medialität und Körperlichkeit des Sprechens).10 Seinen Textbegriff, der auf das Sprechen als Performance abzielt,11 ist eng geknüpft an assoziative Text- und Klanglandschaften, die er mit Klangkunst, landscape play und Hörspiel in Beziehung setzt.12 Letztlich insistiert er auf der scharfen methodischen Trennung zwischen (literarischem) Text und Theateraufführung,13 d.h. dem sinnlich-erfahrungsbasierten Zugang (Theaterwissenschaft) und dem philologischen Zugang zum Text (Literaturwissenschaft).14 Die Textfrage spaltet auch innerhalb der Fachwissenschaften: Die Einen sehen Text und Aufführung in einem Konfliktverhältnis und heben die Eigenständigkeit von Text als Literatur und von Aufführung als darstellende Kunst hervor,15 andere Positionen insistieren auf die gegenseitige und produktive Beeinflussung und Durchdringung.16 In letzterem Sinne etabliert Gerda PoschmannPoschmann, Gerda das Kompositum „Theatertext“ über den konstitutiven Doppelcharakter „welcher der Dramatik als Bestandteil der Inszenierung einerseits und als literarischer Gattung andererseits eigen ist“.17 Immernoch mit Poschmann lassen sich Theatertexte als literarische Texte mit szenischer Bestimmung und impliziter Theatralität bestimmen als „sprachliche Texte, denen eine performative, theatralische Dimension innewohnt“.18 Dieser Begriff von Theatertext berücksichtigt sowohl die sprachliche und literarische Eigenständigkeit als auch das implizite Aufführungspotenzial. Poschmann beschränkt Theatralität nicht nur auf die Einbeziehung theatralischer Zeichen. Auf Helga Finters Thesen gestützt, ergänzt sie die szenische Repräsentation (konventionelle Theatralität) um die Dimension der autoreflexiven WahrnehmungWahrnehmungsverhältnisse (analytische Theatralität) und um die der Sprache eigenen ‚Texttheatralität‘.19 Poschmanns Theatertextbegriff eignet sich für die Untersuchung der Gegenwartsdramatik, indem er der doppelten Adressierung an Lektüre und an Bühne gerecht wird: Er unterstreicht die „literarisch-sprachliche Bindung, legt diese aber nicht auf gattungshistorisch, d.h. auf Dramenpoetik eingestellte literarische Muster fest“.20 Bayerdörfer führt Poschmanns Ansatz in Bezug auf die Wandlung der Textgestalt weiter aus. Die zunehmende Verwischung der Grenzen zwischen Haupttext und Nebentext bietet Potenzial für eine „Textqualität eigenen Rechts“. Gemeint sind die Möglichkeiten der typographischen Gestaltung der Strukturierung, Markierung, Variation und Hervorhebung durch Kursivsetzung, Zeilensprünge etc..21 Er macht auf neue Verhältnisse zwischen Text, Sprache und Stimme aufmerksam, die die rollen- bzw. figurengebundene Rede ablösen: „Diese veränderte Stimmästhetik findet Anhalt und Entfaltung in der Textgestalt selbst und stellt daher einen der wichtigsten energetischen Faktoren zwischen Bühne und Text des letzten Jahrhunderts dar.“22
Für die Untersuchung der französischsprachigen Gegenwartsdramatik 1980-2000 gilt: Der neue Fokus auf den Text geht über einen veränderten Textstatus in Theaterbetrieb, Aufführung sowie als Lesetext hinaus. Er äußert sich vor allem in spezifischen Textdimensionen und -qualitäten. Ein erster augenfälliger Aspekt ist die Länge der Repliken und der Theatertexte, wodurch sie sich von den kurzen „Stücken“ der Theateravantgarden abheben. Die Bühnenanweisungen schwinden, dafür werden Textelemente ohne Aufführungsausrichtung wie Paratexte, Textkommentare, szeneneinführende Zitate, lange und überspezifische Szenentitel, einführende Erzählungen, narrative Zwischenpassagen eingeschoben oder um den Sprechtext gelagert. Insbesondere bei KoltèsKoltès, Bernard-Marie finden sich solche auf die Lektüre ausgerichteten Textelemente. Manche Theatertexte weisen einen besonderen Umgang mit dem Drucksatz auf. Besondere Schriftanordnungen lassen das Buch zum Theater werden, wie die typographischen Raumspiele auf den Buchseiten von Noëlle Renaudes Texten ab 2000 veranschaulichen.23 Ein zentraler Aspekt ist die Ablösung des Texten von Dialog und Figur. Insofern kann die neue Eigenständigkeit des Textes als ‚Lösungsmittel‘ der Dramaturgie bezeichnet werden: „elle brouille voire congédie les catégories classiques du personnage, de l’action et du sens.“24 Der dramatische Text wird mehrfach aufgebrochen. Nicht nur die Grenzen zwischen Sprechtext und Bühnenanweisung verschwimmen - durch die Hereinnahme von narrativen, lyrischen Elementen und Strukturen bis hinzu Stilformen aus Gebrauchstexten - auch diejenigen zwischen den Gattungen und Textsorten. Dies schlägt sich mitunter im Schriftbild nieder, sodass sich die Theatertexte graphisch nicht immer als solche erkennen lassen, wie beispielsweise Blanche Aurore Céleste, À tous ceux qui und Promenade, die Noëlle RenaudeRenaude, Noëlle als Fließtext und ohne konventionelle Sprecherangaben verfasst hat.25 Die autonom wirkenden Texte aus heterogenen Textmaterialien und Redeweisen brechen mit der linearen und kohärenten Textführung. Die Loslösung des Sprechtextes von der Figur begünstigt mehrstimmige Monologe wie Valère Novarinas Le Discours aux animaux,26 mehrperspektivische und zeitlich mehrdirektionale Erzählungen wie in Jean-Luc Lagarces J’étais dans la maison et j’attendais que la pluie vienne.27 Lyrische und assoziative sowie anspielungsreiche und intertextuelle Schreibweisen halten Einzug in die Sprechtexte und lassen diese zu dichten und vielschichtigen Wortgemengen werden. Mitunter werden sprachliche Qualitäten zur Geltung gebracht, indem das Sprachsystem unterlaufen, überformt wird und verschiede Sprachregister wie Umgangssprache, Alltagssprache und gehobene, lyrische Sprache koexistieren. Die Autonomie des Textes in der Gegenwartsdramatik bedeutet jedoch nicht zwangsläufig ein Verzicht der Bezüge auf nonverbale theatralische Zeichen und die Theateraufführung. Solche werden auf der Ebene des Sprechtextes in Form impliziter Bühnenanweisungen oder metatheoretischer Reflexionen thematisiert. Durch Marker der konzeptuellen Mündlichkeit bleibt der Text als zu sprechende, aufzuführende Rede erkennbar.28 Das Potenzial einer räumlichen AnordnungAnordnung von physischen oder mediatisierten Stimmen bleibt den gegenwärtigen Theatertexten deutlich eingeschrieben.
2.3Tendenz 2: Entdramatisierende und redramatisierende Verfahren
Simultan zur neuen Text(q)ualitätText(q)ualität kündigt sich in den 1980er und 1990er Jahren eine Wiederauflage bzw. Fortentwicklung der Strukturelemente des Dramas an.1 Diese kann als eine Antwort auf das postdramatische Theater verbucht werden,2 lässt sich jedoch ebenso als Reaktion auf die – insbesondere von BeckettBeckett, Samuel betriebene – avantgardistische Zerlegung und Ausreizung der dramatischen Elemente und Strukturen bis hin zu Nullwerten erklären. Damit geht jedoch keineswegs eine Rückkehr zum konventionellen oder „absoluten Drama“ vonstatten;3 suggerieren Begriffe wie „Dramatisches Drama“ oder „théâtre néo-dramatique“ auch eine solche.4 Die neuen Textverfahren brechen auf der Ebene der Rede und über deren zeitliche, räumliche und typographische Anordnungen dramatische Strukturen auf und lassen sich nicht mit gängigen Analysemodellen für Dramen untersuchen. Unterteilt Patrice PavisPavis, Patrice in Oberflächenstruktur als „Textualität“ und „Theatralität“ sowie in die dramatische Tiefenstruktur als Intrige, Dramaturgie, Handlung und Sinn,5 mag dies für einen Untersuchungsvorgang hilfreich erscheinen. Allerdings suggeriert diese Aufteilung, dass sich die Textform und das theatralische Potenzial als äußere Hülle verändern und der Kern des Theatertextes nach wie vor das Drama sei. Entsprechend hält Pavis am strukturalistischen Aktantenmodell fest.6 Bei Theatertexten, insbesondere solcher, die neue (nicht mehr dramatische) Textqualitäten entfalten, stellt sich jedoch nicht nur die Frage, ob sich die Strukturen in äußere und innere aufteilen lassen, sondern auch wie es um die Versatzstücke des Dramas steht. Unverkennbar ist, dass sich die Gegenwartsautor_innen weiterhin auf die dramatische Form beziehen und sich mit ihren Bedeutungsdimensionen auseinandersetzen. Insofern gilt es, auch mit Stefan TiggesTigges, Stefan, dem seitens der postdramatischen Forschung „voreilig verabschiedeten dramatischen Grund- und Restgehalt“ gerecht zu werden,7 d.h. Szondi und KlotzKlotz, Volker folgend, den Weiterentwicklungen nachzugehen.8 Bereits PoschmannPoschmann, Gerda verabschiedet sich nicht vom Drama, sondern differenziert in Umgangsweisen mit der dramatischen Form: deren problemlose Nutzung, bei der die dramatisch erzeugte Fiktion erhalten bleibt und deren kritische Nutzung durch Selbstbezüglichkeit, Umfunktionierung, Unterwanderung (sowie den monologischen Theatertext als Sonderfall).9 Diese beiden Pole in der Forschung können mit den von Tigges eingeführten Begriffen Entdramatisierung und Re-Dramatisierung gefasst werden als Strategien des Verformens und ästhetischen Weiterschreibens von dramatischem MaterialMaterial „im reibungsvollen Spiel zwischen Tradition und Innovation“.10
Wenn auch die Heterogenität der französischsprachigen Theatertexte 1980-2000 der einheitlichen Bestimmung eine Absage erteilt, so lassen sich doch einzelfallübergreifende Ausformungen und Formelemente zusammentragen. Dazu bieten sich die beiden gegenläufigen ästhetischen Verfahren von Entdramatisierung und Redramatisierung an, deren bislang ausstehende Erläuterung und Systematisierung im folgenden Abschnitt nachgekommen wird.
Unter einem entdramatisierenden Verfahren lässt sich ein theaterästhetisches Verfahren verstehen, das die drei konstituierenden Säulen des klassischen Dramas Figur, Handlung und Dialog aushöhlt und die geschlossene Form als die der Mimesis zuträgliche Einheit von Handlungsstrang, Ort und Zeit aufbricht. Die dramatischen Elemente werden dabei aus ihrem linearen und kausallogischen, den Plot unterstützenden Zusammenhang gelöst, stehen nicht mehr gebunden für die Repräsentation einer Handlung sondern vereinzelt für sich im theatralischen Bezugssystem. Im Extremfall entstehen dadurch brüchige und offene Text- und Zeichengefüge. Aus epischen, avantgardistischen und postdramatischen Theatertexten und deren Erforschung lassen sich folgende entdramatisierendeentdramatisierend Verfahrensweisen zusammentragen:
Aushöhlung der Figur: Entmenschlichung (Marionetten, Puppen, GespensterGespenster), Entpsychologisierung und Anonymisierung (Namenlose, „Schwundfiguren“,11 „Textträger“12), Entkörperlichung (motorische Einschränkungen, Trennung von Körper und Stimme, „atopische StimmeStimmeatopisch“13), Fragmentarisierung, Dezentrierung, „ludische Figuren“14
Aushöhlung der dramatischen Handlung: Entmotivation, Entteleologisierung, Fremdsteuerung (durch Objekte, Medien, Theaterapparatur), Banalisierung, Alltagsritualisierung, Wiederholung, Duration, Stillstand und Zuständlichkeit (Warten, Ausharren), verdeckte Handlung, „Spielzüge“15
Aushöhlung des dramatischen Dialoges: Monologisierung,16 „soliloque“,17 Narrativisierung,18 vage Adressierung,19 Poetisierung,20 Entfunktionalisierung (Informationsüberschuss, Redeschwall, Autonomie der Sprache), Sprachversagen (Lückenhaftigkeit, Zusammenbruch der Sprache),21 Sprachlosigkeit (Schweigen, Stille, Pantomime), PolyphoniePolyphonie und „choralité“22, Redewiedergabe, externe Kommunikationsebene (Publikumsansprache,23 „Diskurs“24)
Aufbruch der Einheit des Ortes: Pluralisierung, Metaphorisierung und Abstrahierung des Bühnenbildes, Distanzierung, topologische Strukturen, Stationendramaturgie,25 Thematisierung des Spielraumes, leerer RaumRaumleerer
Aufbruch der Einheit der Zeit: Achronologie, Rückläufigkeit, Vorläufigkeit, Gleichzeitigkeit der Zeiten, offener Anfang, offenes Ende, Thematisierung der Spielzeit
Aufbruch der Einheit der Fabel: Entlinearisierung, Fragmentarisierung,26 Brüchigkeit, Inkohärenz, Demontage,27VirtualitätVirtualität,28 Pluralisierung, Bilderfolgen, Repetitivität, Zirkularität, Variation, Unterbrechung, TanzTanz- und Musikeinlagen
Aufbruch von Repräsentation / Nachahmung: Verzicht auf lebensweltliche Referenz, vermittelte und distanzierende Darstellungsweisen, Fiktionsbrüche, Autonomie der Zeichen, Ironisierung, Synästhesie, Bedeutungsverweigerung, Thematisierung des Spiels, Metatheatralität
Unter redramatisierenderedramatisierend Verfahren hingegen fallen Bestrebungen, die an Konstituenten oder Einheiten des Dramas festhalten, bzw. sie unter veränderten Bedingungen wiederaufnehmen. Bezogen auf die Figur kann das bedeuten, diese wieder mit Namen und/oder Sozialstatus zu versehen, ihre Identität in narrativer, prozessualer Form wieder aufzubauen oder ihr als Sprechinstanz einen neuen Stellenwert zukommen zulassen.29 Nicht zu rechnen ist jedoch mit einer Rückkehr zu Aktanten als prinzipien- oder wertegeleitete Figuren (oder Instanzen) in Relationen von Opposition, Kooperation und Behinderung.30 Kommt der Handlung wieder ein zentraler Stellenwert zu, dann nicht als einer einheitlich, teleologisch geführten großen Handlung, sondern im Sinne einer Handlung minderer Gespanntheit,31 d.h. ohne Konflikte bzw. mit interpersonellen oder innerpersonellen Mikrokonflikten.32 Ein wandelndes Handlungsverständnis wird bereits von Maurice MaeterlinckMaeterlinck, Maurice vorbereitet, der die Alltagshandlung gegenüber der großen Handlung der Abenteuer, Schmerzen und Gefahren abgrenzt, indem er die Stille, die Langsamkeit, das Innehalten, die alltägliche Einfachheit der Existenz hervorhebt.33 Neben einem von außen nicht sichtbaren, verdeckten Geschehen setzt er einen Schwerpunkt auf die „parole“ im Gegensatz zum Handlungsvollzug.34 In dieser Hinsicht ließe sich dramatisches Sprechhandeln um Redeformen des Erzählens, Beschreibens, artikulierten Wahrnehmens und Reflektierens erweitern und öffnen hin zu (jedem potenziell szenischen) Sprechen als Handlung. Der Dialog büßt zwar seine Form und Funktion der logik- und werteorientierten Wechsel- und Überzeugungsrede ein, hält sich aber als reduzierter Wortwechsel oder auch als formale Zuspitzung eines agonistischen Wortspiels zu einem Ping Pong von Redewendungen und Redeweisen. Auch wird der Dialog durch alltags- oder medienbezogene Kommunikationsanordnungen wie der des Interviews oder der Moderation geprägt. Publikumsansprache, metasprachlicher oder metatheatralischer Kommentar sind zwar entdramatisierendeentdramatisierend Mittel, lassen sich jedoch auch als Ausbau des Dialoges auf einer anderen Ebene verzeichnen. Die Sprechtexte der Gegenwartsdramaturgien verweisen stärker als die der Avantgarden auf die außerszenische Lebenswelt und enthalten explizite oder implizite Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen, politischen und spätkapitalistischen Lebensbedingungen.
In der Analyse gilt es nun nicht, Verfahren von Entdramatisierung und Redramatisierung anhand einzelner Elemente nachzuweisen, sondern vielmehr zu untersuchen, in welchem Verhältnis diese zueinanderstehen, sich wechselseitig bedingen und Bedeutungen generieren. Es lässt sich bereits vorwegnehmen, dass in französischsprachigen Gegenwartsdramaturgien entdramatisierendeentdramatisierend und redramatisierenderedramatisierend Verfahren in ein und demselben Theatertext koexistieren.
2.4Tendenz 3: Postmoderne Ästhetik als besprochene Sinneswahrnehmung
PostmodernePostmoderne Ästhetiken (künstlerische Arbeiten wie ästhetische Theorie) stehen in der Kritik einer apolitischen, sinnlichkeits- und materialorientierten wie autoreferentiellen und nihilistischen Formensprache bzw. Argumentation, die spätkapitalistische Lebensweisen und Strukturen reproduziere oder ihnen gar zuarbeite.1 Dies soll bei einer Untersuchung von Theatertexten aus einer Zeit, die als brutal kapitalistischkapitalistisch gilt,2 nicht unberücksichtigt bleiben. Alain BadiouBadiou, Alain macht einen ästhetisierenden NihilismusNihilismus fest, hinter welchem sich – infolge der Schlüsse aus den Katastrophen des 20. Jahrhunderts – eine allgemeine OrientierungslosigkeitOrientierungslosigkeit äußere.3 Ein auf Sinnesreize und Spektakel setzendes Theater, mit aufwändigen, perfekten Aufführungen, üppigem und zeremoniellem Zierrat, exponierter Körperlichkeit und Nacktheit, pop- und subkulturellen Einflüssen und einem Mix der Künste täusche über die Orientierungslosigkeit hinweg, nehme sie gar hin.4 Bernd Stegemann nimmt explizit das postdramatische Theater ins Visier und weist auf den inflationären Gebrauch des Begriffes Performance und dessen Doppeldeutigkeit hin: sowohl die Darstellung als auch die Leistung bezeichnend.5 Dabei übersieht er die frühe Reflexion des Begriffs durch Jean-François LyotardLyotard, Jean-François, der in La condition postmoderne das Prinzip der performance als postmoderne (ökonomische) Bedingung identifiziert und beschreibt.6 In Lehmanns weitestgehendem Verzicht auf inhaltliche Rückschlüsse oder kulturhistorische Einbettung, seiner auf Performanz, Form und Wirkungsästhetik reduzierten Beobachtung finden ebensolche Kritiken geradezu Bestätigung.7 Theater wie auch Dramatik sind jedoch dann postmodernpostmodern, wenn sie sich mit der Moderne auseinandersetzen, den fortlaufenden Katastrophen (auch) formalästhetisch entgegnen und an die ästhetischen Programme der modernen Avantgarden anknüpfen.8 Entdramatisierende Verfahren brechen sprachliche und nichtsprachliche Formen und Einheiten auf und erzeugen Konfrontationen, die die Explosion von Werten künstlerisch durchspielen, so Christian Biet: „douter du monde, rendre compte de son explosion, c’est aussi proposer une organisation des mots, des phrases, du discours et du dispositif théâtralqui correspond à la radicalité du projet“.9 In diesem Sinne stehen Verfahren der Demontage und Fragmentarisierung mit Verhältnissen der Desorganisation, der Unerklärbarkeit und der Unmöglichkeit von (Wieder)Aufbau in Zusammenhang.10
Entdramatisierungsbestrebungen, die mit einer Mehrschichtigkeit und Komplexität einhergehen, führen zu einer erschwerten Lektüre. Der Eindruck hermetisch geschlossener und überfordernder Werke durchzieht die Forschungsbeiträge und gibt Anlass zu Handreichungen zur Lektüre und Einordnung von Gegenwartsdramatik, die sich bewährten Modellen entzieht.11 Die Auflösung konventioneller dramatischer Kategorien bricht mit Rezipient_innenerwartungen. Sprachliche Über- und narrative Unterinformation und falsche Fährten führend dazu, dass sich die Theatertexte nicht mehr leicht zusammenfassen, die Elemente eines Plots nicht mehr leicht erkennen oder rekonstruieren und Bedeutungen sich nicht mehr leicht erschließen lassen.12 Mit dem Aufbrechen der geschlossenen Handlung erübrigen sich Ziel und Zweckhaftigkeit. Mit der Störung der Referenzfunktion und Bedeutungsgenerierung von Sprache wird längst kein Sinn mehr in Aussicht gestellt. Bisweilen werden in der Forschung sprachliche und dramaturgische Strukturen der Wiederholungen, Kreuzungen, Multiplizierungen und Ambivalenzen als Bedeutungsverweigerung verbucht. Dementsprechend hält CorvinCorvin, Michel die bei NovarinaNovarina, Valère festgestellte Musikalität und den Materialismus der Sprache für höchste Sinnverweigerung und Bedeutungsleere:
rien d’autre que le vide – c’est à dire la suspension du sens par le mouvement rythmique. L’appel au vide est conçu comme point ultime del’entendement. La langue se transmet par le rythme mais comme la langue ne communique rien et que le verbe est incompréhensible, tout ce bruissement des mots équivaut au vide.13
Sich auf Unverständlichkeit, Kommunikationsverweigerung und Rhythmus stützend, tut er Novarinas Text mit einem ‚Rauschen‘ ab und feiert die Bedeutungslosigkeit und LeereLeere: „vivent donc les textes et les spectacles incompréhensibles!“14Sich vermeintlich auf LyotardLyotard, Jean-François stützend, bringt Ryngaert den von ihm verzeichneten Sinnverlust mit dem Verlust von Anhaltspunkten durch den Verfall der Ideologien in Zusammenhang: „la perte du narratif se double de la perte du sens“.15 Bekanntlich stellt Lyotard das Ende der großen Meistererzählungen und Errungenschaften der Moderne wie dialektisches Denken, Sinnhermeneutik, Fortschritt und Emanzipation des vernünftigen oder arbeitenden Subjektes fest.16 Interessant für die Untersuchung zeitgenössischer Theatertexte ist jedoch der positive Wert, den Lyotard angibt: an die Stelle der Meistererzählungen treten vielfache, kleine Erzählungen.17 Zudem betont er die Verwindung zwischen Inhalts- und Formebene, geht auf die schwindende Einheit der Erzählung näher ein und verzeichnet eine Dekomposition in ihre Funktionselemente bis hin zur Zerstreuung in einzelne Sprachelemente.18 Damit ist nicht ausgesagt, dass Bedeutungen obsolet werden, sondern diese auf verschiedenen Ebenen und zwischen den Einzelelementen der Texte generiert werden können.
Die Sinnfrage, die die Forschung bis hin zu den Gegenwartsdramaturgien durchzieht,19 erübrigt sich bereits seit ihrer Ironisierung und Parodie bei BeckettBeckett, Samuel und Ionesco.20 Vielmehr gilt es demnach, die Gegenwartsdramatik auf einen Restbestand an Aussagen, Bedeutungen bzw. Bedeutungsangeboten zu prüfen. Die bisherige Forschung verlagert die Bedeutungskonstrukton, bezugnehmend auf Umberto Ecos Lector in fabula, auf die Ebene der Rezipient_innen als Koproduzent_innen der Theatertexte, die die Synthese der disparaten Einzelelemente und das assoziative Füllen von Leerstellen und Offenheiten leisten.21 Dies entspricht auch dem Rezeptionsverständnis der gegenwärtigen Theaterwissenschaft, die den Fokus auf die Erfahrung des Publikums legt, Rezeption und WahrnehmungWahrnehmung gleichsetzt.22 Im postdramatischen Theater solle die sinnliche Publikumsaktivität die Zusammenhangslosigkeit disparater, unüberschaubarer, synästhetischer Eindrücke kompensieren.23 Es gehe darum, den Wahrnehmungsapparat herauszufordern, Sinneseindrücke zu intensivieren und bewusst zu machen.24 Außer einem vagen Bezug zur Medienkultur verhandelt LehmannLehmann, Hans-Thies diese Verfahren lediglich wirkungsästhetisch.25 Dabei haben entdramatisierendeentdramatisierend Verfahren in Theatertexten seit den Avantgarden immer schon dafür gesorgt, Wahrnehmungsprozesse bewusst zu machen, Darstellungs(un)möglichkeiten kritisch zu reflektieren und auf die „Unzulänglichkeit des dramatischen Theaters als Medium zur Darstellung von Welt und Welterleben“ hinzuweisen.26 Mit dem Undarstellbaren klingt hier bereits ein zentrales (post)modernes Reflexionsmoment an.27 Ein wichtiger Aspekt wird jedoch sowohl in der Theater- als auch in der Dramenforschung bisher verkannt: die Anerkennung und Aufwertung der Sinneswahrnehmung als Modus des Verstehens und der Auseinandersetzung mit Welt, wie sie innerhalb der Theatertexte via Rede verhandelt wird. Allein FinterFinter, Helga deutet diesen Aspekt an: „Das Drama ist in die Sinne verlegt, Auge und Ohr haben die Bedingungen von Sehen und Hören, den Weg, der zum Verstehen führt, selbst zu rekonstruieren“.28
Ebenso wie die Forschung die WahrnehmungWahrnehmung auf der Wirkungsebene behandelt, fällt auch der Begriff der Orientierung nur in Rezeptionszusammenhängen. So stellt LehmannLehmann, Hans-Thies die rückversichernde Einheit des Dramas einer desorientierenden Ästhetik des postdramatischen Theaters gegenüber: „Die kompensatorische Funktion des Dramas, dem Durcheinander der Wirklichkeit eine Ordnung zu supplementieren, findet sich verkehrt, der Wunsch des (sic) Zuschauers (sic) nach Orientierung desavouiert“.29 Stärker noch insistiert CorvinCorvin, Michel auf dem Moment der gezielten DesorientierungDesorientierung der Rezipient_innen von Gegenwartsdramatik. Er behauptet, dass dramenästhetische Anhaltspunkte zerschlagen und damit Lektüreerwartungen und Lesegewohnheiten verletzt werden:
[…] les frontières sont abolies entre le réel et l’imaginaire, le dedans et le dehors, entre le passé, le présent et le futur, le vécu et le rêvé; l’œuvre est décomposée, par fragmentation, juxtaposition, discontinuité de ses éléments; le langage a acquis son autonomie et, désapproprié, n’appartient plus à personne; la pièce n’est plus enfermé dans un cadre limité d’espace où d’objets […]30
Corvins Essays zum zeitgenössischen Theater sind von Desorientierungsmetaphern durchsetzt. Er stilisiert den_die Leser_in als irrende_n Spaziergänger_in, der_die sich nur beschwerlich entlang der langen, verdunkelten, überkreuzten Wege des (Lese-)Parcours vorantaste.31 Eine eingehende Untersuchung der Texte wie eine kulturhistorische oder philosophische Einordnung solch erwirkter DesorientierungDesorientierung fehlt.
Die an der postmodernen Ästhetik allgemein – und am postdramatischen Theater im Besonderen – kritisierten Punkte Formalismus, Sinn- und Bedeutungsverweigerung, Selbstreferentialität, Wahrnehmungs- und Wirkungsbezogenheit werden von der Forschung zur Gegenwartsdramatik gespiegelt. Es liegen formal- und wirkungsästhetische Beschreibungen vor, die zwar mehr oder weniger direkt auf postmoderne Begrifflichkeiten zurückgreifen, jedoch ohne deren Reflexions- und Bedeutungsgehalt zu berücksichtigen. Argumentiert wird fast ausschließlich innerhalb der ästhetischen Systeme von Theater und Drama, was weder den postmodernen Theorien noch den zeitgenössischen Theatertexten gerecht wird.
Daraus ergibt sich ein dreifaches Ziel dieser Untersuchung zeitgenössischer Dramatik: erstens zu zeigen, dass die Theatertexte über eine sinnverweigernde, selbstbezogene Ästhetik hinausgehen, zweitens neben entdramatisierenden auch redramatisierenderedramatisierend Verfahren zu eruieren,32 und drittens auszuloten, inwiefern die Theatertexte postmoderne Erfahrungen und Haltungen thematisieren und diskutieren. Darunter versteht sich keineswegs eine Haltung ‚nach der Moderne‘, sondern das künstlerische und diskursive Durcharbeiten der Moderne,33 ihrer Formen und ihrer kulturellen Narrative, Wissensbestände, Lehren, Erkenntnisse und Glaubenssätze. Damit ist die PostmodernePostmoderne als radikale Befragung der Moderne zu verstehen, mit deren avancierten künstlerischen Vertreter_innen sie ebenso eng verflochten ist und an deren künstlerischen Experimente sie als „Nachhut“ anknüpft.34 Fortgesetzt werden neben Entdramatisierungsverfahren als Sprengungen von Einheiten und Stabilitäten auch ästhetische Reflexionen zu Wirklichkeitsverständnissen und Darstellungs(un)möglichkeiten anhand des Spannungsverhältnisses z.B. zwischen Bildlichkeit und Sprachlichkeit sowie über Medialität (WahrnehmungsdispositivWahrnehmungsdispositiv, Text-Aufführungsverhältnis). LyotardLyotard, Jean-François unterscheidet bereits zwischen der (nostalgischen) modernen Ästhetik mit VerhandlungVerhandlung des Undarstellbaren auf der Inhaltsebene und der (formsuchenden) postmodernen Ästhetik (zu der er Vertreter_innen der Avantgarden zählt) mit Verhandlung des Undarstellbaren auf der Darstellungsebene.35 Anhand von Theatertexten lässt sich darüber hinaus ein markanter Unterschied zwischen (postmoderner) Theateravantgarde und (postmoderner) Gegenwartsdramatik feststellen. Die Avantgarden untersuchen Wahrnehmungsanordnungen und experimentieren mit Wahrnehmungsmodi künstlerisch, die dann in der postmodernen Philosophie sprachlich reflektiert und konzeptualisiert werden.36 Damit wird die avantgardistische Kunst zur Modellsphäre, in der das sinnliche Begreifen von Wirklichkeit musterhaft eingeübt, verhandelt und zur Erfahrung gebracht wird.37 Künstlerische Praxis wie Kunstrezeption werden zum Wahrnehmungsdenken, der Fokus von Ästhetik verschiebt sich hin zur Aisthetik.38 Die postmoderne Gegenwartsdramatik hingegen führt die künstlerischen Experimente der Avantgarden und die postmodernen Theorien zusammen und weiter. Das Theater fungiert dabei nicht nur als ästhetisch zu reflektierender Rahmen, als Kontext oder Bezugssystem, sondern auch als Modell menschlichen Handelns. Dieses Handeln ist lediglich neu zu bestimmen. An die Stelle einer ganzen, großen, geschlossenen, metaphysischen oder existentialistischen Handlung tritt das Verständnis eines lebensweltlichen, situativen Handelns und Verhaltens. Dazu gehören insbesondere aisthetische und verbale Modi: Wahrnehmen als ein Auseinandersetzen mit der Umwelt, dem Anderen und dem Selbst; Verorten, Situieren, Prospektieren als Eruieren von Handlungsweisen und -möglichkeiten; Erzählen und Beschreiben von Erfahrungen und Erinnerungen; Begegnen mit und Verhalten zu den Dingen, dem Anderen und dem Selbst.
3Raum und Orientierung als Untersuchungsperspektive
Die Untersuchungsperspektive von Raum und Orientierung für die französischsprachige Gegenwartsdramatik zielt zunächst auf Erkenntnisse zum Verhältnis zwischen Figur und Raum ab, bindet jedoch auch die Problemstellung des Handelns und die Dimension der Zeit mit ein. Anzunehmen ist, dass zwischen den unterschiedlichen Theatertexten neben gemeinsamen formalästhetischen Tendenzen auch ähnliche Themenkomplexe bestehen und nuancierte Aussagen über die Bedingungen des Menschseins sowie Einschränkungen und Möglichkeiten des Handelns in der Gegenwart herausgearbeitet werden können.
Es liegt nahe, dass Raumerfahrungen, Ortsveränderungen und Reisen vornehmlich in der Erzählliteratur und im Film thematisiert werden: „Le cinéma et le roman voyagent, le théâtre pèse de tout notre poids sur le sol.‟1 Nur in Ausnahmefällen ist das Verhältnis zwischen Figur und Raum im Theater irritiert und wird dadurch erst zum Thema, insbesondere wenn die Handlung an einen fremdartigen Ort versetzt wird. Es handelt sich dabei vor allem um Anordnungen mit Experimentcharakter, d.h. eine oder mehrere Figuren werden eingangs von einer Schwellenfigur in eine unbekannte Gegend geleitet, die sie sich fragend, abgleichend und erkundend erschließen wie in Pierre Corneilles Illusion comique, in Marivauxs La dispute oder in Jean-Paul Sartres Huis clos.2 Seltener sind Dramen- oder Theatertexte, in denen die Figur in ihrem heimischen Interieur die Orientierung verliert, so der Bürger Langlumé in Labiches L’affaire de la rue de Lourcine, der nach einer nächtlichen Eskapade mit Erinnerungslücken aufwacht.3 Räumlich geartet sind Desorientierungen dramatischer Figuren auch, wenn der einheitliche Schauplatz durch Umschlagsmomente z.B. mittels eines Vorhangs auf einen Gegen- und Ergänzungsraum hin erweitert wird und dadurch SpurenSpur und Wahrheitsversionen zu Tage treten, die zur Verunklarung und Verwirrung von Ordnungen, Selbst- und Fremdbildern führen.4 Diese auch in Bezug auf die theatralische Illusion subversiven und destabilisierenden Momente erweisen sich jedoch als reparabel, mehr noch, die DesorientierungDesorientierung spielt der höfischen bzw. bürgerlichen Ordnung zu, indem die Stücke mit einer Rückkehr zur Ordnung und einer Reparatur enden. Die auf der Einheit und Geschlossenheit basierende Illusion bleibt ebenso intakt wie die sozialen Normen, an denen die Handlungen der Figuren ausgerichtet sind. Erst die Theatertexte der Avantgarden brechen nicht nur den geschlossenen Schauplatz, sondern auch Werte und damit „OrientierungsinstanzenOrientierungsinstanzen“ auf.5 Darin wird die menschliche Handlungsfähigkeit in einen direkten Zusammenhang mit Raumverhältnissen gestellt und in einzelnen Theatertexten in Verbindung mit räumlicher Desorientierung szenisch verhandelt.
3.1Mensch-Raumverhältnisse in avantgardistischen Theatertexten
Während in den Texten der ersten AvantgardeAvantgarde Figuren und Geschehen in visuelle oder sonore Kulissen mit klarer Referenz auf die außertheatralische Lebenswelt eingelassen sind, steigern sich in der zweiten Theateravantgarde der Abbau des mimetischen Schauplatzes und der Abstraktionsgrad der Bühnenentwürfe.
Als Vertreter der ersten AvantgardeAvantgarde entwerfen Antonin ArtaudArtaud, Antonin und Maurice MaeterlinckMaeterlinck, Maurice offene Räume, die mit geltenden oder überkommenen Welt- Wissens- und Glaubensfragen brechen. Sie thematisieren destabilisierte Raumverhältnisse, jedoch nicht in Bezug auf Einzelfiguren, sondern auf Kollektive. Ihre Theatertexte bilden wichtige Referenzpunkte für den Umgang mit Raum und Orientierung in der Gegenwartsdramatik: Sie enthalten Konzeptionen entgrenzter Räume, besprochene Raumwahrnehmung sowie Korrelationen von räumlicher Öffnung und DesorientierungDesorientierung mit der Infragestellung metaphysischer und wissenschaftlicher Gewissheiten. Letzter Aspekt lässt sich an die kulturhistorische Zäsur der raumwissenschaftlichen Erkenntnisse (die Entdeckung der Relativitätstheorie) sowie des nietzscheanischen NihilismusNihilismus (Gott ist tot) rückbinden.
Artauds kurzer Musiktheatertext Il n’y a plus de firmament dreht sich um die Auseinandersetzung mit dem offenen astronomischen Raum.1 Er beginnt mit Dunkelheit und dem minutiösen Entwurf einer bedrohlichen Klangkulisse aus explosionsartigen, vom Himmel herabtönenden Geräuschen. Dazu setzt eine Lichtführung von unreinen Farbübergängen ein: rot wird zu grün, zu weiß, zu gelblichem Nebel. Schauplatz ist eine Straßenkreuzung, wimmelnd von Menschen, deren zum Himmel gerichtete Gesten sich steigern. Einem stimmlichen Durcheinander, einem „tourbillon de voix et de cris“ sind Kommentare und Erklärungsversuche zu einem außergewöhnlichen, verunsichernden astronomischen Phänomen zu entnehmen. Die kaum durchdringenden journalistischen wie offiziellen Stimmen verkünden eine Wissenschaftssensation: das Ende des Himmelszeltes, die Näherung des Planeten Sirius und die Etablierung einer interplanetaren Kommunikation. Ausrufe von Weltende, Chaos, Revolte, Wissenschaftsskepsis und Religionsskepsis bestimmen den Tumult. Ein zweiter Schauplatz verlegt das Geschehen in einen Raum versammelter wissenschaftlicher Expert_innen mit der Zentralfigur des Erfinders auf dem Podium. Es wird über Nützlichkeit und Ethik der Entdeckung diskutiert, vor dem Weltende gewarnt und vor der Aufhebung der Orientierung: „Mais vous allez faire sauter la boussole […] - En somme vous supprimez l’espace […] - La fin du monde c’est pour les livres. On ne verra pas encore l’Antéchrist […] – La radiation instantanée c’est la fin du cosmos“.2 Die Erklärung, es gebe kein Himmelszelt mehr, leitet nicht nur raumtheoretisch und astronomisch eine Öffnung ein, sondern beansprucht auch politisch, theologisch und wissenschaftlich Geltung und greift damit implizit die 1916 von Georg Lukács festgestellte „transzendentale Obdachlosigkeit“ einer Welt ohne Gott auf.3 Mit sonoren, visuellen, sprachlichen, gestischen und proxemischen Mitteln entwirft ArtaudArtaud, Antonin ein offenes Raumkonzept, eine Atmosphäre der Unübersichtlichkeit. An Stelle einer Figurenperspektive sieht er eine musikalische Komposition von Geräuschen und Stimmen vor, die widerstreitende Spekulationen in den Raum werfen und die Uneinigkeit der Werte eines Kollektivs erkennen lässt.
In Les aveugles von Maurice MaeterlinckMaeterlinck, Maurice ist die Figurenkonzeption ebenso anonym wie in Artauds Theatertext: ein Priester inmitten von sechs blinden Männern und sechs blinden Frauen. Der Raumentwurf ist offen, betont dunkel, natursymbolisch und kosmisch:
une très ancienne forêt septentrionale, d’aspect éternel sous un ciel profondément étoilé. […] De grands arbres funéraires, des ifs, des saules pleureurs, des cyprès, les couvrent de leurs ombres fidèles. Une touffe de longs asphodèles maladifs fleurit non loin du prêtre, dans la nuit. Il fait extraordinairement sombre, malgré le clair de lune qui ça et là, s’efforce d’écarter un moment les ténèbres des feuillages4
Die blinden Figuren sitzen ungeachtet des regungslosen, starren Priesters schlafend, betend und ruhend auf Baumstämmen. Das Hauptgeschehen besteht in verschiedenen räumlichen und zeitlichen Orientierungsversuchen mittels verbalem Austausch und Wahrnehmungsgesten. Eine Orientierungsstrategie besteht darin, sich gegenseitig zu ertasten und die Anwesenheit gegenseitig stimmlich zu überprüfen. Im Sprechtext lässt MaeterlinckMaeterlinck, Maurice die Figuren sich räumlich zueinander in Bezug setzen, sich anhand der Lokaldeiktika nah, fern und neben verorten. Die vollständige Anwesenheit der Gruppe wird eruiert und die Abwesenheit des Priesters festgestellt. Dieser wird, als einzige sehende Figur unter blinden, als „guide“ bezeichnet und scheint die Gruppe aus einem Hospiz an einen der Gruppe unbekannten Ort geführt zu haben.5 Die FremdorientierungFremdorientierung wird umso deutlicher betont, als weitere Orientierungsversuche darin scheitern, topographische Informationen aus erinnerten Worten des Priesters zusammenzutragen, den gegangenen Weg zu rekonstruieren. Sonore Orientierungsversuche schlagen fehl, da die Geräuschkulisse nur auf einen fremden Ort schließen lässt.6 Zeitliches sich Orientieren scheitert durch die Unmöglichkeit für die blinden Figuren zwischen Sonne und Dunkelheit zu unterscheiden. Die zunehmende Ausweglosigkeit und Verunsicherung in der Gruppe steigert sich mit einem eintreffenden Hund, der sie auf ein totes Mitglied stößt. Durch erneute stimmliche Präsenzabfrage wird auf den Priester geschlossen. Das Stück endet mit dem Vernehmen sich nähernder Schritte, die in der Mitte der Blinden verklingen und das laute Weinen eines anwesenden Neugeborenen auslösen. Typisch für Maeterlincks Theatertexte sind die in der Bühnenanweisung angelegten und via Figurenrede besprochenen natursymbolischen Vorzeichen für den Tod: die zunehmende Kälte, die Totenblume Affodill und die auf die Figuren herabfallenden „feuilles mortes“. Die Fremdheit, Orientierungswidrigkeit und Unzuverlässigkeit des Ortes wird insbesondere durch die Dunkelheit und das Misstrauen gegenüber dem Boden verdeutlicht: „Premier aveugle-né. – je n’ose pas me mettre à genoux… Deuxième aveugle-né. – On ne sait pas sur quoi l’on s’agenouille ici…“7OrientierungsinstanzenOrientierungsinstanzen wie Glaube, Gemeinschaft, Wissen und die Hoffnung auf Heil, das Bild einer Schafsherde, die nach Sonnenuntergang in den Stall zurückkehrt, die symbolische Verknüpfung von Sehen und Wissen werden besprochen, jedoch situativ negiert.8 Stattdessen betten Andeutungen von natureigenen Zyklen durch Sterne, Meer, Mond, Nacht und Tag, Geburt und Tod, Jugend und Alter das bezugslos und geheimnisvoll wirkende Geschehen in kosmische Zusammenhänge ein.
Wenn in den Theatertexten der zweiten AvantgardeAvantgarde Raumelemente eingesetzt werden, dann in potenzierter Mimesis, d.h. um die Dekorhaftigkeit des Dekors anzuzeigen wie in den Macht- und Lustanordnungen der Theatertexte Jean Genets. Die Schiebewände in Les Paravents,9 die Tribüne in Les nègres und die thematisch dekorierten und trickreichen Bordellzimmer in Le Balcon werden jedoch nicht besprochen, sondern kommen vor allem proxemisch und gestisch zum Einsatz.10 Sie markieren Grenzen und Schwellen, unterteilen und dynamisieren den Raum, ermöglichen Raummanöver, Macht- und Werteumkehrungen (oben – unten, drinnen – draußen, geschlossen – einsehbar, ausgestellt – verdeckt). Einen ebenso bemerkenswerten Beitrag nicht nur zur impliziten Raumtheorie sondern auch zur Raumregie vom Stücktext aus leistet Samuel BeckettBeckett, Samuel, der seine Figuren proxemisch und gestisch den Bühnenraum erkunden und untersuchen lässt.11 Im Endspiel beispielsweise kommen „Inspektionswerkzeuge“ und „Reisewerkzeuge“ zum Einsatz,12 der Raum wird durch Spielzüge, Schrittmaß und iterative Wege vermessen. Dadurch, dass der Raum beim späten Beckett „entzeitlicht“ und „entutopisiert“ wird, kommen ausschließlich räumliche Orientierungsversuche vor, während das frühere Stück Warten auf Godot noch eine zeitlich geprägte Dramaturgie andeutet.13 Das Warten der Figuren ist auf ein (nicht eingelöstes) Ereignis aus dem Außen ausgerichtet. Wie Franziska SickSick, Franziska herausstellt, liegt diesem frühen Theatertext noch eine metaphysisch geprägte und existenzialistische sinnbesetze Zeit zugrunde, auch wenn Beckett der Gespanntheit des (Er)Wartens eine angehaltene Zeit entgegensetzt.14 Bereits im Endspiel kann von einem leeren, denn ereignislosen Raum gesprochen werden.15 In seinen späten Theatertexten betreibt Beckett einen zugespitzten, bühnenräumlichen und visuellen Minimalismus, der nicht nur den Theaterraum in seiner Medialität thematisiert, sondern auch auf einen ästhetischen Raum der LeereLeere abzielt. Im choreographischen Raumspiel Quad sieht Beckett eine leere Bodenfläche vor, aus der erst durch rhythmische, exakt festgelegte Raumwege vier schreitender anonymer Gestalten eine plane, geometrische Figur entsteht: ein Quadrat mit Diagonalen, die im Zentrum einen Kreuzpunkt bilden.16 Neben dem proxemischen Nachvollzug geometrischer Gesetzmäßigkeiten entsteht auch das Zeichen X mit seiner ambivalenten Bedeutung, einerseits als Markierung oder Positionsbestimmung im Raum und andererseits als Geste der (sprachlichen) Tilgung sowie als Unbekannte in geometrischen Formeln.17 Die rätselhafte Raumstelle wird in der Variante Quad II durch den ausgesparten zu umschreitenden Kreuzungs- und Mittelpunkt negiert und zu einer leeren Zone, gerade dadurch jedoch nicht minder hervorgehoben.18 Der leere Raum besteht in der Abwesenheit von Bühnenbild und Ausstattung verneint Hintergrund, Behälter oder Stätte für die Handlung. Stattdessen wird deutlich, dass sich der Spielraum erst durch die proxemische Bewegung konstituiert. Voraussetzung dafür ist die Plattform als fester, stabiler und begehbarer Grund. Die durch die Schritte markierte quadratische Spielfläche ähnelt einer zweidimensionalen Zeichenfläche, die sich erst durch die Begrenzung eines Zeichengrundes konstituiert. Beckett legt den Fokus auf die Produktion eines Spielraumes durch die regelgeleitete Eingrenzung eines offenen Feldes.
Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass in Genets und Becketts szenischen Entwürfen und proxemischen Anweisungen räumliche Grenzen und Markierungen hervorgehoben, durch Blicke und Übertretungen durchbrochen oder relativiert werden. Begrenzte Räume werden erkundet, geöffnet, ausgetestet; räumliche Wertekategorien gekippt und umgekehrt. Dennoch bleiben räumliche Bezugsgrößen (oben und unten, Zentrum und Rand, innen und außen, Vorder- und Hinterbühne, Bühnenraum und Zuschauerraum) erhalten. Mehr noch als GenetGenet, Jean betont BeckettBeckett, Samuel sowohl in den frühen als auch späten Theatertexten Boden und HorizontalitätHorizontalität.19 Auch wenn Wladimir und Estragon im Nirgendwo verweilen, bildet der Baum auf dem Weg nicht nur eine Stellenmarkierung auf einer Strecke,20 sondern betont durch die Verankerung in der Erde den Boden und die Immanenz. Das „Raumgerüst der Stelle, auf der man herumtritt“ schränkt die Handlungsfähigkeit und Mobilität ein,21 bietet jedoch auch Raumbezug und insofern Orientierung. Dies trifft ebenso auf die räumlich ausgerichteten Routinen, Rituale und die Regeln der Raumspiele zu.
Eine Ausnahme bildet das kurze Stück Nicht ich (Not I) von 1972, in dem ein angeleuchteter, sprechender MUND in einem dunklen, konturlosen und entgrenzten Bühnenraum schwebt, ähnlich der gegenüber stehende VERNEHMER: „Bühne dunkel bis auf MUND, im Hintergrund rechts, etwa 2,50m über Bühnenbodenniveau […] VERNEHMER, im Vordergrund links, große stehende Gestalt […] auf einem unsichtbaren, etwa 1,25m hohen Podium“.22 Der von MUND zu sprechende Text ist losgelöst von einer Figur, was die Herausbildung eines szenischen Sprachraumes begünstigt. Durch die ausschließlich hörende Instanz des VERNEHMERS handelt es sich um eine einwegige RedeanordnungRedeanordnung. Der Solilog von MUND besteht in einem erinnernden, brüchigen, zögernden und ungerichteten Redeschwall. Es werden unverknüpfte, fußgängerische, perzeptive wie mentale Desorientierungserlebnisse geschildert wie das ziellose Umherschweifen auf einem FeldFeld, das Starren in die LeereLeere, das Wahrnehmen von Rauschen und das Abtasten im Gehirn. Mit dem entgrenzten, dunklen (szenischen) Raumkonzept, der vagen Auftrittsfläche, der besprochenen Raumsituationen und Desorientierungserfahrung sowie der RäumlichkeitRäumlichkeit des Redetextes weist Nicht Ich in besonderer Weise auf Formen der VerhandlungVerhandlung von Raum und DesorientierungDesorientierung in den zu untersuchenden Gegenwartsdramaturgien vor.
Auch wenn Il n’y a plus de firmament und Les aveugles zwar Raum und DesorientierungDesorientierung verhandeln und in Aspekten der Raumkonstruktion und räumlichen AnordnungAnordnung wichtige Bezugstexte bilden, täuschen sie nicht darüber hinweg, dass der Raum in den avantgardistischen Theaterstücken tendenziell szenisch entworfen und die Auseinandersetzung der Figur mit dem Raum betont gestisch geschieht und insofern vor allem in der Bühnenanweisung gelagert ist, wie insbesondere die Theatertexte von GenetGenet, Jean und BeckettBeckett, Samuel zeigen.
3.2Methodik zur Analyse zeitgenössischer Raumdramaturgien
Gemäß der Forschungsfrage nach den Verhältnissen von Figur, Raum und Orientierung sowie bedingt durch die Entdramatisierungs- und Redramatisierungsverfahren sind die dramatischen Elemente weiterhin zur Analyse heranzuziehen, jedoch nicht mehr in ihrer klassischen Bedeutung. Im Folgenden werden konzeptuelle Begriffserweiterungen vorgeschlagen, die der vielfältigen Gegenwartsdramatik standhalten. Neben einem veränderten Handlungsbegriff (s. Ende Kapitel 2.4.) sind drei weitere relevante Analyseelemente neu zu bestimmen: Raum, Situation und Dramaturgie.
3.2.1Raum
Der Raumbegriff in der Dramen- (und Theateranalyse) ist uneinheitlich und plural, bezeichnet zudem verschiedene, schwer trennbare Ebenen. Zunächst liegt jeder (europäischen) Dramatik zumindest implizit ein auf die jeweils epochal geltende Aufführungspraxis bezogenes Theaterdispositiv zugrunde, das die Sicht-, Licht- und Abstandsverhältnisse zwischen Spieler_innen und Publikum regelt. Der szenische Raum und der Zuschauerraum bilden zusammen den Theaterraum – dieses Grundprinzip gilt für eine Guckkastenbühne und ebenso für Performance-Anordnungen ohne vierte Wand außerhalb von Theaterhäusern. Deutlich und explizit im Theatertext angelegt ist der Schauplatz als Ort des Geschehens und Figurenumgebung. Er wird in der Regel in der Bühnenanweisung genannt oder quasi bühnenbildnerisch als Entwurf beschrieben. Schwieriger greifbar, jedoch ebenfalls dem Text zu entnehmen ist der dramatische Raum, der, analog zum raumsoziologischen Verständnis vom gemachten Raum, nicht gegeben ist, sondern sich erst durch menschliches Handeln herausbildet.1 Verfahren solcher „aktionalen Raumkonstituierung“ lassen sich auffächern in: Erstens Formen der proxemische RaumerzeugungRaumerzeugung