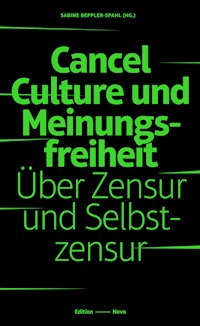11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Novo Argumente Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sind unsere Wahlkämpfe kontrovers genug? Behandeln sie Themen, die die Bürger wirklich interessieren und bewegen? Wohl kaum, denn sonst wäre – nur wenige Wochen vor der Bundestagswahl – die Zahl der Unentschlossenen nicht so hoch. Fast scheint es, als wollten die etablierten Parteien möglichst viele kontroverse Themen lieber gar nicht erst ansprechen. Dabei wissen die Parteiführungen genau, dass sich viele Wähler eine andere Politik wünschen. Doch sie wehren sich gegen den Druck ‚von unten‘: Den Bürgern keinesfalls zu viel Entscheidungsbefugnis einzuräumen, scheint ihr Motto zu sein. Ist es da ein Wunder, dass immer weniger Menschen noch große Hoffnungen auf die Bundestagswahl setzen? Die Beiträge in diesem Band beschäftigen sich mit der Krise der Parteienpolitik. Die Autoren gehören einem breiten Spektrum von konservativ bis links an. Sie eint der Wunsch, zu einer Politik zurückzukehren, die für die Bürger und nicht gegen sie gemacht wird. Mit Beiträgen von: Sabine Beppler-Spahl; Danie Ben-Amil; Wolfgang Kaiser; Christoph Lövenich; Dirk Neubauer (Interview); Jörg Michael Neubert; Kai Rogusch; Bernd Schoepe; Thilo Spahl; Andreas Wehr und Kolja Zydatiss
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Sabine Beppler-Spahl (Hg.)
Raus aus der Mitte!
Wie der Parteienkonsensunsere Demokratie untergräbt
Sind unsere Wahlkämpfe kontrovers genug? Behandeln sie Themen, die die Bürger wirklich interessieren und bewegen? Wohl kaum, denn sonst wäre – nur wenige Wochen vor der Bundestagswahl – die Zahl der Unentschlossenen nicht so hoch. Fast scheint es, als wollten die etablierten Parteien möglichst viele kontroverse Themen lieber gar nicht erst ansprechen.
Dabei wissen die Parteiführungen genau, dass sich viele Wähler eine andere Politik wünschen. Doch sie wehren sich gegen den Druck ‚von unten‘: Den Bürgern keinesfalls zu viel Entscheidungsbefugnis einzuräumen, scheint ihr Motto zu sein. Ist es da ein Wunder, dass immer weniger Menschen noch große Hoffnungen auf die Bundestagswahl setzen?
Die Beiträge in diesem Band beschäftigen sich mit der Krise der Parteienpolitik. Die Autoren gehören einem breiten Spektrum von konservativ bis links an. Sie eint der Wunsch, zu einer Politik zurückzukehren, die für die Bürger und nicht gegen sie gemacht wird.
ePub-Ausgabe ISBN 978-3-944610-87-0 Taschenbuch ISBN: 978-3-944610-85-6 1. Auflage 2021 / Novo Band 135 © Novo Argumente Verlag, Frankfurt 2021 Brönnerstr. 17, 60313 Frankfurtwww.novo-argumente.com Alle Rechte vorbehalten. Covergestaltung: www.elenareiniger.de Gestaltung und Satz E-Book: Erik Lindhorst
Inhalt
Sabine Beppler-Spahl
Einleitung
Autorenübersicht
1.Parteien in derKrise
Kai Rogusch
Verfassungsschutz alsDemokratieersatz
Sabine Beppler-Spahl
Das langsame Sterbender SPD
Andreas Wehr
Die Post-Wagenknecht-Linke
Jörg Michael Neubert
Die Grünen und das Risiko
Thilo Spahl
Klimarepublik Deutschland
2.Alternativen fürDeutschland?
Christoph Lövenich
Die Corona-APO
Wolfgang Kaiser
Plädoyer für einenbürgerlich-freiheitlichenAufbruch
Interview mit Dirk Neubauer
„Politik istkein Lieferservice“
Kolja Zydatiss
Radikaler Traditionalismus
3.Weiteres
Daniel Ben-Ami
Der Lockdown und dieEinsamkeit
Bernd Schoepe
Die Schuldigitalisierung undihre leeren Signifikanten
Sabine Beppler-Spahl
Einleitung
Sind unsere Wahlkämpfe kontrovers genug? Behandeln sie Themen, die die Bürger interessieren und bewegen? Die Antwort lautet ganz offensichtlich: Nein. Das zeigt sich bereits an der hohen Zahl der noch immer Unentschlossenen und der zu erwartenden niedrigen Wahlbeteiligung. Nur der allergrößte Optimist dürfte davon ausgehen, dass sie im September deutlich über 70 Prozent liegen wird. Von Werten über 80 Prozent, wie wir sie in den Jahren von 1953 bis 1983 noch regelmäßig hatten – bei der Bundestagswahl 1972 lag sie sogar bei über 91 Prozent –, sind wir weit entfernt.
Natürlich sehen viele unserer Politiker und Journalisten die Schuld dafür allein bei dem Wahlvolk. Einen Eindruck davon, wie manche denken, lieferte der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz. [1] Vor der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt und mit Blick auf die zu erwartende Zahl der AfD-Wähler sagte er, man habe es mit diktatursozialisierten Menschen zu tun, die auch nach 30 Jahren nicht in der Demokratie angekommen seien. Man könne, fügte er hinzu, nur auf die nächste Generation hoffen. Zwar wurde Wanderwitz für seine herabsetzenden Äußerungen kritisiert. Doch selbst diese Kritik war so formuliert, dass sie ihn eher zu bestätigen als zu widerlegen schien. So z.B., wenn gesagt wurde, es sei falsch, mit dem Finger auf den Osten zu zeigen, da die AfD ja auch im Westen gewählt werde.
Was diese Wahl uns lehrt, ist, dass wir dringend eine Öffnung der Debatte brauchen – und zwar eine, die die Bürger ernst nimmt und sie nicht wie Kinder behandelt und ausschimpft, wenn sie etwas Falsches tun. Tatsächlich fand ein Wahlkampf statt, der fast ausschließlich auf eine Frage zugespitzt worden war: Bist du für oder gegen die AfD? Diese Zuspitzung betrieben auch die Parteien, die eigentlich eine Opposition zur CDU hätten darstellen sollen. Deswegen konnten sogar die größten Verlierer – die Linke und die SPD – sich am Ende immer noch damit trösten, dass wenigstens die AfD nicht gewonnen habe. Eine solch eindimensionale Politik drängt die Wähler in ideologische Lager und lenkt von den wichtigen Themen ab. So wurden z.B. die Arbeitslosigkeit und die hohe Unterbeschäftigungsrate in Sachsen-Anhalt viel zu wenig thematisiert. Wie gering die Begeisterung für die Wahl war, zeigte sich auch hier an der hohen Zahl der Nichtwähler, die mit 40 Prozent das Ergebnis des Wahlsiegers (CDU) deutlich übertraf.
Ein Blick in die Vergangenheit ergibt, dass die Wahlbeteiligung immer dann hoch ist, wenn es zu echten Kontroversen zwischen den Parteien kommt. Gemeint sind damit Themen, die die Zukunft betreffen – und nicht die kleinkarierten Streitigkeiten, wie wir sie z.B. zwischen Arbeitsminister Hubertus Heil und Gesundheitsminister Jens Spahn um die Verteilung von überschüssigen oder aussortierten Corona-Schutzmasken erlebten. Das große Aufheben, das um dieses Thema gemacht wurde, verdeutlicht, wie wenig echte Kontroversen es in unserer Parteienlandschaft gibt.
Natürlich wollen sich die Parteien im Wahlkampf von ihren Konkurrenten abgrenzen. Doch die Unterschiede bestehen oft nur in kleinsten Nuancen. Wer sich bei der bevorstehenden Wahl im Bereich des etablierten Konsenses bewegt, wird genügend Parteien zur Auswahl finden. Das Problem entsteht für diejenigen, die grundsätzlich andere Schwerpunkte bevorzugen würden. So zeigen Umfragen, dass nur 28 Prozent der Bundesbürger den Klimaschutz als wichtigstes oder zweitwichtigstes Thema ansehen. [2] Doch wo ist die Partei, die Investitionen in die Infrastruktur für wichtiger hält als Klimaschutzverordnungen? Suchen müssen auch diejenigen, die die Energiewende für falsch halten. Laut einer Forsa-Umfrage vom letzten Jahr sind immerhin 37 Prozent (im Osten sogar 48 Prozent) der Bundesbürger der Meinung, dass es keinen Ausstieg aus der Atomkraft geben sollte. [3] Ähnlich sieht es aus, wenn es um die Migration geht. Wie viele Wähler würden wohl einem Konzept, wie es die dänischen Sozialdemokraten vertreten und das auf Begrenzung und Integration setzt, zustimmen? Doch eine Partei, die ein solches Konzept vertritt, gibt es nicht. Ebenso wenig wie eine, die im Herbst letzten Jahres entschlossen und mit klaren Argumenten die Corona-Politik der Regierung herausgefordert hätte – oder eine, die sich jetzt gegen das Euro-Hilfspaket wendet. Gewiss hat die AfD manche dieser Themen aufgegriffen, weil sie sich schon lange als die einzige Oppositionspartei versteht. Doch, wer nicht gleichzeitig den ganzen Rattenschwanz der völkischen AfD-Ideologie und ihren unerträglichen Geschichtsrevisionismus mitwählen möchte, ist politisch heimatlos. Ist es da verwunderlich, wenn so viele Bürger keine Lust mehr haben, an Wahlen teilzunehmen?
Dabei ist es keineswegs so, dass die Parteiführungen nicht wüssten, dass sich viele Wähler eine andere Politik wünschen. Doch sie wehren sich gegen zu viel Druck „von unten“. Dass sie damit einen Großteil ihrer früheren Wähler verstoßen, nehmen sie in Kauf. Stattdessen sehen sie sich in der Rolle der Erzieher: Die Menschen sollen dazu gebracht werden, die Politik, die die Führung für richtig hält, gut zu finden. Statt sich dem politischen Wettbewerb zu stellen, soll dieser möglichst klein gehalten werden. Und wer aus Protest die AfD wählt, wird verteufelt und weiter ausgestoßen. Besonders deutlich wird dies bei der SPD oder den Linken, die zu allem Überfluss auch noch eine Identitätspolitik verfolgen – obwohl auch hier Umfragen zeigen, dass eine sehr große Mehrheit der Deutschen wenig davon hält. [4] Störrische Parteimitglieder, die auf eine andere Politik pochen, werden kritisiert, isoliert oder sollen sogar ausgeschlossen werden, wie man beispielhaft an Sahra Wagenknecht, Boris Palmer, Wolfgang Thierse und vielen anderen sehen kann.
In einer Demokratie sind es die Wähler, die über die Politik entscheiden. Doch wenn ihnen echte Alternativen versagt bleiben, funktioniert auch die Demokratie nicht mehr richtig. Mit den unterschiedlichen Facetten dieser Problematik beschäftigen sich die Beiträge in diesem Novo-Band zur Bundestagswahl. Wer eine klare politische Richtung sucht, wird enttäuscht werden. Die Autoren gehören einem breiten Spektrum von konservativ bis links an. Sie eint der Wunsch, zu einer Politik zurückzukehren, die für die Bürger gemacht wird, statt sie in eine bestimmte Richtung zwingen zu wollen.
1Timo Steppat: „Ostbeauftragter über AfD Wähler: Nach dreißig Jahren nicht in der Demokratie angekommen“, F.A.Z. online, 28.05.2021.
2„ARD-Deutschland Trend: Baerbock und Grüne stürzen ab“, Bayerischer Rundfunk online, 10.06.2021.
3Thomas Sigmund: „Eine bezahlbare Energieversorgung hat für die meisten Deutschen Priorität“, Handelsblatt online, 19.01.2020.
4„Nur 14 % geben klares ‚Ja‘ zu gendergerechter Sprache“, dpa, 26.02.2021.
1.PARTEIENIN DER KRISE
Kai Rogusch
Verfassungsschutz alsDemokratieersatz
Anhand der Diskussion über die Beobachtung der AfD wird die zunehmend militante Demokratiefeindlichkeit der politischen „Mitte“ erkennbar. Sie will ihre populistische Konkurrenz aus dem Weg räumen
Die AfD, die aus der letzten Bundestagwahl als stärkste Oppositionspartei hervorging, fordert die etablierten Parteien seit ihrer Gründung auf der Grundlage eines breiten Themenspektrums heraus: Sie zweifelt die wissenschaftlichen Grundlagen der Klimapolitik an. Sie verlangt eine Neubewertung der Europapolitik, indem sie gar die Möglichkeit eines Austritts Deutschlands aus der EU („Dexit“) ins Spiel bringt. Sie regt zudem die Überprüfung der geopolitischen Ausrichtung Deutschlands mit besonderem Augenmerk auf eine russlandfreundlichere Politik an. Sie fordert eine Rückbesinnung auf das Prinzip der „nationalen Souveränität“. Man kann von der Partei halten, was man will. Fakt ist jedenfalls: Kaum eine heilige Kuh der kulturell, medial und politisch Etablierten in der Bundesrepublik Deutschland bleibt von der AfD verschont.
Das ruft gereizte Reaktionen bei den Hütern der postnationalen „Errungenschaften“ des modernen Deutschlands hervor. Sie scheinen angesichts der Verwerfungen, die unser international und supranational organisiertes System in Form von Flüchtlingskrisen, Finanzkrisen, Eurokrisen und mittlerweile als pandemische Notfälle ausgerufenen Gesundheitskrisen belasten, mit ihrem Latein am Ende zu sein. Angesichts populistischer Herausforderungen gehen die Eliten vor diesem Hintergrund nicht nur in Deutschland dazu über, ihr in den letzten Jahrzehnten aufgebautes politisches Vermächtnis von aus ihrer Sicht unaufgeklärten und rückständigen politischen Strömungen abzuschirmen. So wollen sie ein angeblich wissenschaftsbasiertes, weltoffenes, multikulturelles und globalisiertes Gefüge weltwirtschaftlicher Beziehungen und entsprechender Institutionen schützen.
Dass eine Partei wie die AfD gerade im globalistischen Vorzeigestaat Deutschland aufgrund der sich unübersehbar aufstauenden Probleme den Finger in die Wunde legt (ohne selbstredend gleich zukunftsweisende Lösungen mitzuliefern), sorgt bei der politischen Klasse für eine Wagenburgmentalität: Sie antwortet mit starrer Abschottung bis hin zu aggressiver Ausgrenzung des politischen Gegners. Die politische „Mitte“ unserer Tage führt immer drakonischere Geschütze gegen ihre Gegner auf: Die „wehrhafte Demokratie“ soll das politische Vermächtnis des heutigen Deutschlands schützen, indem sie dieses verfassungsgerichtlich zementiert und der demokratischen Entscheidungsfindung entzieht. Dabei schreckt man auch nicht davor zurück, populistische Herausforderer im Parteienspektrum geheimdienstlich zu beobachten und schließlich am liebsten durch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) verbieten zu wollen.
Mögliches AfD-Verbot
Die Praxis, die AfD durch die Landesämter und das Bundesamt für Verfassungsschutz zu beobachten, könnte tatsächlich in ein Verbot der AfD münden. Ein solches Verbot erscheint jedenfalls in der im letzten NPD-Verfahren entwickelten Vorratsjudikatur [1] des Bundesverfassungsgerichts begründet, weil sich die AfD – anders als die NPD – als eine politisch relevante Partei in unserer Gesellschaft verankert hat. So wird nun auch das freiheitsgefährdende Potenzial der angeblich „freiheitlich-demokratischen Grundordnung“ des Grundgesetzes erkennbar.
Die „wehrhafte Demokratie“ tritt nicht zuletzt durch die Bundes- und Landesämter für Verfassungsschutz in Aktion. Dabei wirken die Inlandsgeheimdienste ausgerechnet mit jenem Bundesverfassungsgericht zusammen, das in Deutschland zwar einmal eine durchaus freiheitssichernde Rolle spielte, mittlerweile aber selber zu einem Problem geworden ist. In dem BVerfG-Urteil im NPD-Verbotsverfahren vom 17. Januar 2017 wurde zwar erneut der Antrag abgewiesen, die NPD zu verbieten. Liest man dieses Urteil jedoch genauer, so erkennt man, dass Maßstäbe entwickelt worden sind, nach denen politische Parteien, die als „verfassungsfeindlich“ deklariert werden und sich gegen die „freiheitlich-demokratische Grundordnung“ richten, durchaus verboten werden können. Und zwar dann, wenn ihre politischen Erfolgsaussichten anders als bei der NPD nicht von vornherein aussichtslos erscheinen. Das führt dazu, dass zumindest der als „völkisch“ und rechtsextremistisch eingestufte, offiziell zwar aufgelöste, aber informell vermutlich nach wie vor wirkende „Flügel“ der AfD, dem man beachtlichen innerparteilichen Einfluss beimisst, in die Verbotszone der BVerfG-Judikatur gerät.
Den wenigsten ist der folgende Umstand bewusst: Durch die Festschreibung der „wehrhaften Demokratie“ im Grundgesetz wurde ein Zustand geschaffen, in dem an sich legal agierende Oppositionsparteien ins politische, gesellschaftliche und rechtliche Abseits gedrängt werden können. Konkreter: Oppositionsparteien, die eigentlich im rechtlich garantierten Schutzbereich der Meinungs- und Versammlungsfreiheit agieren, erleiden nun doch Nachteile. Schauen wir uns beispielsweise den vielfach erwähnten Thüringer Landesverband um Björn Höcke an, den das dortige Landesamt für Verfassungsschutz als „gesichert extremistisch“ einstuft. Einem einflussreichen Teil der in der thüringischen AfD Aktiven sollen mitunter radikale Maßnahmen vorschweben: Sie wollen anscheinend eine ethnische und kulturelle Homogenität des deutschen Volkes (wieder)herstellen. Eine Politik, die dieses „völkische“ Verständnis demokratischer Staatsbürgerschaft in die Tat umsetze, greife die Menschenwürde von Minderheiten an – und somit ein zentrales Prinzip unseres Grundgesetzes, wird argumentiert. [2]
Das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz stufte den dortigen Landesverband mithin im Januar 2019 als einen „Verdachtsfall“ und schließlich im März 2020 als einen „Beobachtungsfall“ ein. Er kann ihn also seit über zwei Jahren durch ein Spektrum an geheimdienstlichen Mitteln beobachten und ausforschen. Das ist für die AfD-Aktiven nicht gerade angenehm. Durch die Anwerbung sogenannter V-Leute kann in der Partei ein Zustand geschaffen werden, in dem immer weniger sicher erscheint, welchem Parteimitglied man überhaupt trauen kann. Erschwerend kommt hinzu, dass durch den Staat eingeschleuste Agenten die Partei in die eine oder andere Richtung beeinflussen können. Außerdem gibt es die Möglichkeit, die interne Kommunikation von Parteimitgliedern auf der Grundlage eines Beschlusses der G-10-Kommission, eines abgeschottet tagenden vierköpfigen parlamentarischen Gremiums, zu überwachen.
Um es klar zu sagen: Hier werden an sich legal agierende politische Oppositionelle geheimdienstlich ins Visier genommen und ins gesellschaftliche Abseits gedrängt. Das fördert den bereits vorhandenen Trend, wonach sich unsere Gesellschaft nicht nur wirtschaftlich und kulturell aufspaltet, sondern obendrein in Bevölkerungsteile auseinander fällt, die einander verständnislos gegenüberstehen. Die gesellschaftlichen Fronten dürften sich in der Folge immer weiter verhärten. Eine sich immer weiter von einem gesamtgesellschaftlichen Meinungsstreit abschottende „Mitte“ steht einer sich verhärtenden und in Teilen immer weiter ins Konspirative abdriftenden Front politischer Abweichler und Übergangener gegenüber. Schaut man sich die Wahlergebnisse der AfD in einigen Bundesländern an, so muss man zu dem Schluss kommen, dass in ganzen Regionen eine sich dort als normal empfindende Bevölkerung von der herkömmlichen Öffentlichkeit abkoppelt.
Auf diese Weise entsteht eine ängstliche und misstrauische Gesellschaft mit immer weniger gemeinsamen Bezugspunkten. Wenn sich die politischen Wünsche einer wachsenden Zahl von Menschen nicht mehr in der offiziellen Politik widerspiegeln, dürfte dies früher oder später eine weitere Folge haben: Die gesetzten staatlichen Regeln werden immer weniger ernst genommen. Angesichts einer sich daraus ergebenden Normenerosion dürfte im Gegenzug eine schwindende Mehrheit ängstlicher Orientierungsloser nach autoritärem staatlichem Durchgreifen rufen. In diesem Prozess werden dann immer mehr normale Bürger sozusagen zu Staatsfeinden erklärt. Auf diese Weise entsteht ein nervöser, fragiler und zugleich autoritärer Staat, der immer weniger Rückhalt in der Gesellschaft hat. Eine Gesellschaft entsteht, in der sich breite Teile der Bevölkerung nicht nur aus dem politischen Leben ausgeschlossen finden, sondern obendrein fast schon kriminalisiert werden. Und genau das ist am Beispiel der AfD mittlerweile gut zu erkennen. Inzwischen geht es nicht mehr nur um den radikalen „Flügel“. Die Einschätzung nämlich, der „Flügel“ übe einen beträchtlichen, gar maßgeblichen Einfluss auch auf die Bundespartei der AfD aus, wird vermutlich – nach derzeit noch ausstehender verwaltungsgerichtlicher Klärung – auch die im Bundestag vergleichsweise gemäßigt in Erscheinung tretende Bundes-AfD ins Visier des Bundesamtes für Verfassungsschutz rücken – dann als sogenannten Verdachtsfall.
Staatsgefährdung durch diepolitische Klasse
Somit gerät die – nach derzeit im Bundestag abgebildeten parlamentarischen Mehrheitsverhältnissen – größte Oppositionspartei in Deutschland auf Betreiben der Bundesregierung (deren Innenminister die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz innehat) in eine Situation, in der der politische Wettbewerb erheblich verzerrt wird. Der politische Gegner wird durch anprangernde Verfassungsschutzberichte und damit einhergehende mediale Berichterstattung geächtet. Staatliche Ausforschung (und mögliche arbeitsrechtliche Konsequenzen zumindest im öffentlichen Dienst) machen das Leben für bekennende AfD-Mitglieder schwer. Der freie politische Willensbildungsprozess wird durch Tabuisierung politischer Inhalte beschnitten: Denn jede an sich noch so unterstützenswerte – oder zumindest vertretbare – politische Initiative oder Idee, die in irgendeiner Form den Verdacht auf sich zieht, AfD-nah zu sein, wird lieber verschwiegen. So verselbstständigen sich gesellschaftliche Fehlentwicklungen, weil die üblichen demokratischen Korrekturmechanismen fehlen.
Man wendet zwar gerne ein, dass eine Partei, die sich nicht von vermutlich menschenverachtendem Gedankengut eines erheblichen Teils ihrer Mitglieder glaubhaft distanzieren könne, ihre Existenzberechtigung im demokratischen Diskurs verwirkt habe. Doch diese Sichtweise entspringt einem oberflächlichen Verständnis der gegenwärtigen Phänomene identitärer Gruppen im rechten Spektrum. In der AfD wirken Kräfte, die sich auf traditionelle Werte, auf Familie, auf herkömmliche Geschlechtsbilder und auf die Vorstellung kulturell homogener Nationalstaaten berufen. Manchen dieser Leute scheint gar tatsächlich vorzuschweben, den Untergang Deutschlands beispielsweise durch brutale „Remigrationsmaßnahmen“ (in Form inhumaner Abschiebungen und Umsiedlungen) im Falle eines noch in der ferneren Zukunft liegenden politischen Erfolges abzuwenden.
Bei diesen Bestrebungen innerhalb der AfD handelt es sich allerdings um eine reaktionäre Antwort auf den bereits vollzogenen Abbau demokratischer Souveränität durch die herrschende Politik – und auf die von ihr mutwillig oder fahrlässig herbeigeführte Auflösung eines gesellschaftlichen Gemeinwesens. Die Politik hat in den letzten Jahren Grundelemente einer freiheitlichen und demokratischen Verfassung bereits geschliffen und demontiert. So wurden beispielsweise nach den Worten des mittlerweile verstorbenen ehemaligen Bundespräsidenten und Verfassungsrichters Roman Herzog bereits „zentnerweise“ Souveränitätsrechte auf die Europäische Union übertragen. Durch diesen schleichenden Prozess wurde das Prinzip, dass alle Macht vom Volk ausgeht, zugunsten einer – die persönliche Autonomie der Bürger mitunter sehr kleinteilig einschnürenden – Herrschaft von nationalen Spitzenpolitikern, internationalen Bürokraten, handverlesenen Experten und Zentralbankern durchlöchert. Das unterscheidet die etablierte Politik von der AfD, der bislang lediglich das Potenzial beigemessen wird, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beseitigen oder auch nur zu beeinträchtigen.
Die Entwicklung hin zu einem defensiven, autoritären und zensorischen Gebaren großer Teile der politischen Klasse ist mittlerweile so weit gediehen, dass selbst eher biedere, bürgerliche und professionelle Kritik als gefährlich angesehen wird. Wer bestimmte politische Entscheidungen wie etwa die diskussionsbedürftigen Corona-Maßnahmen in Frage stellt, zieht heute den Vorwurf auf sich, die ‚Saat des Zweifels‘ gegenüber den etablierten demokratischen Institutionen zu streuen. Entsprechend nimmt der Verfassungsschutz jetzt auch die Querdenker-Bewegung ins Visier und wirft ihr eine „Delegitimierung des Staates“ vor.