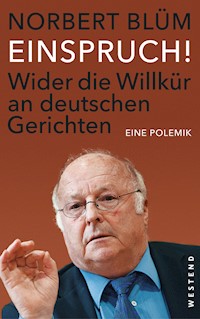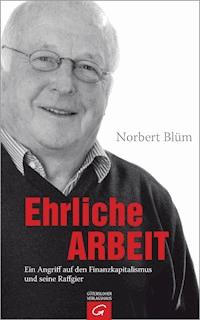10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Rowohlt Repertoire
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
«Wenn die Union gesellschaftspolitische Probleme nur noch im Blick auf den Wahltag unter taktischen Aspekten behandeln will, können wir gleich Demokratie durch Demoskopie ersetzen.» Mit diesem Satz deutete Norbert Blüm die kritische Position seiner Organisation, der Sozialausschüsse, gegenüber der Mutterorganisation. Mehr und mehr machte sich bei den engagierten, der CDU nahestehenden Arbeitnehmern Verbitterung darüber breit, daß die Partei sie als Stimmenfänger in Wahlkämpfe schickte, ihre grundsätzlichen Forderungen aber von Parteitag zu Parteitag immer wieder abschmetterte. Schon in ihrer «Offenburger Erklärung» des Jahres 1967 beriefen sich die Sozialausschüsse auf die Gründungsgeschichte der CDU, deren starke gesellschaftspolitische Komponente in den fünfziger und sechziger Jahren zurückgedrängt wurde. Norbert Blüm zieht für seine erstmals 1972 erschienene Deutung der damals aktuellen gesellschaftlichen Krisen, die der linke Katholik auch als moralische Krise empfand, das Ahlener Programm der CDU aus dem Jahre 1947 heran. Er schreibt, unter Anlehnung an die radikalen Katholiken Lateinamerikas, der katholisch-sozialen Bewegung eine Schlüsselrolle bei dem Kampf um Reformen zu: «Die katholisch-soziale Bewegung wird nur überleben, wenn sie sich als eine radikale Kraft versteht, und zwar in dem Sinne, daß sie bereit ist, Probleme an der Wurzel zu packen.»
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 234
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
rowohlt repertoire macht Bücher wieder zugänglich, die bislang vergriffen waren.
Freuen Sie sich auf besondere Entdeckungen und das Wiedersehen mit Lieblingsbüchern. Rechtschreibung und Redaktionsstand dieses E-Books entsprechen einer früher lieferbaren Ausgabe.
Alle rowohlt repertoire Titel finden Sie auf www.rowohlt.de/repertoire
Norbert Blüm
Reaktion oder Reform
Wohin geht die CDU?
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Wenn die Union gesellschaftspolitische Probleme nur noch im Blick auf den Wahltag unter taktischen Aspekten behandeln will, können wir gleich Demokratie durch Demoskopie ersetzen.» Mit diesem Satz deutete Norbert Blüm die kritische Position seiner Organisation, der Sozialausschüsse, gegenüber der Mutterorganisation. Mehr und mehr machte sich bei den engagierten, der CDU nahestehenden Arbeitnehmern Verbitterung darüber breit, daß die Partei sie als Stimmenfänger in Wahlkämpfe schickte, ihre grundsätzlichen Forderungen aber von Parteitag zu Parteitag immer wieder abschmetterte. Schon in ihrer «Offenburger Erklärung» des Jahres 1967 beriefen sich die Sozialausschüsse auf die Gründungsgeschichte der CDU, deren starke gesellschaftspolitische Komponente in den fünfziger und sechziger Jahren zurückgedrängt wurde. Norbert Blüm zieht für seine erstmals 1972 erschienene Deutung der damals aktuellen gesellschaftlichen Krisen, die der linke Katholik auch als moralische Krise empfand, das Ahlener Programm der CDU aus dem Jahre 1947 heran. Die Krise der Gesellschaft ist für ihn Teil der globalen Krise der Menschheit zwischen Wohlstand in der reichen und Elend in der armen Dritten Welt. Er schreibt, unter Anlehnung an die radikalen Katholiken Lateinamerikas, der katholisch-sozialen Bewegung eine Schlüsselrolle bei dem Kampf um Reformen zu: «Die katholisch-soziale Bewegung wird nur überleben, wenn sie sich als eine radikale Kraft versteht, und zwar in dem Sinne, daß sie bereit ist, Probleme an der Wurzel zu packen.»
Über Norbert Blüm
Norbert Blüm ist gelernter Werkzeugmacher. Nach dem Abendgymnasium studierte er Philosophie, Theologie und Germanistik. Er bekleidete zahlreiche politische Ämter. Von 1982 bis 1998 war er Bundesminister für Arbeit und Sozialordnung, zwischen 1981 und 2001 auch stellvertretender Bundesvorsitzender der CDU. Als Vorsitzender der Stiftung Kinderhilfe hat er zahlreiche Länder der Welt besucht. Er ist Mitglied der IG Metall, von Amnesty International und der Kolpingfamilie und Autor zahlreicher Bücher.
Inhaltsübersicht
Einleitung Polarisation oder Das Karussell der Gegensätze
Die nächste Bundestagswahl wirft ihre Schatten voraus. Die Heere sammeln sich. Und aus dem unheilschwangeren Geraune der zuständigen Parteioberen läßt sich auf ein Kräftemessen von gleichsam mythischem Ausmaß schließen.
Das Abendland ist wieder einmal in Gefahr. Die sozialdemokratische Regierungsübernahme 1969 läßt sich ja notfalls noch als ein historisches Versehen oder – für Beobachter mit weniger geschichtsträchtigen Ambitionen – als ein bundesrepublikanischer Betriebsunfall erklären. Denn immerhin: der Wahlsieg war auch vor drei Jahren, wie viermal zuvor, der CDU zugefallen; nur mit der Regierungsbildung hatte es nicht geklappt. Mancher Unionsfreund empfand das damals (wie heute) als eine Art Diebstahl.
Aber jetzt geht es ums Ganze: Sein oder Nichtsein.
Adenauer, nicht pingelig in großen Kampfansagen, hätte dies freilich mit weniger metaphysischem Pathos vorgetragen. Rheinische Naivität – ein Stück politischer Menschlichkeit – hätte ihm wahrscheinlich die Wiederholung seines klassischen Satzes angeraten sein lassen: „Die Lage war noch nie so ernst!“
Während auf der „Christenseite“ der altersschwere Weltschmerz („Die Zukunft ist schwarz“) antreibt, sind die „Sozialisten“ von pubertärer Kraftmeierei („Die Welt wird rosig“) geplagt und gereizt zum politischen „Alles oder Nichts“, was ja auch nichts anderes ist, als die Volksausgabe von „Sein oder Nichtsein“.
Was in den vier Jahren nur mickrig zum Vorschein gekommen sein wird, 1973 wollen es die Sozialdemokraten schaffen: Das neue Deutschland.
Wer sich einer solchen „Heilsgewißheit“ in den Weg stellt, und sei es auch nur zweifelnd, ist freilich ein Saboteur. Er verhindert nicht nur die SPD, sondern eine neue Zeitrechnung.
Das politische Personal ist aufgeteilt wie im Märchen. Auf der einen Seite Hexen und Teufel und ihr Pack, auf der anderen Feen, Engel und die himmlischen Heerscharen. Das Spiel kann beginnen. Gestritten wird nur noch darum, wer die Hexen und wer die Teufel darstellt. Am besten: Die Bösen, das sind jeweils die anderen. Ein Spiel für politische Kleinkinder!
Unbestreitbar stehen die politischen Zeichen auf Konfrontation: Auf das regierungsamtliche Ja folgt das oppositionelle Nein, und auf das CDU-Ja folgt das vereinigte SPD/FDP-Nein, so sicher wie das Amen in der Kirche. Die politische Öffentlichkeit wird an ein Kontrastprogramm gewöhnt, in dem es außer Schwarz und Weiß keine Zwischentöne mehr gibt, obwohl es noch immer außerhalb des spektakulären Ja/Nein–Nein/Ja-Spiels Übereinstimmung gibt.
All das, was den parteipolitischen Profilierungssehnsüchten entspricht, schafft dennoch, und zwar entgegen der Logik der Erfinder, Abhängigkeiten. Niemand ist mehr selbständig. Jeder schreibt jedem vor, was er machen soll, nämlich genau das Gegenteil des anderen.
Was als Kampf angelegt war, endet als politisches Kinderkarussell. Die politischen Parteien setzen auf ihr Pferd, und das steht genau gegenüber dem des Gegners. Was auch immer sich ändert; die Gegensätze drehen sich im Kreise.
Die Demokratie kann den Konflikt nicht entbehren. Doch gibt es meist, fast immer, mehr als zwei mögliche Standpunkte. Das politische Alphabet besteht nicht nur aus zwei Buchstaben, so daß es mehr Lösungen gibt als nur Lösung A oder Lösung B.
Zwischen A und B gibt es in sehr vielen Fällen noch ein Drittes. Der Satz vom ausgeschlossenen Dritten scheint also jedoch in der Politik nicht zu gelten.
Die Parteidemokratie ist, anders als die Volksdemokratie östlicher Provenienz, auf das Gegeneinander angelegt. Wir müssen mit verschiedenen Parteien leben. Und dies nicht deshalb, weil es keiner von ihnen gelungen ist, die anderen aus dem Feld zu schlagen, sondern weil es unsere Überzeugung ist, daß niemand politische Lösungen perfekt und total anbieten kann. Jede Partei kann nur ihren Teil beitragen, denn Parteien sind Teile und nicht das Ganze. Der Konflikt ist deshalb die ständige Begleiterscheinung der Demokratie, so wie wir sie verstehen.
Wenn jedoch das Gegeneinander der Parteien nicht mehr vom Miteinander um die bessere Lösung getragen wird und aus dem Konflikt die totale Konfrontation entsteht, haben wir das, was man in letzter Zeit die Polarisation zu nennen pflegt. Die Parteien stoßen sich voneinander ab. Reaktionäre und Progressisten und solche, die für diese gehalten werden oder dafür gehalten werden wollen, schlagen aufeinander ein. Alles sammelt sich um die Pole. Die Mitte wird leer. Und gerade in der Mitte wollte die CDU Platz nehmen, jedenfalls nach dem Willen ihrer Gründer. Auch heute bedauern nicht wenige CDU-Politiker die Polarisation.
Zur Polarisation gehören allerdings immer zwei. Es ist relativ uninteressant, wer sie erfunden hat. Wichtig ist, wer mitspielt. Es ist nicht von der Hand zu weisen, daß es ins Wehnersche Spiel paßt, die CDU zu einer Nein-Sager-Opposition zu reizen. Schließlich weiß er aus eigener Erfahrung, wo diese Art von Opposition landet.
Am Beispiel der Ostpolitik läßt sich trefflich nachweisen, wie die regierungsamtlichen Enthusiasten ebenso wie die oppositionellen Hysteriker alle Bedingungen der Polarisation erfüllen. Hysterie und Enthusiasmus haben eines gemeinsam: Sie kommen ohne Verstand aus. Das ist die wichtigste Bedingung der Polarisation.
Polarisation lebt von einfachen Formeln. Was nicht in Formeln paßt, ist nicht vorhanden. Insofern wirkt sie als Informationssperre. Sie isoliert die ins Schema der Vorurteile gepreßten Politiker von den differenzierten Erwartungen der Bürger. Aus dem politischen Satzbau müssen schließlich die abwägenden Bindewörter „zwar … aber“, „sowohl … als auch“, „einerseits … andererseits“ gestrichen werden; nur noch das klare „entweder … oder“ ist erlaubt. Diese Art von Politik ist einfach. Sie hat nur einen Fehler: sie paßt nicht auf komplexe Probleme. Leider aber sind unsere politischen Aufgaben nicht einfach, sondern komplex. Wer von Zusammenhängen absieht und die Einzelteile für das Ganze ausgibt, betreibt eine abstrakte Politik, auch wenn er sich noch so handfest gebärdet.
Die Christlich-Demokratische-Union ist nicht unter Profilierungszwängen als Kontrastpartei gegründet worden. Was als Partei der Mitte verstanden wurde, war Ausdruck einer politischen Position, welche die einfachen Losungen der extremen Standpunkte ausschloß und die Lösungen in einer differenzierten Politik suchte, einer Politik, die der Komplexität moderner Gesellschaften entspricht. Ob die CDU diese mittlere Position gehalten hat, muß geprüft werden.
Teil I
1. Christlich-Demokratische Union: … weil Sammlung nichts in die Zukunft Weisendes ist
Die Christlich-Demokratische Union ist keine Sammlungsbewegung; sie will Volkspartei sein, jedenfalls nach dem Willen ihrer Gründer.
„Ich war nicht damit einverstanden, daß man davon sprach, daß die CDU eine politische Sammlungsbewegung sei und wandte mich sehr energisch gegen diese Ansicht und die Verbreitung solcher Äußerungen … Wir mußten eine Partei sein mit einem eigenen neuen Programm. Auf ‚Sammlung‘ als Fundament läßt sich keine Partei aufbauen, weil ‚Sammlung‘ nichts in die Zukunft Weisendes ist.“[1]
Auch wenn Konrad Adenauer nicht zu den unmittelbaren Initiatoren der neuen Partei gehörte, auch wenn er zunächst sogar abwartete, welche Kräftekonstellation sich aus „altem“ Zentrum und „neuer“ Union ergab,[2] so war er doch bald eine so dominierende Gestalt in der CDU, daß sein Rückblick auch heute noch Gewicht und Beweiskraft hat.
a) Sammlungsbewegung oder Volkspartei?
1945 hieß die tatsächliche Alternative nicht Sammlungsbewegung oder Volkspartei. Eine Sammlungsbewegung wäre die CDU geworden, wenn sie sich als konturloses Konglomerat verstanden hätte, dessen verbindender Halt lediglich ein antisozialistischer Affekt gewesen wäre. Demgegenüber profilierte sich die neue Partei als eine programmatische Integration sozialer Gruppen, die wußten, wofür sie waren: für soziale Neuordnung auf dem Boden der christlichen Soziallehre.
Die CDU ist nicht das Netz für aus dem Nest gefallene Konservative. Die CDU ist 1945 nicht als reaktionäres Sammelsurium entstanden und darf es auch in Zukunft nicht sein. Die Zoglmänner hatten damals keinen Zugang zur CDU und sollten auch weiterhin unter sich bleiben. Nur der Zugang ist eine Verstärkung, der sich mit den politischen Zielen der Union identifiziert.
Wer heute den Versuch unternimmt, die CDU zu einem Sammelbecken aller bürgerlichen Kräfte zu machen, die durch nichts anderes zusammengehalten werden als durch Antisozialismus, weicht von den Intentionen der Gründer ab. Die „Abweichler“ befinden sich nicht auf dem linken Flügel der CDU.
Unter den Bedingungen des Jahres 1945 stellte sich für die christlichen Gewerkschafter die Wahl: Volkspartei oder Arbeitnehmerpartei. Im Widerstand gegen Hitler war die Überzeugung gewachsen, daß eine Arbeitnehmerbewegung, die ihre alten Gegensätze überwunden habe, der Stützpfeiler einer neuen Demokratie sein sollte. Die organisatorische Konsequenz dieser Überzeugung war eine einheitliche Gewerkschaftsbewegung und eine nach englischem Vorbild gebildete Labour Party.[1] Diese Vorstellungen wurden besonders im Kreise der Gewerkschaftsführer diskutiert und vorbereitet.[2]
b) Vier Gründe gegen die „Partei der Arbeit“
Wenn diese Gedanken 1945 dennoch nicht Wirklichkeit geworden sind, so hat dies verschiedene Gründe.
1. Das Scheitern des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944 hatte in die Reihen der Gewerkschaftsführer große Lücken geschlagen. Wilhelm Leuschner, Max Habermann, Bernhard Letterhaus, Männer also, die das Experiment der neuen „Partei der Arbeit“ hätten tragen können, wurden Opfer der Rache Hitlers. Unter den wenigen Überlebenden wuchsen die Zweifel, ob sie trotz dieses Verlustes das Wagnis eingehen könnten.[1]
Die Niederlage des Widerstandes hatte nicht nur einen personellen Verlust zur Folge, sondern auch – durch diesen freilich mitbedingt – einen Ausfall der Ergebnisse jenes geistigen Prozesses, in dem sich die Mitglieder der verschiedenen Widerstandskreise aufeinander zubewegt hatten. Die neuere Parteigeschichte Deutschlands wurde wesentlich von Männern geprägt, deren Gegnerschaft gegen den Faschismus sie entweder zur inneren (z.B. Adenauer) oder zur äußeren Emigration (z.B. Schumacher) gedrängt hatte.[2]
Die Opfer des inneren Widerstandes hinterließen eine Lücke, die von den übrigen Gegnern des Faschismus nicht adäquat ausgefüllt werden konnte. Der hohe demokratische Konsens ehemals zerstrittener Gruppen hätte einer Neuformierung des deutschen Parteiwesens, die nur zum Teil nach 1945 eingetreten ist, mehr Raum gegeben, wenn beispielsweise Männer wie Leuschner, Habermann oder Letterhaus überlebt hätten.
2. Der sozialdemokratische Teil der Arbeitnehmerschaft knüpfte 1945 fast überhastet den politischen Faden dort wieder an, wo er 1933 gerissen war. Zum Teil war diese Eile in der Angst begründet, von Kommunisten unterwandert zu werden, zum anderen waren auch unter der sozialdemokratisch orientierten Arbeitnehmerschaft die marxistischen Fixierungen so stark und ihre antikirchlichen Affekte so tief verwurzelt, daß sie keine Möglichkeit sahen, mit den „Schwarzen“ gemeinsame Sache zu machen. Die sozialdemokratische Alternative hieß deshalb nicht „Partei der Arbeit“ oder SPD, sondern SPD oder SED. (Daß die bundesrepublikanischen Sozialdemokraten sich gegen eine sozialistische Einheitspartei entschieden, ist Kurt Schumachers Verdienst.)
3. Die deutsche Labour Party entstand aber auch deshalb nicht, weil die CDU durch eine radikal-soziale Programmatik jenen Teil der Arbeitnehmerschaft an sich band, der sich der Tradition der Christlichen Gewerkschaftsbewegung verpflichtet fühlte. Die sozialreformerischen Impulse, die für eine Partei der Arbeit freigewesen wären, wurden von der neuentstehenden CDU aufgenommen.
Der Unterschied der CDU zu einer möglichen deutschen Labour Party lag weniger im politischen Zielkatalog als vielmehr in dem Versuch, alle Schichten und Gruppen des Volkes an dem sozialen Neubau partnerschaftlich zu beteiligen. Das politische Profil, mit dem die neue Partei sich von allen bürgerlichen Parteien Weimarer Angedenkens unterschied, zeigte sich bereits bei der Namensgebung. Immerhin standen Bezeichnungen wie „christlich-sozialistisch“ zur Diskussion.[3] Noch der schließlich gefundene Parteiname „CDU“ sollte das Auftreten einer neuen, unverbrauchten Partei signalisieren.
Der Berliner wie der Walberberger Gründerkreis, die als Kristallisationspunkte der neuen Partei wirkten, lehnten jede bürgerliche Kontinuität ihrer Parteigeschichte ab.[4] In beiden Zentren arbeiteten christliche Gewerkschafter an führender Stelle. Jakob Kaiser in Berlin, Johannes Albers – von den Dominikanern Siemer und Welty inspiriert – in Walberberg.
Für die nichtbürgerliche Partei arbeitete nach dem Zusammenbruch eine Zeitströmung, welche die Lösung der verworrenen Lage nicht in der Restauration, sondern in einem Neubau sah. „Es gibt im Staatsleben der gegenwärtigen Stunde überhaupt nicht einfach Wiederaufbau, sondern ein völliger Neubau ist notwendig, und diesen Neubau nennen wir Selbstregierung von unten“[5], erklärte Johannes Albers in seiner ersten großen programmatischen Rede nach dem Kriege, mit der sich die Kölner CDU im Dezember der Öffentlichkeit vorstellte. Der restaurative Terminus Wiederaufbau rückte erst sehr viel später an die Stelle des „Neubaus“.
Nicht nur bei den christlichen Gewerkschaftern, sondern überall da, wo die neue Partei sich artikulierte, war die radikal-soziale Position der bestimmende Charakterzug der neuen Partei. „Neubau“ war allgemein akzeptiertes Ziel, also keineswegs die Privatdomäne der Arbeitnehmerschaft.
Das Ahlener Programm ist nicht ein einmaliger isolierter Ausdruck des Willens, durch den die neue Partei ausgezeichnet wurde. Dieses Programm bildet viel eher eine Summe der bis dahin proklamierten politischen Zielsetzungen der CDU.[6] Wer das Ahlener Programm als einmalige Sozialwallung der jungen CDU abtun will, muß schon Geschichtsklitterung begehen.
In den Kölner Leitsätzen von Juni 1945 heißt es: „Wirtschaft ist die Bedarfsdeckung des Volkes auf der Grundlage einer freien körperschaftlichen Selbstverwaltung. Die Vorherrschaft des Großkapitals, der privaten Monopole und Konzerne wird gebrochen. Privatinitiative und Eigenverantwortlichkeit werden erhalten. Mittel- und Kleinbetriebe werden gefördert und vermehrt.“[7]
Die Leitsätze der Christlich-Demokratischen Partei in Rheinland und Westfalen von September 1945 führen diese Linie weiter. Eingefügt in den Text, der von den Kölner Leitsätzen übernommen worden war, heißt es dort verschärfend: „Grundlage der Wirtschaftstätigkeit ist die soziale Gleichberechtigung aller Schaffenden in Betrieben und öffentlichen Verwaltungen“.[8] Die aus dem gleichen Monat stammenden Frankfurter Leitsätze beweisen, daß ohne Absprache zwischenden verschiedenen Gründerkreisen die gleichen Gedanken und Vorstellungen zum Allgemeingut der Neugründung gehörten: „Wir bekennen uns zu einem wirtschaftlichen Sozialismus auf demokratischer Grundlage.“ Südwürttemberg-Hohenzollern folgte diesen Programmaussagen mit einem Aufruf vom Juni 1946, in dem es unter anderem heißt: „Christlicher Sozialismus ist die Grundlage all unserer wirtschaftlichen Bestrebungen.“
Der Begriff „christlicher Sozialismus“ ist später wegen seiner Anfälligkeit für Mißdeutungen nicht mehr verwandt worden, vielleicht nicht nur der Mißdeutungen wegen, sondern auch, weil jene soziale Pioniergesinnung der Gründer immer mehr schwand. Der Begriff „christlicher Sozialismus“, der vielerorts und lange Zeit bevorzugt wurde, hatte jedenfalls nicht einfach einen Kompromiß zwischen christlicher Sozialbewegung und marxistischer Arbeiterbewegung andeuten sollen. Er war vielmehr wesentlich von den Gemeinwohlvorstellungen der christlichen Soziallehre geprägt.[9]
4. Der Abschied vom Bemühen um eine „Partei der Arbeit“ wurde den Christlichen Gewerkschaften auch dadurch erleichtert, daß in ihren Reihen das Modell der Volkspartei selbst nicht unbekannt gewesen war. Seit Stegerwalds Rede auf dem Kongreß der Christlichen Gewerkschaften in Essen im Jahre 1920 war das Ziel der Volkspartei nie aus derem Gesichtskreis geschwunden. Die Stegerwaldsche Idee einer Volkspartei war unter dem Eindruck des Kapp-Putsches und der Niederlage der Weimarer Koalition in den Reichstagswahlen im Juni 1920 entstanden. Stegerwald erhoffte sich eine Konsolidierung der politischen Verhältnisse durch die Konzentration der politischen Kräfte. Seine Überlegungen hatten eine staatspolitische Grundlage. Das Vielparteiensystem entwickelte nach seiner Meinung eine Affinität zu einem Übermaß des Taktierens. „Die sachlichen Gesichtspunkte verschwinden, die taktischen dominieren.“[10]
Die Erfahrungen mit der Zerrissenheit des Weimarer Parteiensystems drängten auch 1945 nach Konzentration der politischen Kräfte, ohne daß – wie 1933 – nach dem starken Mann gerufen wurde. Staatspolitische Überlegungen sprachen also nach 1945 wieder – wie 1920 – für eine Volkspartei.
Nach dem Fiasko des Tausendjährigen Reiches trat offensichtlich eine Rückbesinnung auf die sittlichen Kriterien der Politik ein. Im Vordergrund stand dabei die Abwehr totalitärer Gefahren, die als Aufgabe aller Gruppen galt. Diese Übereinstimmung hat ebenfalls mit dazu beigetragen, daß sich der Gedanke der Volkspartei bei den Christlichen Demokraten durchsetzte.
c) Union als Wahlmaschine?
Volksparteien organisieren sich – im Unterschied zu Klasse- oder Konfessionsparteien – nicht auf der Grundlage eines für alle Mitglieder geltenden soziologisch determinierten Hauptnenners. Für die Sozialdemokratische Partei wie für das Zentrum der Weimarer Zeit bildeten bestimmbare Gruppen das soziale Substrat der Partei: Arbeitnehmer für die SPD, Katholiken für das Zentrum.
Die CDU ist mit ihrer Gründung als Volkspartei aus dem Zentrum-Ghetto ausgebrochen. Die Integration der sozialen Schichten und der christlichen Konfessionen war die erfolgversprechende Voraussetzung für den Kampf um die Mehrheit der Wähler. Volksparteien entsprechen einem Entwicklungstrend zur Differenzierung der sozialen Verhältnisse, der das für Klassenparteien charakteristische Fundament eines soziologischen Blockes auflöst.
Die moderne Volkspartei begleitet im Unterschied zur alten Klassenpartei ihre Mitglieder nicht auf allen Lebenswegen. „Man hat scherzhaft gesagt, daß sie (die Klassenparteien) von der Wiege bis zum Grabe begleiten, von der proletarischen Säuglingsfürsorge (Arbeiterwohlfahrt) bis zum (freidenkerischen) Feuerbestattungsverein.“[1]
Der Typ der Volkspartei ist sehr viel stärker am Wahlerfolg orientiert als die früheren „Integrationsparteien.[2] Mit dieser verstärkten Außenorientierung an Wettkampf und Erfolg kann eine „politische Desideologisierung“[3] verbunden werden, mit der eine gewisse Affinität zu einem technokratischen Verständnis von Politik korrespondiert. Volksparteien bedürfen offenbar des politischen Managements. Sobald aber diese Volksparteien die Mitglieder nur noch als Wahlkampfmaschine mobilisieren, verlieren sie die Funktion als Träger der politischen Meinungsbildung. Die innerparteiliche Diskussion, die eine Bedingung für die Beteiligung der Bürger an Entscheidungen ist, steht in Gefahr, unterdrückt zu werden, wenn Volksparteien als Mehrheitsparteien, die ohne Koalitionen auskommen müssen, ständig Rücksicht auf Wahlerfolge und Abgrenzung von Konkurrenzparteien nehmen. „Dem Hauptinteresse einer Volkspartei, die Wahlen zu gewinnen, um dadurch in den Besitz der politischen Entscheidungsbefugnisse zu gelangen, kann die innerparteiliche Diskussion nur insoweit dienen, als sie die Partei nicht hindert, sich auf den vermuteten und in der Regel demoskopisch ermittelten Wählerwillen einzustellen.“[4]
Vor unserem gefährlichen Trend zur Entpolitisierung muß jedoch die Volkspartei bewahrt werden. Deshalb muß sowohl der Rückzug in die alte Homogenität der „Integrationsparteien“, als auch die Reduzierung zur Wahlmaschine vermieden werden. Volksparteien, welche die Vorteile der Massenbasis von Großorganisationen mit denen der politischen Vitalität von Integrationsparteien verbinden, werden der innerparteilichen Meinungsbildung eine erhöhte Bedeutung beimessen und sie stimulieren. Die innerparteiliche Diskussion soll den Kampf um politische Ziele ermöglichen. Der Meinungskampf, der in der Weimarer Zeit zwischen den vielen Parteien ausgetragen wurde, muß auch in den Volksparteien ermöglicht werden. Durch verstärkte innerparteiliche Mitwirkungsrechte kompensiert der Bürger seine verminderten Auswahlmöglichkeiten, die sich aus der Reduzierung der zur Wahl stehenden Parteien ergeben.
Eine solche innerparteiliche Diskussion könnte unbelastet von den Überlebensängsten und dem Prestigedenken von Kleinparteien geführt werden.
Die Meinungsbildung in Großorganisationen, wie es die Volksparteien sind, bedarf der Strukturierung. In diesem Zusammenhang werden die Unterorganisationen der Parteien relevant. „Das System selbständiger Suborganisationen in der CDU trägt zu deren Erfolg bei, denn es führt der Union Anhänger verschiedener sozialer Herkunft zu. Die Suborganisationen heben insofern den ‚Mangel‘ der Volkspartei CDU auf.“[5]
Was auf den ersten Blick wie ein raffinierter Trick des Stimmenfangs aussehen könnte, erweist sich jedoch als notwendiger Bestandteil von Volksparteien, die auf eine politische Meinungsbildung nicht verzichten wollen. Die Meinungsbildung in den großen Volksparteien vollzieht sich nicht über ein atomisiertes Mitgliedergefüge, sondern über Gruppen. Sie ist also strukturiert und muß organisiert werden. Das regionale Organisationsprinzip reicht nicht dafür aus, weil die Region nicht ausschließlicher Kristallisationspunkt politischer Meinungsbildung ist. Die regionale Gliederung bedarf also der Ergänzung. Die Suborganisationen in Form von Vereinigungen schlagen die politischen Brücken zu verschiedenen Bevölkerungsgruppen. Die Gliederungen der Parteien erleichtern die Korrespondenz mit der differenzierten Gesellschaft. Sie bewahren die Volksparteien vor der politischen Selbstgenügsamkeit und Isolierung, die mit einer Einengung aufs Management verbunden wäre. Im Unterschied dazu sind beispielsweise Kaderparteien auf Informationssperren und Meinungsschleusen angewiesen. Volksparteien funktionieren als Kommunikationszentralen. Ihr Vorzug ist die Offenheit.
Die Differenzierung der Gesellschaft spiegelt sich in pluralistischen Parteistrukturen. Eine solche Struktur bildet eine Gegenkraft zur Polarisierung der politischen Landschaft. Indem die Parteien in sich differenziert sind, wird einer politischen Schwarz-Weiß-Malerei, die zu einem Freund-Feind-Verhältnis führt, die Grundlage entzogen.
Wie schwer den Sozialdemokraten der Abschied von der Geborgenheit und der Geschlossenheit ihrer Vergangenheit als Klassenpartei fällt, zeigt sich in ihrem Verhältnis zu den Parteigliederungen, die sie entweder nicht zuläßt (wie beispielsweise eine den CDU-Sozialausschüssen entsprechende SPD-Arbeitnehmervereinigung) oder zu behindern versucht (wie zum Beispiel die Jungsozialisten). Der Kommunikation zwischen Gesamtpartei und Jungsozialisten stehen nicht nur inhaltliche Meinungsverschiedenheiten im Wege, sondern ein Unverständnis für die relative Selbständigkeit von Suborganisationen. (Wehner: „Zweierlei Meinungsbildung kann es nicht geben.“) Wenn jedoch nur Funktionserfordernisse der Geschlossenheit maßgebend sind, bleibt für inhaltlich bestimmte Diskussionspositionen nur der Rückzug in die sektiererhafte Kleingruppe. (Zuerst sollte die APO in die Partei, jetzt ist sie drin, nun soll sie wieder heraus.)
Aber auch in der CDU machen sich unter dem Zwang, die nächste Wahl gewinnen zu müssen, entpolitisierende Tendenzen bemerkbar, die sich in dem Versuch zeigen, die Sozialausschüsse „auf Vordermann zu bringen“. Es kommt hinzu, daß eine noch immer unpolitische Öffentlichkeit jede innerparteiliche Meinungsverschiedenheit als spektakuläre Bedrohung der Partei empfindet und so jene „treuen“, aber ebensooft auch apolitischen Parteimitglieder verschreckt und sie in der Annahme bestätigt, innerparteiliche Meinungskämpfe seien schädlich.
2. Exkurs Ruhe ist die erste Bürgerpflicht
Der Ruf nach innerparteilicher Geschlossenheit durch Einigkeit ist ein verspätetes Echo auf das apolitische Ruhebedürfnis deutscher Bürgerlichkeit.
„Ruhe ist die erste Bürgerpflicht“ ließ der preußische Minister Graf von der Schulenburg am Morgen nach der Schlacht bei Jena an den Straßenecken Berlins verkünden. Und seit 150 Jahren halten sich brave Bürger an diese Aufforderung. Die Bravheit des Bürgers, jedenfalls was seine Tätigkeit in der höheren Sphäre des Staates anbelangte, entschied sich für Geräuschlosigkeit. Hinter seinen vier Wänden allerdings kam es schon einmal vor, daß er tobte. Das jedenfalls war erlaubt. Gegenüber dem Staat aber verhielt er sich als respektvoller, schweigsamer Untertan. Was sich in den Tugendkatalogen des Spießbürgers als Anweisung für den staatlichen Hausgebrauch niederschlug, hat der preußische Staatsphilosoph Friedrich Hegel, freilich eine Stufe höher, theoretisch untermauert in der systematischen Trennung von Staat und Gesellschaft. Im Raum der Gesellschaft kämpfen die Interessen, dort ist der Egoismus das Regulativ des mitmenschlichen Verkehrs. Im Staat aber herrscht die reine Sittlichkeit. Der Bürger beschränkte sich darum auf den wirtschaftlichen Alltag und überließ den Staat und die große Politik den großen dazu berufenen Persönlichkeiten. Das System war auf Arbeitsteilung aufgebaut.
Noch der bayrische Stoßseufzer, „Mei Ruh will i hab’n“, ist ein verspätetes Echo aus der Gartenlaubenidylle des 19. Jahrhunderts. Man verschloß die Augen vor der bösen großen weiten Welt und richtete sich ein in biederem Stubenglück. Allerdings waren später diese politischen Stubenkinder sehr wohl für die Öffentlichkeit zu mobilisieren. Nur erschienen sie dann nicht als gestaltende Subjekte in der Öffentlichkeit, sondern als Nummern einer Marschkolonne. Man konnte sie manipulieren. Der Marschschritt der großen Masse störte die private Ruhe nicht. Auf Ruhe aber war man bedacht, selbst wenn draußen die Gasöfen von Auschwitz qualmten. Wenn die häusliche Freiheit gewahrt blieb, so konnte draußen passieren, was wollte. Die Freiheit, für die der Spießbürger sich einsetzt, ist die Freiheit der Intimsphäre, nicht die staatsbürgerliche Freiheit der Mitgestaltung.
Ich weiß nicht, ob die Schizophrenie zwischen der Sittlichkeit im kleinen und der Grausamkeit im großen spezifisch deutsche Vergangenheit ist. Wir wissen, daß Höss ein rührender Familienvater war und zugleich Kommandant von Auschwitz. Himmler schwärmte von der Tierliebe und organisierte den Massenmord. In einer Rede vor SS-Gruppenführern in Posen am 4. Oktober 1943 sagte Himmler: „Von euch wissen die meisten, was es heißt, wenn 100 Leichen beisammenliegen, wenn 300 daliegen oder wenn 1000 daliegen. Dies durchgehalten zu haben und dabei – abgesehen von Ausnahmen menschlicher Schwäche – anständig geblieben zu sein, das hat uns hart gemacht. Dies ist ein niemals geschriebenes und niemals zu schreibendes Ruhmesblatt unserer Geschichte.“[1] Anständigkeit, das beweist dies Himmler-Zitat, war Wohlverhalten in der Gruppe, waren Ordnung und Sauberkeit, waren Pünktlichkeit und vor allem Übereinstimmung mit der eigenen Gruppe.
Teil II Für eine prinzipielle Politik: Freiheit – konservatives Klischee oder progressive Tendenz?
Gesellschaftspolitik kann betrieben werden wie ein Warenhaus: für jeden etwas. In einer Gesellschaft, die auf dem Wege in den Überfluß ist, ist der Vorrat so groß, daß alle Interessen abgespeist werden können, vor allem aber die, welche sich bemerkbar und damit Ärger machen können. Gesellschaftspolitik, die nur aus einem Katalog von Forderungen besteht, entspricht dem Charakter einer Warenhausgesellschaft, in der all das zu haben ist, über das man sich handelseinig geworden ist. Einigung ist die Voraussetzung jeglichen Tauschgeschäftes. Ich gebe, damit du gibst!
Für Überraschungen ist in diesem politischen Geschäft kein Platz. Die Zukunft wird so lediglich zur Wiederholung der Gegenwart. Prinzipielle Fragen sind in solch perfekten Abläufen ein Störfaktor und deshalb nicht nur überflüssig, sondern unerwünscht.
Es gehört zu den unliebsamen Überraschungen, daß, obwohl doch alles so gut läuft, die Frage nach der prinzipiellen Fundierung der Politik nicht zur Ruhe gekommen ist. Ganz im Gegenteil. Was Politik „soll“, im Unterschied zu dem, was sie „ist“, dieser Frage sehen sich völlig unvorbereitet die etablierten Politiker und ihre Helfer ausgesetzt.
Das Prinzip, von dem die folgenden gesellschaftspolitischen Überlegungen ausgehen, heißt Freiheit.
Alle historischen Freiheitsbewegungen waren Emanzipationsbewegungen. Wer das eigene Leben in die Hand nehmen will, muß es zuerst aus fremden Händen befreien. Deshalb muß Unterdrückung niedergekämpft werden, bevor Freiheit zur Selbstbestimmung möglich wird. Der aufklärende Ruf „Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“, hat erst dann Chance, Wirklichkeit zu werden, wenn der Vormund beiseite geschafft ist. Freilich, der historische Fahrplan lief nicht immer in einem exakten Nacheinander ab. Oft wurden die „Unteren“ sich erst im Kampf gegen den Unverstand der „Oberen“ ihres eigenen Verstandes bewußt.
Aber es bleibt dabei. Freiheit erscheint zunächst in ihrer negativen Gestalt, nämlich als Widerstand gegen die Unfreiheit.
1. Freiheit von Not
In ihrer elementarsten Erscheinung ist Freiheit Freisein von Not. Unsere proletarischen Großväter haben für die Freiheit gekämpft, indem sie um ihr Existenzminimum kämpften. Denn Freiheit ohne Existenzsicherheit ist die Freiheit des Naturreiches, in dem der große Fisch den kleinen frißt. Die Proletarier waren die kleinen Fische der industriellen Revolution.
a) Hunger in der Welt Das Nord-Süd-Gefälle des Wohlstandes
Für uns in Europa ist der proletarische Kampf gegen Hunger ein Bild aus heroischen Zeiten der Arbeiterbewegung. Auf der Welt aber ist der Kampf für die Freiheit als Kampf gegen die Not noch nicht beendet.
Von den 139 selbständigen Staaten der Welt zählen 103 zu den unterentwickelten.[1] Die reichen Industrienationen besitzen 80 Prozent der Güter dieser Welt. Dieser Reichtum befindet sich in den Händen von 30 Prozent der Erdbevölkerung.[2]
Von den 50 Millionen, die jedes Jahr sterben, verdanken nach einer Statistik der FAO ungefähr 35 Millionen ihren Tod dem Hunger.[3] Das sind in einem Jahr mehr Tote als der Zweite Weltkrieg in sechs Jahren geschafft hat. Während auf der einen Seite der Weltkugel die Menschen krepieren, weil sie zuwenig zu essen haben, sind sie auf der anderen Seite in Gefahr, an Fettsucht zu sterben. Die einen müssen ihrem Übergewicht, die anderen ihrem Untergewicht zu Leibe rücken. Niemand kann behaupten, dies sei der normale Lauf der Welt. Die Welt leidet an Schizophrenie.