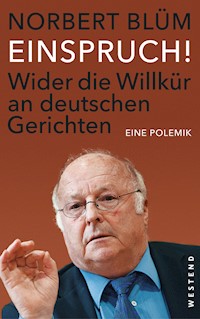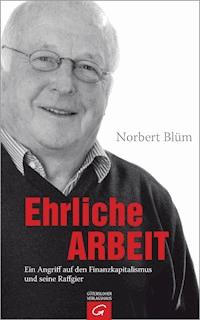Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Herder
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Norbert Blüm geht auch dorthin, wo es unangenehm wird: Er widerstand dem Diktator Pinochet und holte Folteropfer aus chilenischen Gefängnissen. Er räsonierte nicht aus der Distanz über Flüchtlinge, sondern war vor in Idomeni vor Ort. In der Gewerkschaft war der ehemalige Opelianer länger als in der CDU. Die Vergötzung des Geldes ist ihm ein Gräuel. Er stellt sich und kämpft für das Gute. Schon immer – und auch heute. Gelernt hat er von vielen: von seinem Lehrer Joseph Ratzinger ebenso wie von seinem kommunistischen Onkel. Als Kind erlebte er noch den Schrecken des Krieges am eigenen Leib. Und gerade weil er das nie vergaß, weil er weiß, was Hass, Gewalt und Terror anrichten können, streitet er in seinem neuen Buch für zentrale Werte wie Gerechtigkeit, Solidarität und für Respekt vor der Würde des Einzelnen. Frieden im kleinen und großen ist für ihn Voraussetzung dafür. Deswegen kämpft er für ein Europa, das mehr ist als eine egoistische Wirtschaftsgemeinschaft und für Werte, die das Zusammenleben stärken. Seine Botschaft lautet: Wir müssen unseren Enkeln eine menschliche Zukunft sichern. Eine bessere Welt ist möglich. Es liegt an uns allen, sie zu verwirklichen. "Krieg, Folter, Ausbeutung, Ungerechtigkeit sind keine Wetterereignisse wie Tsunami oder Blitz. Sie sind auch nicht gottgegeben, sondern von Menschen geschaffen. Also können sie auch von Menschen abgeschafft werden. Darum geht es in diesem Buch." Norbert Blüm
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 338
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Norbert Blüm
Verändert die Welt,
aber zerstört sie nicht
Einsichten eines linken Konservativen
© Verlag Herder GmbH, Freiburg im Breisgau 2017
Alle Rechte vorbehalten
www.herder.de
Umschlaggestaltung: Gestaltungssaal
Umschlagmotiv: © dpa Picture-Alliance/Klaus-Dietmar Gabbert
E-Book-Konvertierung: Carsten Klein, München
ISBN (E-Book) 978-3-451-81193-7
ISBN (Print) 978-3-451-37920-8
Inhalt
Impressum
Zur Einstimmung
Die Geschichten zwischendurch
Bevor der Krieg zu Ende war
Meine Mutter und Tante Änni
Was bedeutet das Gestern für heute?
1. Kapitel Finstere Zeiten
1. Meine längste Wanderung
2. Im Lager von Idomeni
3. Die Sklaven von Katar
4. Menschenrechte – »urbi et orbi«
2. Kapitel Die neue Religion: Gott Mammon
3. Kapitel Rückblicke, Einblicke, Ausblicke
1. Politischer Anfang: Wie die Jungfrau zum Kind
2. Das Ende: Der Mohr kann gehen …
3. Zwischen den Stühlen
4. Bin ich ein linker Konservativer?
4. Kapitel Europa – mehr als ein Konzern
1. Was ist Europa?
2. Quo vadis, Europa?
3. Nationalstaat – passé und ade
5. Kapitel Was blüht den Kindern?
1. Das Glück der Kindheit
2. Das Unglück der Kinder
3. Die Enteignung der Kindheit
6. Kapitel Kampf um den Sozialstaat
1. Von der Sozialversicherung zur Fürsorge?
2. Die Pflegeversicherung
3. Bewährungsprobe Wiedervereinigung
4. Ein Brief an die Junge Union
7. Kapitel Leitfiguren statt Leitkulturen
1. Nell – mein heiliger Provokateur
2. Onkel Adolf – Bitte für uns!
Nachklang
Brief an meine Enkel
Über den Autor
Zur Einstimmung
Dieses Buch erzählt in Rückblicken und Ausblicken von einer Lebensreise. Es ist keine Autobiografie, und es liefert auch keine systematische Abhandlung. Ich berichte von Erfahrungen und Einsichten und beschreibe so Teile eines Lebensverständnisses. Dabei hoffe ich, dass das, was in den einzelnen, ganz unterschiedlich gearteten Kapiteln zum Ausdruck kommt, doch so etwas wie ein Ganzes aufscheinen lässt.
Es kommt mir dabei nicht auf Originalität an. Wichtig war mir beim Schreiben vielmehr die Frage, ob auch tatsächlich richtig ist, was ich für richtig halte, und ob sich und wie sich das Richtige verwirklichen lässt. Ich habe gelernt, dass zur Durchsetzung von Ideen bisweilen eine große Portion Hartnäckigkeit nötig ist. Deshalb hindert mich auch meine Eitelkeit nicht daran, etwas, was ich früher an anderer Stelle vorgetragen oder geschrieben habe, zu wiederholen. Aber auch neue Einsichten sind mir beim Schreiben gekommen. Ob diese Gedanken richtig sind, stellt sich erst später heraus: Nur die Probe aufs Exempel beweist die Tauglichkeit von Gedanken für die Realität.
Ich folge dabei einer Grundthese von Karl Marx »Die Philosophen haben die Welt nur verschieden interpretiert. Es kömmt drauf an, sie zu verändern.« Also gilt für mich die Praxis als Beweis der Theorie, getreu der biblischen Verheißung: »An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen.« Wobei ich einschränkend gleich hinzufüge: Ohne rechte Theorie auch keine richtige Praxis. Also beißt sich – wie in jeder guten Dialektik – die Katze in den Schwanz. Eine gute Dialektik gleicht allerdings mehr der Spirale, auf der man sich hochschraubt, als dem Kreis, in dem sich alles dreht und deshalb wiederholt.
Die Geschichten zwischendurch
Tagebücher habe ich nie geschrieben. Wenn der Tag ereignisreich war, war ich am Abend müde und zu abgespannt, um noch einmal den Griffel in die Hand zu nehmen. Und wenn er fade verlaufen und ich faul gewesen war, überkam mich am Ende des Tages nicht die Lust, nachträglich aus ihm mehr zu machen, als er gewesen war.
Ich vertraue also darauf, dass mein Gedächtnis Wichtiges von Unwichtigem unterscheidet und nur das Erste als aufbewahrungswürdig behandelt. Mein Gedächtnis ist das Sieb, das Wichtiges zurückhält. In dem Schließfach meiner Erinnerung befinden sich also Schätze meines Lebenslaufes, aber auch Urnen, in denen ich die Asche des Bösen aufbewahrt habe. Eine »Urnenasche« trägt den Namen »Pinochet«.
Mit den biografischen Reminiszenzen, die ich in dieses Buch einstreue, versuche ich die Lebensnähe meiner Vorstellungen zu sichern. Außerdem erfasst mich im Alter plötzlich das Bedürfnis, meinen Enkeln mehr zu erzählen, als mein Vater mir erzählt hat. Nachträglich reut es mich, dass ich ihn nicht mehr ausgequetscht habe. Jetzt ist es zu spät, vieles noch zu erfahren, was ich eigentlich wissen will. Warum z. B. ist mein Vater nie ein Nazi geworden, obwohl er als erfolgreicher Motorrad-Rennfahrer von ihnen umworben wurde? Als Nazi hätte er sicher viele Karrierevorteile gehabt. So blieb er Kraftfahrzeugschlosser und war am Ende Omnibusfahrer. War er gar ein Held, der seiner Überzeugung wegen auf Aufstieg und Ansehen verzichtet hatte? Ich werde es nicht mehr herausbekommen. Mein Vater hat zu wenig von sich erzählt, und ich habe ihn zu wenig gefragt.
Meine Vorstellungen entnehme ich meinen Erfahrungen. Und die Erfahrungen entnehme ich meinen Erlebnissen, von denen ich altersbedingt mehr besitze als meine Enkel. Dagegen ist deren Vorrat an Zukunftserwartungen größer als meiner. Mit anderen Worten: Sie besitzen mehr Zukunft, ich mehr Vergangenheit. Ich versuche, mich von ihrer Neugierde auf das, was kommt, anstecken zu lassen, und »bezahle« mit alten Geschichten.
Aus Erfahrung klüger werden, das gehört zu den schwer zu haltenden guten Vorsätzen der Menschheit.
Meine wichtigste Empfehlung besteht aus dem »Oldie«: Nie wieder Krieg! Der Rat ist nicht originell, aber dennoch lebenswichtig. Andere haben schon vor mir diese Parole gerufen – mit niederschmetterndem Erfolg. Man soll aber die Hoffnung nie aufgeben. Immerhin erleben wir soeben in Europa die längste Friedensepoche seit Menschengedenken. Menschen hierzulande, die nicht älter als 72 Jahre alt sind, haben in ihrem ganzen Leben noch nie Krieg erlebt. Ich kenne keine Epoche in unserer Geschichte mit einer so langen Periode des Friedens. Irgendwo krachte es immer.
Ist das nichts?
Die vorhergehende Generation musste in der Zeitspanne von 70 Jahren dreimal Krieg über sich ergehen lassen oder sogar mitmachen: 1870/71, 1914/18, 1939/45.
Wir können von unserem siebzigjährigen Friedenserlebnis nicht genug bekommen. Es soll nie zu Ende gehen. Und vor allem soll dieser Frieden nicht nur uns Deutschen vorbehalten bleiben, sondern überall auf der Welt »ausbrechen« und dauern. Es kann uns nicht egal sein, wenn in Syrien oder anderswo Menschen um ihr bisschen Leben zittern.
Bevor der Krieg zu Ende war
Dieses Buch beginnt mit einem Kriegserlebnis, das mir bis heute in den Knochen steckt: »Meine längste Wanderung«. Das ist lange her. Doch ein Krieg geht nicht so leicht zu Ende, wie man das Licht ausknipst. Er wirkt nach und taucht in tausend Verkleidungen und Vorwänden immer wieder neu auf. An die Stelle des alten Krieges draußen an der Front ist der Terror drinnen in der Heimat und neben uns, in unserer Nachbarschaft, getreten. Es kämpfen keine Heere mehr gegeneinander, sondern Einzelne und Gruppen gegen alle und glaubenswütende Fanatiker gegen den »Rest der Welt«, der in Ruhe gelassen werden will. Die Frontlinie geht quer durch Staaten und Gesellschaften. Es gibt im Terrorismus keine Kriegserklärungen und Friedensverträge, sondern Aggression ohne Ankündigung und ohne Ende.
»Der Krieg ist der Vater aller Dinge«, behauptete vor ungefähr zweieinhalb Jahrtausenden Heraklit, und Ernst Jünger schwärmte noch im letzten Jahrhundert in heroischem Ton von der erfrischenden Kraft von »Stahlgewittern«, welche die Männlichkeit auf die Probe stellten. Darin sah er die Ertüchtigung zur Männlichkeit, die für viele seiner Generation identisch mit Menschlichkeit war: Männlichkeit ist Kampf, und Kampf ist menschlich. Das aber ist ein Teufelskreis der Barbarei.
Ich habe als Kind den Krieg in Gestalt einer höllischen Furie der Mordlust erlebt. Satanische Energien verwandelten eines Nachts schlagartig meine schöne, kindliche Welt in eine böse, grausame Hölle, und noch heute muss ich mich schütteln bei der Erinnerung daran.
Es war Fliegeralarm in Rüsselsheim, meiner Heimatstadt. Im wilden Geballere der Flak wurde ein feindliches Flugzeug vom nächtlichen Himmel abgeschossen. Erst zappelte das Flugzeug im Fadenkreuz der Scheinwerfer, dann der Kanonen. Kurz danach sah ich ein brennendes Wrack vom Himmel stürzen. Vier Piloten sprangen mit dem Fallschirm ab. Kaum waren sie auf der rettenden Erde angekommen, empfingen wütende Rüsselsheimer Bürger mit Knüppeln in besinnungsloser Rage die gerade glücklich dem Tod entkommenen Soldaten. Eine rasende Meute jagte die Piloten durch den Wald und knüppelte sie nieder, wie man früher Ratten erschlagen hat. Einer konnte entkommen.
Nach dem Krieg wurde den Totschlägern der Prozess gemacht. Wer war es? Keiner wollte zugeschlagen haben. Darüber entstand in meiner Heimatstadt großer Streit. Jeder schob die Schuld auf andere. Schließlich wurden fünf Rüsselsheimer Bürger zum Tode verurteilt und in Landsberg hingerichtet. Einer davon war der Wirt des angesehenen Gasthauses »Zum Löwen«, in dessen Wirtshaussaal damals unser schulischer Notunterricht abgehalten wurde: zwei Stunden, alle zwei Tage. Mehr Platz für alle Schulklassen gab es nicht. Die ordentliche Schule war damals von den amerikanischen Besatzungssoldaten in Beschlag genommen, also für uns nicht zugänglich.
Der Sohn des hingerichteten Wirtes war mein Klassenkamerad. Philipp war sein Name. Er hatte am Tag der Hinrichtung seines Vaters »schulfrei«. Unser Unterricht verlief auch an diesem Tag »ordnungsgemäß« wie immer, sozusagen ungerührt von all diesen Ereignissen. Kein Wort von einer Katastrophe. Philipp saß am nächsten Tag wieder auf seiner Schulbank, als wäre nichts geschehen. Keiner fragte ihn nach seinem Vater. Philipp wurde später ein bekannter Hockey-Spieler und noch später ein berühmter Physiker in den Vereinigten Staaten.
Wie die Alten sungen, so zwitschern auch die Jungen. Hitler und alles, was dazugehörte, waren tabu. Verdrängung war das Gebot der Stunde. Über »vorher« und »nachher« wurde nicht gesprochen. Die Hitlerzeit war kein Lehrstoff. So wenig Veränderung im Unterricht war nie. Schließlich unterrichtete uns derselbe Lehrer, von dem wir Schüler noch ein paar Monate zuvor jeden Morgen zu Schulbeginn mit »Heil Hitler« und stramm in die Höhe gestreckter rechter Hand begrüßt worden waren.
Die Klasse antwortete dann, ebenso stramm stehend und wie abgerichtet, mit »Heil Hitler« und erhob dabei die Hände zum Hitlergruß. Nach Kriegsende trat an die Stelle dieses lauten morgendlichen Appells ein leises Schulgebet. Keiner erklärte uns Schülern den Grund für diesen Wechsel. Der Lehrer hatte fürs Gebet ein Gedicht von Mörike ausgewählt:
»Herr! schicke, was du willt,
ein Liebes oder Leides.
Ich bin vergnügt, dass Beides
aus Deinen Händen quillt.
Wollest mit Freuden,
und wollest mit Leiden
mich nicht überschütten!
Doch in der Mitten
liegt holdes Bescheiden.«
Die biedermeierliche »holde Bescheidenheit« war die Antwort auf das Grauen der Hitlerzeit. Der Lehrer flüchtete in die biedermeierliche Lyrik als Gebetsersatz. Zu einem richtigen Gebet konnte sich der gewendete Lehrer offenbar nicht ermannen.
Das Leben geht eben immer weiter.
Die Sinnlosigkeit des Heldentodes, von dem mir in der Schule vorgeschwärmt worden war, hat mich allerdings erst an jenem Tag voll getroffen, als der Krieg für mich zu Ende ging. Es war in Schafhausen bei Alzey, Wochen vor dem amtlichen »Kapitulation«.
Aus einem »heiteren« Wäldchen ballerte eine kleine Kanone ihre Granaten auf die anrückenden mächtigen amerikanischen Panzer. Es waren mächtige Kolosse in einer Kolonne, einer nach dem anderen in einer schier endlosen Reihe. Die drei vorderen Panzer stoppten, richteten ihr Gefechtsrohr auf das Wäldchen und schossen zehn Granaten in das Waldstück. Dreißig Sekunden und zehn Schüsse haben sie dazu gebraucht und von der Kanone im Wäldchen war nichts mehr zu hören. Es war, als hätte ein Elefant mal kurz auf eine Maus getreten. Die »Mäuse« waren drei junge deutsche Soldaten in Uniform. Abends lugten ihre blutverschmierten Hände unter einer Plane hervor, die über den Karren gezogen war, auf dem ihre Leichen lagen. Das war die leibhaftige Konsequenz des faschistischen Rates: »Führer, befiehl, wir folgen dir!« Die drei Buben befolgten die Parole bis zu ihrem bitteren Ende. Vielleicht haben sie sogar noch in der Stunde ihres Todes an den Endsieg mit Hitlers Geheimwaffe geglaubt, so wie Frau Frangel, die Bäuerin, bei der wir untergekommen waren. Auf dem Schafhauser Friedhof wurden sie als unbekannte Soldaten unter die Erde gebracht.
Das war’s.
Meine Mutter und Tante Änni
Kurz bevor die Panzer die armen Soldaten erschossen, war Schafhausen erobert worden. Das ganze Dorf saß drei Tage und Nächte vor dem Einmarsch der Amis in einem Weinkeller; der ist heute zwar verschüttet, aber mit einiger Mühe kann man noch in ihn eindringen. Das »ganze Dorf«, das waren damals vielleicht hundert Leute, die meisten davon Frauen und Kinder. Die Männer kämpften draußen an der Front. Ab und zu schlichen sich die Mütter in ihre Häuser und holten Nachschub zum Essen für ihre Kinder. Wenn meine Mutter weg war, stand ich Todesängste aus. Ich fürchtete, dass sie von Fliegerangriffen oder sonstigen Überfällen getroffen würde. Meist entwich mir Mama mit Tante Änni, ihrer Schwester, nachts, wenn ich mit anderen Kindern in warmen Decken auf dem Boden schlief.
Eines Morgens hat Mama zusammen mit Tante Änni die Steine einer Panzersperre weggeräumt, die quer über die Straße vor dem Haus, in dem wir untergekommen waren, errichtet worden war. Sie hängten außerdem ein weißes Betttuch aus dem Fenster, das als Zeichen der Kapitulation gelten sollte. Frau Frangel, die Hausbesitzerin und Ortsbauernführerin, kündete ihr wegen dieses Vaterlandverrats die harte Bestrafung des Führers an, wenn dieser mithilfe der Wunderwaffe, von der sie wisse, dass der Führer sie besitze, Deutschland zurückerobert habe.
Hitler hat Gott sei Dank Frau Frangels Vorhersage nicht erfüllt. Meine Mutter und Tante Änni jedoch haben das Dorf vor der Zerstörung bewahrt, dessen bin ich mir nachträglich sicher. Denn bevor die Panzer anrückten, flog ihnen ein einmotoriges Flugzeug voraus, und seine Besatzung sah nach, ob der Weg frei sei. Wenn das nicht der Fall war, räumte die vorrückende Artillerie die Panzersperren mit ein paar Granaten aus dem Weg. Schafhausen blieb jedenfalls verschont. Aber Framersheim, zwei Kilometer weiter, brannte lichterloh. Framersheim hatte keine Gretel und keine Änni. Nach den beiden Frauen müsste eigentlich eine Straße in Schafhausen benannt werden.
In der Nacht vor dem Eintreffen der Amerikaner war es im Weinkeller totenstill. Nur ein paar Kerzen brannten. Alle hatten Angst, keiner verließ mehr den Keller. Ich lag in dieser Nacht mit meinem kleinen Bruder Hans-Peter dicht bei der Mama. Die Front kam näher. Die Kanonenschläge wurden lauter. Irgendwann muss es doch geschafft sein, bibberte ich vor mich hin. Ich machte kein Auge zu. Hans-Peter, mein kleines Brüderchen, schlief fest und schnarchte. Die Granaten kamen von Norden, nicht, wie wir erwartet hatten, von Westen. Die Panzerkette hatte Alzey umfahren und die Stadt eingekesselt.
Plötzlich kam ein Ruf von oben: »Die Amis sind da!« Alle stiegen die lange Treppe hoch (die auch heute noch so lang ist), und draußen in der Morgendämmerung standen amerikanische Soldaten im Halbkreis vor der Kellertür, aus der wir kamen. Alle trugen Munitionsketten um die Schultern, und alle richteten ihre Waffen auf uns. Einer der Soldaten hatte eine schwarze Hautfarbe. So jemanden hatte ich noch nie gesehen.
Jetzt ging einer an die Kellertür, öffnete sie und richtete seine Waffe hinab in den dunklen Keller … und ein Schrei gellte durch die Luft. Meine Mutter stürzte an dem Soldaten vorbei und rannte die Kellertreppe hinab, ungeachtet des drohenden Gewehres. Sie hatte den kleinen Hans-Peter nicht geweckt, sondern im Keller schlafen lassen … Jetzt schießt er, dachte ich. Die Sekunden dauerten für mich Stunden. Da erschien meine Mutter mit dem kleinen Hans-Peter auf dem Arm in der Kellertür. Mir erschien sie wie eine Mutter-Gottes-Erscheinung.
Der Krieg war zu Ende.
Was bedeutet das Gestern für heute?
Alles, was ich in diesem Buch geschrieben habe, hat irgendwie mit meinen Kindheitserlebnissen zu tun. Alle Texte darin sind wie Sandsäcke, die zu Schutzwällen aufgeschichtet sind gegen die Schrecken der Grausamkeit, zu der Menschen fähig sind. Die Flüchtlinge in Idomeni, die Ausgebeuteten in Katar, die Gefolterten in Chile, sie sind Leidensgenossen, die mir begegnet sind.
Ich weiß keine andere Waffe gegen Hass als Mitleid und kein Mittel gegen Barbarei als Menschlichkeit. Und ich begreife Menschlichkeit als die einfache Fähigkeit, sich »in andere Menschen hineinzuversetzen« und so mitzufühlen, was diese erleiden. Diese Fähigkeit besitzen dank unserer Ausstattung mit Spiegelneuronen nur die Menschen. Es ist unsere spezifische Differenz zu anderen Lebewesen und unser humanes Privileg.
Die Konsequenz aus meinen »glücklichen« Kindheitstagen ist, dass ich stets versucht habe, an einer Welt mitzuarbeiten, in der meine Enkel nicht die Schandtaten aushalten müssen, die ich gesehen und ertragen habe. Vergangenheitsbewältigung als ein Erzählen sich wiederholender Geschichten ist steril, bestenfalls Zeitvertreib. Produktiv wird sie erst durch eine Zukunftsbewältigung, welche die Wiederholung der Vergangenheit verhindert.
Friede ist kein Stillstand, sondern ein ständig durch neue Aggression gefährdeter Zivilisationsprozess. Solange die Welt so ist, wie sie ist, ist kein Frieden.
Was also tun? Wir leben in einer Krisenzeit. Das hat zwar jede Zeit von sich behauptet. Aber im Rückblick waren es dann einige tatsächlich, andere nicht. Die Krise der Globalisierung hat zwei Gesichter: ein bedrohliches und ein hoffnungsvolles, Bedrohung und Chance. Welches wird sie uns zeigen?
Sicher ist: Die Ferne ist uns näher gerückt. Wir kennen die Bilder des Elends und der Ausbeutung. Teilen oder Untergehen ist die Alternative, nicht Retten des eigenen Bestands und Siegen um jeden Preis ist die Lösung. Der Globus verfügt nicht über einen Notausgang. Der Nationalismus ist keine Rettung, sondern der Untergang.
Dieses Buch steht auf dem Fundament der abendländischen Ideen. Wenn ich mich darauf beziehe, wende ich Gedanken hin und her und bin mir dabei nicht immer so sicher, wie es scheinen mag. Mit Patentrezepten kann ich nicht dienen.
Es geht auch um die große Frage der politischen Verantwortung, um die europäische Einigung und die Demokratie. Sie sind die Antwort auf das »Tausendjährige Reich«, das dann schließlich nach zwölf Jahren zu Ende war. Aber davon war jedes Jahr eines zu viel.
Ich glaube an die weltveränderte Kraft der Idee von der Würde jedes Menschen. Diese Idee gehört zu den Quellen unserer Kultur. Aus diesen Kleidern unserer humanistischen Tradition kommt niemand so leicht heraus, und wenn, dann auf die Gefahr der Barbarei hin. Wie wertvoll diese Erbschaft ist, wird vielen erst durch den Ansturm eines terroristischen Fanatismus bewusst.
Neben den großen Fragen der politischen Verantwortung gehören freilich auch die »kleinen Fragen« der inneren Ordnung der Gesellschaft in diesen Zusammenhang. Daher geht es in diesem Buch auch um die Familie und um den Sozialstaat. Die Kämpfe um sie haben fast mein ganzes Berufsleben in Anspruch genommen.
Wie gesagt: Mehr als Teillösungen und vorläufige Antworten habe ich nicht zu bieten. Dennoch habe ich eine unausrottbare Ahnung, dass ein besseres Leben für alle möglich ist. Aber das fällt nicht vom Himmel, sondern wird auf Erden geschaffen werden müssen. Von uns.
Krieg, Folter, Ausbeutung, Diskriminierung sind keine Naturereignisse wie ein Tsunami oder ein Blitz. Sie sind kein unabwendbares Schicksal wie ein Erdbeben. Sie sind auch nicht gottgegeben, sondern von Menschen geschaffen.
Also können sie auch von Menschen abgeschafft werden.
Wir müssen die Welt verändern, wenn wir sie bewahren wollen. Und wir müssen bewahren, was bewahrenswert ist, damit wir sie nicht zerstören.
Diese Spannung müssen wir aushalten.
Und darum geht es in diesem Buch.
1. KapitelFinstere Zeiten
1. Meine längste Wanderung
Die längste Wanderung meines Lebens bestand aus dreißig Schritten. Bei jedem Schritt ging es um Leben und Tod.
Damals, 1943, war ich acht Jahre alt. Im Luftschutzkeller hatten wir die Nacht verbracht, meine Mutter, mein kleiner Bruder, acht Wochen alt, und ich. Der kleine Hans-Peter auf dem Arm meiner Mutter. Ich kuschelte neben ihr, den Kopf auf ihrem Schoß. Der Keller war halbdunkel. Vor uns flackerte eine dicke Kerze.
Vater war im Krieg.
So vergingen die Stunden seit Mitternacht. Als die Alarmsirenen aufheulten, sprang ich, wie oft geübt, aus dem Bett und in meine vor dem Bett ausgebreiteten Kleider, ergriff das Luftschutzköfferchen, in dem sich eine Kerze, ein Buch und ein Apfel befanden, meine Mutter schnappte sich den Bruder. Minuten später waren wir im Luftschutzkeller, dessen Decke mit Holzstämmen abgestützt war. Über uns im Parterre die Geschäftsräume der Deutschen Bank und darüber zwei Stockwerke für die »Fritz Opel Nachlassverwaltung GmbH«. Unter dem Dach unsere, des Hausmeisters Wohnung.
Das große, breite Treppenhaus durchhuschten wir wie immer bei Fliegeralarm im Dunkeln. Wir kannten die Treppenstufen, wie Blinde ihre Umgebung kennen. Ohne Alarm, in normalen Zeiten, benutzte ich das Geländer verbotenerweise oft als Rutschbahn, da ging’s dann noch schneller nach unten.
Jetzt saßen wir drei, wie so oft, mutterseelenallein im Luftschutzkeller. Die Stunden seit Mitternacht rieselten ereignislos vorbei wie der Sand in einer Sanduhr. Neben uns brummten die großen Kessel der Heizungsanlage, von denen wir nur durch eine dicke, gusseiserne Schutztür getrennt waren. Wenn die schweren Hebel heruntergezogen und die Tür geschlossen war, kam ich mir immer wie eingesargt vor. Zu meinen Alpträumen als Achtjähriger gehörte die Vorstellung: Das Haus brennt, die Tür klemmt, und wir bringen die eisernen Schließhebel nicht hoch.
So gegen drei Uhr wurde es hell. »Leuchtschirme« brannten am Himmel, in der Luft aufgehängt von feindlichen Fliegern, die das Gelände taghell erleuchteten, um ihre tödliche Luftfracht zielgenauer abladen zu können. Ihr Licht drang durch das vergitterte Fenster, durch das wir den taghellen Nachthimmel beobachten konnten. Jetzt ballerte auch die Flak los. Sie war gegenüber auf den Dächern der Opelwerke postiert. Ohrenbetäubender Lärm. Scheinwerfer suchten den Himmel ab, und die Flugzeuge zogen abenteuerliche Bahnen am Himmel, um dem Fadenkreuz der Flak zu entkommen. Meine Mutter betete für die feindlichen Piloten.
Dann das erste Heulen abgeworfener Bomben, gefolgt vom Krachen der Explosionen. Jedes Krachen war ein Lebenszeichen. Denn dann wussten wir, dass wir nicht getroffen worden waren. Die Erleichterung dauerte nur Sekundenbruchteile. Dann folgte schon das nächste Heulen, von dem wir nicht wussten, ob wir das dazugehörige Krachen noch hören konnten. Schon eine der ersten von diesen tödlichen Dingern war in der Nähe eingeschlagen. Wir wussten nicht genau, wo es eingeschlagen hatte – in unser Haus oder in das des Nachbarn, in dem mein Freund Karl Zimmermann wohnte?
Qualm erfüllte unseren Raum. Mutter legte Hans-Peter eine Mullbinde vor den Mund und sagte leise und langsam zu mir: »Wir müssen gehen.« Sie sagte es so, als ginge ein Besuch zu Ende. Meine kleine, zierliche Mama hatte starke Nerven.
Gott sei Dank: Die Türhebel gaben nach. Ich drückte sie nach oben, und die schwere Eisentür öffnete sich widerstandslos.
Die obere Kellertür aus Eichenholz aber, die ins Treppenhaus führte und die ich nie als Problemtür erwartet hatte, war gesplittert und ein unüberwindliches Hindernis. Wir waren eingesperrt.
Ich hörte Flammen knistern, der Qualm wurde stärker. Alles war erleuchtet, die Wände nahmen einen rötlichen Schimmer an. Mutter rief um Hilfe, noch immer ohne Katastrophentremolo in der Stimme, aber in regelmäßigen Abständen.
Ich hielt das Luftschutzköfferchen in den Händen, Mutter Hans-Peter in den Armen.
Ein Wachmann vom gegenüberliegenden Hauptportal der Opelwerke hörte Mutter rufen, rannte mit einem Beil durch den Bombenhagel und schlug unsere schöne, teure Kellertür aus Eichenholz mit wenigen Hieben entzwei. Wir waren befreit und standen im Hausflur. Die Haustür war weggeflogen. Draußen auf der Straße sah ich Trümmer zersprengte Fensterrahmen, Glas und Steine, viele Steine.
Die Flak hatte ihre Abwehr eingestellt. Die Brandbomben, jede mit Phosphor gefüllt, zischten weiter durch die Luft. Mutter sagte ruhig: »Rüber in den Opel-Keller.« Ich blieb stehen. Ich konnte doch nicht ohne Mama und Hans-Peter laufen und die beiden auch nicht ohne mich. Also standen wir reglos in der zerstörten Haustür.
»Lauf, Norbert, lauf!«, sagte Mutter. Ich hatte Angst.
Von überall her flogen Steine durch die Luft. Der Motorenlärm der Bomber dröhnte noch immer über uns. Es war mir, als sollte ich von einem hohen Turm ins Ungewisse springen. »Los, lauf, lauf!«, Mutter gab mir einen Schubs mit dem Knie. Die Hände brauchte sie schließlich für Hans-Peter. Ich rannte los. Sie hinter mir, dreißig Schritte. Nach zehn wäre ich gerne umgekehrt. Es knallte ganz in meiner Nähe. »Lauf, Norbert, lauf!«, rief sie hinter mir. Diesmal allerdings nicht ruhig und leise, sondern schrill, hart und laut. Ich musste weiter, stolperte über Bretter und Steine – und war in Sekunden nach dem Start vor unserer Haustür und dreißig Schritte später unter dem schützenden Dach des Hauptportals der Firma Adam Opel AG.
Es steht noch heute dort, wo es damals stand, unverändert, als hätte es nie etwas von unseren Aufregungen miterlebt.
Ein Feuerwehrmann brachte uns in den Opel-Luftschutzraum. Dort hockte eng beieinander auf Kisten und Bänken schon ein Klumpen Leute. Keiner sprach ein Wort.
Mutter machte sich eine Hand frei und streichelte mir über den Kopf. Wir waren gerettet: Mama, Hans-Peter, ich und mein Luftschutzköfferchen.
Die dreißig Schritte zwischen der Haustür der Deutschen Bank und dem Hauptportal der Adam Opel AG waren die längste Wanderung, die ich je erlebt habe, und nie habe ich das Ziel einer Wanderung heißer ersehnt als das Opel-Hauptportal.
Viele Wanderungen über Tage und durch Nächte habe ich längst vergessen. Diese dreißig Schritte aber trage ich wie einen Film in meinem Kopf. Kein Schritt ist vergessen.
2. Im Lager von Idomeni
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten.
Das sorglose Wort ist töricht.
Eine glatte Stirn deutet auf Unempfindlichkeit hin.
Der Lachende hat die furchtbare Nachricht nur
noch nicht empfangen.
(Bert Brecht: An die Nachgeborenen)
Als es Nacht wird in Idomeni, ist es dort, wo mein Zelt unter tausenden steht, stockfinster. Nur über den Zelten am Bahngleis brennt Licht. Es sind die Zelte, die bis nahe an die Bahnschienen reichen. Sie stehen auf Schotter, auf dem das Wasser leichter abfließt.
Die Feuer an den Zelten sind erloschen. Feuer, die nicht von selbst ausgingen, erstickte der strömende Regen. Es stinken nur noch die giftigen Dämpfe von Kunststofffolien, mit denen das nasse Holz entzündet worden war.
In den Zelten wird noch lange geredet. Kinderstimmen mittendrin. Schließlich ist Reden das einzige, was Flüchtlinge hier noch unbegrenzt tun können. Fortgehen jedenfalls können sie nicht. Spät, ganz spät wird es still. Der Schlaf senkt sich über das Elendsquartier. Aber wer kann hier schon schlafen? Ich nicht. Es ist kalt in meinem Zelt, der Boden nass und die Zeltwände feucht. Je weiter die Nacht fortschreitet, umso lauter klingt ein Konzert aus Husten, Räuspern und Kinderweinen, manche wimmern nur. Es ist eine Sinfonie des Grauens. Schräg hinter mir, drei Zelte weiter, liegen eine Mutter und deren fünf Tage altes Kind. Zwei Tage hatten Mama und Kind im überfüllten Krankenhaus ein Dach über dem Kopf und ein warmes Bett gefunden. Jetzt liegen sie wieder auf Schlamm im nassen Zelt. Wie soll das Kind heißen? Suleika. Habe ich richtig gehört? Suleika, der Name der schönen Geliebten, die der siebzigjährige altersmüde und liebesverletzte Goethe im West-östlichen Divan besang. Goethes Suleika ist jetzt nur eine poetische Reminiszenz. Die reale liegt im Schlamm.
Doch ich muss die Nacht hinter mich bringen, da hilft keine Lyrik. Wann hört der Regen endlich auf, gegen mein Zeltdach zu trommeln? Ich luge kurz aus dem Eingang: Nacht und nur Nacht! »Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!« Und irgendwann fällt mir zu Brechts »Brief an die Nachgeborenen« noch die Zeile ein: »Zufällig bin ich verschont. (Wenn mein Glück aussetzt, bin ich verloren.)«
Wir verwöhnten Wohlstandsbürger fühlen uns von Flüchtlingen bedroht, die gar nicht gegen uns kämpfen, sondern um ihr Überleben. Tausend Kilometer nördlich liegen meine Landsleute jetzt im warmen Bett, und keiner von ihnen hat bis jetzt für die Flüchtlinge auch nur ein Jota seines Besitzstandes abgeben müssen. Um mich herum liegen die Unbehausten im Dreck auf dem nackten Boden. Ich nur eine Nacht. Sie seit Tagen und Wochen. Wie lange noch? Lasst die »Mühseligen und Beladenen« zu uns kommen, bevor Seuchen die Toten abholen.
Der neue Ostblock
Orbán, der ungarische Türschließer, wird vielleicht gerade von seinen Anhängern ob seiner Härte gegen die Flüchtlinge in einer Vorstandssitzung seiner Partei gefeiert. Der österreichische Bundeskanzler, sein sozialdemokratischer Kompagnon, küsst jetzt vielleicht gerade der gnädigen Frau des Herrn Geheimrates die Hand. Die Frau Innenministerin, meine Parteifreundin von der ÖVP, Schwesterpartei der CDU, verlässt gerade die Wiener Staatsoper. Die eine ist so wenig christlich wie der andere sozial: allesamt Typen aus der Eiszeit. Die Polen kenne ich noch aus Zeiten, in der es ihr sehnlichster Wunsch war, den Eisernen Vorhang zu durchbrechen, um Schutz unter dem Dach des freien Europa zu finden. Europa war geistig-kulturell Heimat, Teil der eigenen polnischen Identität. Jetzt sind sie in Europa, sahnen die europäischen Subventionen ab und sperren Menschen aus, die, wie einst sie, dem Unrecht und der Lebensgefahr entrinnen wollen: Die polnische Regierung besteht aus gottvergessenen Trittbrettfahrern Europas.
Den Stacheldraht, der Mazedonien vor den Flüchtlingen in Idomeni abschirmt, sollen die Österreicher geliefert haben. Der Draht ist von hoher Qualität und fester Stabilität. Europa muss offenbar an der mazedonischen Grenze vor den Hunnen geschützt werden. Doch die hier nach drüben wollen, sind 12.000 Flüchtlinge, darunter 5.000 frierende Kinder.
Die Nachfahren der alten K.-u.-k.-Monarchie bilden unter Führung von Österreich/Ungarn den neuen Ostblock.
»Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten.«
Wenn das Mittelalter eine finstere Zeit gewesen sein soll, wie man mir in der Schule beigebracht hat, dann leben wir jetzt in einer rabenschwarzen Nacht.
Wir sind stolz auf Astronauten, die auf dem Mond gelandet sind, und sind gleichzeitig unfähig, dafür zu sorgen, dass Flüchtlinge sich auf der Erde in einer sicheren Zuflucht niederlassen können. Von den Neandertalern unterscheiden wir uns anscheinend nur dadurch, dass wir die Felle abgelegt haben und Wärme aus der Steckdose beziehen.
Hiob in Idomeni
Während ich dies schreibe, geht mir jener Vater mit seinen zwei kleinen Kindern durch den Kopf, der den beiden Buben mit Wasser aus einer alten Büchse die Rotznasen wusch. Er hatte es schwer mit dem Waschen. Nicht, weil die Kinder wie alle Kinder, das Waschen nicht sehr schätzten, sondern weil ihm die rechte Hand fehlte. Die Barbaren des Islamischen Staats haben sie ihm abgehackt, weil er zuvor als Rechtsanwalt mit dieser Hand Schriftstücke für Ungläubige angefertigt hatte. Mit Frau und Kindern ist er Hals über Kopf abgehauen. Die letzten Kostbarkeiten hat er unterwegs verscherbelt, um den Schlepper bezahlen zu können. Ein Schlauchboot sollte sie übers Meer bringen. Was als Rettung gedacht war, erwies sich als Untergang. Das Schlauchboot kenterte. Die Mutter wurde von der griechischen Marine gerettet, der Vater mit den Kindern von der türkischen. Die Griechen ließen die Frau laufen. Sie ist jetzt in Deutschland. Der Vater wurde in der Türkei festgesetzt. Er entkam mit den Kindern und sitzt jetzt an der mazedonischen Grenze fest.
Und der Ostblock hat seine Ruhe.
Gottseidank besitzt der Mann ein Handy. Ladestationen haben die Hilfsorganisationen aufgestellt. Und so telefonieren Vater und Kinder mit Mama:
»Mama, wo bist du?«
»Wann kommt ihr?«
»Bald, bald.«
Das ist die Endlosschleife ihrer täglichen Sehnsuchts-Gespräche. Der Vater sieht uralt aus. Der Gram hat ihn gebeugt. Ich hielt ihn zuerst für den Großvater der Kinder. Er ist aber der Vater. Wie Hiob sitzt er zusammengesunken wie ein Häuflein Elend vor mir und weint hemmungslos. Mir verschlägt’s die Sprache, und ich schäme mich für die, welche verhindern, dass Familien zusammenkommen, und das erst recht, wenn diese in Not und Bedrängnis sind.
»Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten.«
Die europäischen Kleinkrämer
28 ausgewachsene europäische Staatschefs saßen vor einiger Zeit zwei Tage und zwei Nächte zusammen und berieten, wie sie die Briten bei Laune halten können, auf dass diese nicht die Europäische Union verlassen. Der Preis für diese weltgeschichtliche Frage war, dass den Briten erlaubt wurde, Sozialleistungen für Flüchtlinge zu kürzen. Ob vier oder sieben Jahre, dieser Punkt war zu guter Letzt der seidene Faden, an dem das Schicksal des ruhmreichen britischen Empire hing. Derweil ertranken im Mittelmeer tausende von Menschen. Und der Kuhhandel mit den Briten hat den Brexit auch nicht verhindert.
Die Proportionalität der europäischen Entscheidungsalternativen entspricht bisweilen ungefähr der Frage, ob, während der Dachstuhl schon brennt, der tropfende Wasserhahn im Badezimmer der Belle Etage repariert werden muss.
Die Uhr tickt
Erkältung, Lungenentzündung und Traumata sind die hauptsächlichen Krankheiten der Flüchtlinge in Idomeni, berichten die »Ärzte ohne Grenzen«, die hier lebensrettenden Dienst tun. Ohne sie und die vielen Helfer, von denen wir uns eine Scheibe abschneiden können, würde hier das Chaos ausbrechen. Von Europa ist hier nicht viel zu sehen.
Aber lange geht das nicht gut. Wann bricht Typhus, wann Cholera aus?
Wie schlimm muss die Situation in der Heimat der Flüchtlinge gewesen sein, dass sie riskieren, den Tod in der Fremde der Rückkehr in die Heimat vorzuziehen?
Der irrationale Ausbruch von Flüchtlingen aus Idomeni über einen reißenden Fluss, wenige Tage nach meinem Besuch, war eine Verzweiflungstat bar jeder Erfolgsaussicht. In der Verzweiflung handelt man eben selten vernünftig.
In langen Warteschlangen stehen die Flüchtlinge schon vor der Essensausgabe. Ein Croissant ist die Morgenration. Ein kleiner abgestempelter Zettel ist das Berechtigungsformular. Ein Zettel pro Person und Mahlzeit.
Ich habe die Verteilaktion längere Zeit aus der Nähe beobachtet. Die hilfesuchenden Augen der Kinder, die um Zugabe bettelten, brechen einem beinah das Herz, dem Verteiler auch. Er war im ständigen Kampf zwischen vorschriftsmäßig (es muss schließlich für alle reichen) und großzügig. Und immer, wenn er eine Bitte grob abgeschlagen hatte, huschte ein schmerzliches Zucken über sein Gesicht. Ab und zu jedoch erlaubte sich der Verteiler eine Unregelmäßigkeit und gab unvorschriftsmäßig ein Croissant mehr. Und dann war sogar manchmal ein kurzes ungewolltes Aufatmen der Erleichterung von dem schweigenden Mann zu hören. Mehr nicht. Auch von dem beglückten Kind kam kein Wort. Siegesgeheul hätte schließlich den Regelverstoß verraten. Wusste das Kind überhaupt, ob die Großzügigkeit Versehen oder Absicht des Verteilers war?
Es ist ein harter Job, hier gut zu sein. Ich habe große Achtung vor den vielen jungen Leuten, die hier uneigennützig helfen und dabei noch einen fröhlichen Eindruck machen. Offenbar macht Nächstenliebe froher als Egoismus. Was ich hier tue, überhaupt zu suchen habe, frage ich mich ab und zu. Bin ich nur ein neugieriger Tourist, der das Elend besichtigt wie Zoobesucher exotische Tiere? Ich will nur Nachricht geben von den Verzweifelten.
Ich lerne auf meine alten Tage immer noch dazu. Damals im Kosovokrieg übernachtete ich auch bei den Flüchtlingen. Dort waren Flucht und Hoffnung auf Rückkehr in die Heimat miteinander verbunden. Die Flüchtlinge in Idomeni dagegen haben die Hoffnung auf Heimkehr aufgegeben, sie sind angewiesen auf unseren »guten Willen«, ihnen Heimstatt zu geben. Es ist das Letzte, auf das sie hoffen. Vergeblich?
Der Morgen in Idomeni
Als der Morgen über Idomeni dämmert, bereite ich mich seelisch und körperlich auf den Ausstieg aus meinem Nachtquartier, dem Zelt, vor. Das ist leichter gesagt als getan. Es schüttet inzwischen in Strömen. Vor dem Zelt hat sich die abendliche Pfütze in eine große Wasserlache verwandelt, die das Zeug zu einem kleinen Binnensee in sich hat. Meine vom Schlamm bedeckten Schuhe stehen unter dem ausgespannten Vordach des Zeltes auf dem schlammigen Lehmboden. Ich liege drinnen auf der Isomatte auf dem noch sauberen Boden. Aufstehen kann ich nicht, jedenfalls nicht ohne Weiteres. Das Zelt ist zu niedrig. In den Schlamm draußen treten, in dem die Schuhe stehen, geht auch nicht, und die Schuhe kann ich auch nicht ins Zelt holen. Der Schlamm würde den Gebrauch des Zeltes für den Nachnutzer stark einschränken. Das nennt man ein Dilemma.
Was tun? Wie komme ich in die Schuhe, das ist ein Projekt, das höchste intellektuelle Anstrengung und artistischer Gelenkigkeit der Glieder bedarf. Nachdem ich mehrmals den Kampf mit der Anziehungskraft der Erde verloren habe und auf den Zeltboden zurückgeplumpst bin, was ungewollt nicht ohne Geräusche geschehen konnte, hat sich, durch mein Stöhnen und Schimpfen angelockt, außerhalb vor dem Zelt schon ein Einsatzkommando eingefunden. Die Retter öffneten das Zelt, schoben einen Stuhl, den sie scheinbar aus dem Nichts herbeigezaubert hatten, vor das Zelt und zerrten mich unter Johlen und Jauchzen der Kinder aus dem Zelt und auf den Stuhl, wo ich meine Schuhe in großer Gelassenheit anzog. Jetzt kam ein stämmiger Nachbar herbeigeeilt. Er habe, wie er mir später erzählte, ein großes Mobilfunkgeschäft in Mossul besessen, das ihm der Islamische Staat kurz- und kleingeschlagen habe. Dabei sei sein Vater umgebracht worden. Er hob meinen Arm wie der Ringrichter nach dem Boxkampf den des Siegers und hielt eine laute Ansprache, die seine Frau simultan ins Englische übersetzte. Immer mehr Menschen kamen zwischen den Zelten herangestampft. Mein Ringrichter schloss unter lautem Beifall: »Wo sind eigentlich unsere arabischen Brüder, die zu uns kommen, um sich um uns zu kümmern?«
Das Lachen bricht ab, es wird still. Einer nach dem anderen umarmt mich und geht davon. So lasse ich sie zurück. Sie bleiben hier und ich geh heim in mein gemachtes Bett. Ich schäme mich.
Anders als Henryk M. Broder in der WELT haben die Flüchtlinge von Idomeni mein »Da-Sein« nicht als Show empfunden, sondern als Zeichen dafür, dass sie nicht vergessen sind. Dass jemand das »Dasein« mit einem anderen teilt, ist vielleicht der eigentliche Sinn von Solidarität. Ich stelle mir Broder vor, wie er seinen Spott über mich in einem schicken Café niederschreibt, wahrscheinlich in der linken Hand einen Cappuccino (oder war’s ein Prosecco?), in der rechten seinen Stift, mit dem er seinen giftigen Zynismus zu Papier bringt.
Die Klugscheißer
Mir stehen die Leute von Idomeni näher als die Klugscheißer in Deutschland. Die Flüchtlinge bleiben mir in Erinnerung als freundliche Menschen, die ihre Freundlichkeit in höchster Not bewahrten. Sie setzen alle Hoffnung auf Deutschland. Wir Deutsche waren einmal ein Schrecken der Menschheit. Unser Name war verbunden mit Rassenwahn und Massenmorden. Dass wir plötzlich in der Welt als ein Land der Menschenfreundlichkeit gesehen werden, freut mich. Ich bin auf mein Land stolz, wenn es sich seine Freundlichkeit von niemandem ausreden lässt, auch nicht von der AfD.
Tausende von Helfern sind das beste Mitbringsel, das wir in die Globalisierung einbringen.
Abschied mit Traurigkeit
Der Abschied fällt mir schwer. Ich lasse die Frierenden und Verzweifelten zurück. Fast komme ich mir vor wie ein Fahnenflüchtiger. Der Mutter mit dem Neugeborenen gebe ich noch meine Taschenlampe, die mir meine Frau mitgegeben hatte. Die junge Mutter strahlt, jetzt hat sie ein Licht in der Nacht und kann nachsehen, wie es ihrer Suleika geht. Was wird aus dem kleinen Mädchen? Wird sie in ein türkisches Lager abgeschoben, womöglich irgendwann nach einem langen, sinnlosen Lagerleben in der Gosse landen? Sie ist ein so schönes Mädchen mit ihren tiefschwarzen Augen, und bestimmt werden ihre Haare so schön wie es die ihres literarischen Vorbildes Suleika waren. Was wird aus den Kindern, denen ich unter großem Gelächter meine Fußballkünste vorführte? Und dem kleinen Mädchen, das im nassen Zelt unter dem Beifall seiner Geschwister vor mir sich lachend im Tanz drehte? Wo werden die Buben landen, die mir beim Zeltaufbau halfen und mir Pappkarton reichten, den sie selber in ihren Zelten zum Abdichten des Bodens benutzt hatten? Keiner hat mich gefragt, was ich mitbringe. Sie waren froh, dass ich da war: das »Da-Sein« teilen.
Wie von Kafka erfunden
Bevor ich zurückfahre, kommt ein regulärer Güterzug in Richtung Mazedonien auf Gleisen angerollt, die mitten durchs Lager führen. Er fährt langsam und tutet unaufhörlich. Die Bewohner der Zelte, die bis ans Gleis herangehen, sollen gewarnt werden. Schließlich erreicht die Diesellok (modernster Bauart) die Gitter des Grenzzauns. Das Tor öffnet sich. Die griechische Polizei tritt zur Seite und die mazedonischen Soldaten, schwerbewaffnet als gelte es eine Invasion abzuwehren, ebenso.
Der Zug fährt unbehindert und vollgeladen mit Gütern über die Grenze. Das Tor wird geschlossen. Die Soldaten nehmen an den vorgesehenen Plätzen ihre bewaffnete Aufstellung. Und die Welt ist wieder in Ordnung.
Der Güterverkehr ist ungebremst, das Geldgeschäft grenzenlos. Das Kapital umkreist ungehindert und in Windeseile den Globus auf der Datenautobahn. Nur die Flüchtlinge im Elend bleiben im Dreck stecken.
Kafka hätte selbst mit seiner makabren Fantasie kein ausdrucksvolleres Symbol für den Irrsinn der Welt finden können.
Idomeni ist ein Symbol.
Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten.
3. Die Sklaven von Katar
Vier Tage war ich mit »Stern TV« in Katar, dem Land, in dem nach dem Willen der Fifa die Fußballweltmeisterschaft stattfinden soll. Wir hatten keine Drehgenehmigung und haben dennoch gefilmt. Warum mussten wir unsere Kamera verstecken? Warum verbot Katar uns Filmaufnahmen? Wer Dreck am Stecken hat, bedarf offenbar der Drehverbote, damit nicht ans Licht kommt, was verheimlicht werden soll.
Was ich mit eigenen Augen gesehen und mit meinen Ohren gehört habe, reicht mir. Katar ist ein Sklavenhalter-Staat. Und die große Fifa steht Schmiere. Katar ist ein Staat, der auf Ausbeutung gebaut ist. Geld quillt, wie Gas aus dem Sand Katars strömt. Die Katarer haben das höchste Pro-Kopf-Einkommen der Welt. Als »Köpfe« zählen dabei allerdings nur die Köpfe der 300.000 Einheimischen. Die 2,4 Millionen »Gastarbeiter« sind in dieser Statistik nicht enthalten. Die »fremden Arbeiter« sind jedoch nicht Gäste, sondern Sklaven. Sie werden geschunden und ausgebeutet.
Ausbeutung pur
Von Schleppern, die sich Vermittlungsagenten nennen, werden die Arbeiter ins Land geholt. Wieso erregen wir uns nur über Schlepperbanden im Mittelmeer? Unter dem Dach der von der Fifa organisierten Weltmeisterschaft agieren Schlepperbanden als Sklavenvermittler. Die Fifa kümmert sich jedenfalls nicht darum, wie das »Menschenmaterial Arbeitskraft« angeliefert wird. Hauptsache, die Stadien stehen, wenn gespielt wird. Der »Schlepperpreis« ist ungefähr so hoch wie der Arbeiterlohn eines Jahres. Erst wenn die »Vermittlungsgebühr« gezahlt ist, beginnt also für die Arbeiter die Zeit ihres »freiverfügbaren« Einkommens. Erst einmal ein Jahr arbeiten sie für die »Menschenhändler«. Von dem Hungerlohn bleiben danach monatlich ungefähr 200 Euro dem Bauarbeiter übrig, nachdem er zuvor 100 Euro für die zurückgelassene Familie in die Heimat geschickt hat.
Mit einer unsichtbaren Fußfessel sind die Arbeiter an ihre Baustelle gekettet. Man hat ihnen nach der Ankunft die Pässe abgenommen, damit sie nicht abhauen können. Es gibt kein Entrinnen. Selbst nach der jüngsten Erdbebenkatastrophe, als die Nepalesen aus der Heimat Hilferufe erreichten, gab es kein Zurück. Erst in ein paar Jahren, wenn sie ausgelaugt und erschöpft sind, werden sie, sozusagen als Leergut, in die Heimat zurückgeschickt. Heimat ist dann nur noch Entsorgungsstation.