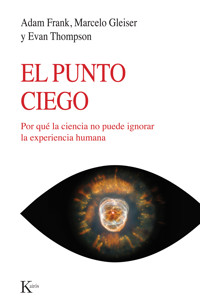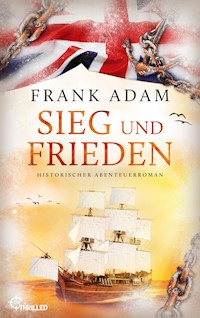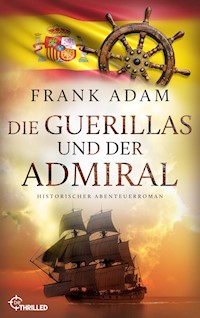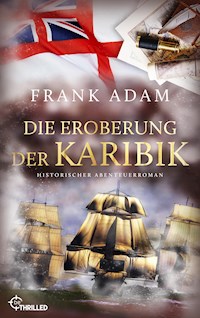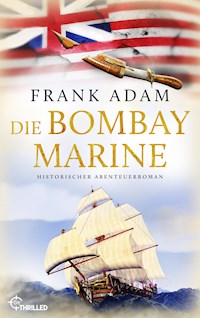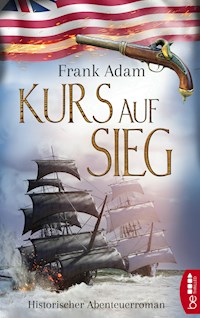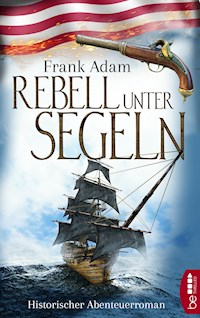
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Sven Larsson-Reihe
- Sprache: Deutsch
Der Auftakt der großen Seefahrersaga über die Anfänge der amerikanischen Marine
Im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg segelt Sven Larsson auf Kaperschiffen der Neuen Welt. Mit der kleinen, unterlegenen Flotte der jungen Nation tritt er den Kampf gegen die erfahrene Seestreitmacht England an und muss sich vielen Gefahren stellen. Als er zum Kapitän ernannt wird, erwartet ihn die größte Herausforderung seines Lebens: Von seinem Bestehen hängt das Schicksal einer ganzen Nation ab ...
Frank Adam gilt vielen als der Meister des historischen Seefahrerromans. Die Abenteuer von Sven Larsson sind die ideale Lektüre für alle Fans von Patrick O’Brian, C.S. Forester, Julian Stockwin und Sean Thomas Russell.
Band 2: Unter der Flagge der Freiheit.
eBooks von beTHRILLED - mörderisch gute Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Weitere Titel des Autors
Die Abenteuer von Sven Larsson:
Unter der Flagge der Freiheit
Kurs auf Sieg
Auf zu neuen Horizonten
Über dieses Buch
Der Auftakt der großen Seefahrersaga über die Anfänge der amerikanischen Marine
Im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg segelt Sven Larsson auf Kaperschiffen der Neuen Welt. Mit der kleinen, unterlegenen Flotte der jungen Nation tritt er den Kampf gegen die erfahrene Seestreitmacht England an und muss sich vielen Gefahren stellen. Als er zum Kapitän ernannt wird, erwartet ihn die größte Herausforderung seines Lebens: Von seinem Bestehen hängt das Schicksal einer ganzen Nation ab ...
eBooks von beTHRILLED – mörderisch gute Unterhaltung.
Über den Autor
Frank Adam ist das Pseudonym von Prof. Dr. Karlheinz Ingenkamp (1925-2015). Er hat u.a. Geschichte und Psychologie studiert und als Erziehungswissenschaftler ein bekanntes Forschungsinstitut geleitet. Im Ruhestand wandte er sich seinem Hobby, der Geschichte der britischen Flotte, zu, und hat erfolgreich zwei Reihen historischer Seekriegs-Romane geschrieben: Die Abenteuer des David Winter und Sven Larssons Erlebnisse im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Neben den seehistorischen Romanen hat er marinegeschichtliche Aufsätze und Bücher verfasst, darunter auch das 1998 erschienene deutschsprachige Standardwerk über die britische Flotte mit dem Titel »Herrscherin der Meere«.
Frank Adam
Rebell unter Segeln
Historischer Abenteuerroman
beTHRILLED
Digitale Neuausgabe
»be« – Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Copyright © 2007 by Bastei Lübbe AG, KölnG
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2020 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Rainer Delfs/Jan Wielpütz
Covergestaltung: Guter Punkt, München unter Verwendung von Motiven von © AdobeStock/ denissimonov; AdobeStock/ createddd; AdobeStock/ Gregory
eBook-Erstellung: le-tex publishing services GmbH, Leipzig
ISBN 978-3-7325-9841-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Inhalt
Vorwort
Hinweise für marinehistorisch orientierte Leser
Verzeichnis der Abbildungen
Personenverzeichnis
Der weite Weg zur See (September 1763–März 1770)
Die erste Reise mit der Victoria (Mai 1770–August 1770)
Abenteuer unter Segeln (September 1770–Dezember 1773)
Im Dienst des Tyrannen (Dezember 1773–Dezember 1774)
Der Kampf beginnt (Januar–Juni 1775)
Heißt Flagge! (Juni 1775–April 1776)
Auf Kaperkurs (Mai–Juli 1776)
Der erste Salut (Juli–Dezember 1776)
Glossar
Vorwort
Die erste Frank-Adam-Serie um die Erlebnisse David Winters in der britischen Flotte hat viele interessierte Leser gefunden. Diese Serie ist mit dem vierzehnten Band »Sieg und Frieden« beendet worden, der bei Bertelsmann 2004 und bei Bastei 2006 erschien.
Ich lege nun den ersten Band der »Sven-Larsson-Serie« vor, der die Abenteuer eines jungen Deutsch-Schweden auf amerikanischen Schiffen schildert, als die Kolonien um ihre Unabhängigkeit rangen. Die Anfänge der amerikanischen Flotte sind vielfältiger, ungeregelter und komplexer als die Strukturen der britischen Flotte zur gleichen Zeit.
Die dreizehn Kolonien selbst waren ja völlig uneinheitlich. Von den älteren Siedlungen an der Atlantikküste, die an Einwohnerzahl, Struktur und Handelsverflechtung dem Mutterland recht ähnlich waren, bis zu gerade errichteten Hütten mit frisch gepflügten Äckern im Landesinneren gab es eine Vielzahl von Entwicklungsstadien.
Natürlich hatte dieser staatliche Embryo keine eigene Flotte, als er den Weg in die Unabhängigkeit antrat. Es ist eine faszinierende Geschichte, wie aus dem Nichts heraus der Kampf mit der größten und kriegserfahrensten Flotte der Welt aufgenommen wurde. Ich erzähle die Geschichte des Sven Larsson, wie ich es bei David Winter versucht habe: möglichst historisch genau, anschaulich und ohne literarische Profilierungsversuche.
Mir hat die Arbeit am Roman viel Freude gemacht. Für mich ist die Geschichte der Schifffahrt in dieser Zeit so ereignisreich, farbig und fesselnd, dass ich mir kaum ein interessanteres Feld für das eigene Studium denken kann. Ich habe wieder Herrn Rainer Delfs, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Universitätsbibliothek in Landau, Herrn Dr. Sauer, Leiter der Bibliothek des Deutschen Schifffahrtsmuseums in Bremerhaven, und Herrn Professor Dr. John B. Hattendorf vom Naval War College in Newport, Rhode Island, für Rat und Hilfe zu danken.
Ich hoffe, dass ich die Leser wieder gut unterhalten und informieren kann.
Frank Adam
Hinweise fürmarinehistorischinteressierte Leser
Zur Information über Schiffe, Waffen und Besatzungen der britischen und anderen Flotten dieser Zeit verweise ich auf mein Buch mit zahlreichen Abbildungen und Literaturangaben:
Adam, F.: Herrscherin der Meere. Die britische Flotte zur Zeit Nelsons. Hamburg: Koehler 1998
Über die britischen Kolonien in Amerika und ihr Ringen um Unabhängigkeit findet der Leser unserer Zeit viele Hinweise im Internet. In der gedruckten Literatur verweise ich auf folgende Einführungen:
Earle, Alice Morse: Home Life in Colonial Days. Stockbridge, Mass.: Berkshire Traveller Press 1974
Gipson, Lawrence Henry: The Coming of the Revolution, 1763–1775. New York: Harper and Row 1962
Zum maritimen Aspekt nenne ich aus der Fülle nur folgende Werke:
Das Standardwerk:
William Bell Clark et al.(Hrsg.): Naval Documents of the American Revolution. Naval Historical Center, Department of the Navy, Washington 1986 ff.
Zum Einstieg in das Thema kann man sich informieren bei:
Coggins, Jack: Ships and Seamen of the American Revolution. Harrisburg: Promotory Press 1969
Gardiner, Robert (Hrsg.): Navies and the American Revolution 1775–1783. London: Chatham Publishing 1996
Viele Details führt folgende Dissertation an:
Paulin, Charles Oscar: The Navy of the American Revolution. New York: Haskell House 1971
Verzeichnis derAbbildungen
Pennsylvania
Philadelphia und Umgebung
Die Karibik um 1790
Die dreizehn Kolonien
Bahamas, New Providence
Personenverzeichnis
Familie:
Sven Larsson, geb. 16.9.1753
Einar Larsson, Vater
Astrid Larsson, Mutter
Ingrid Larsson, Schwester
Ingmar Larsson, Großvater
Gudrun Larsson, Großmutter
Björn Larsson, Onkel
Christine Larsson, Tante
Lisbeth Larsson, Cousine
Freundeskreis der Larssons:
Dr. Edgar Wilbur, Arzt
Sabrina Wilbur, seine Tochter
William Bradwick, Reeder
Besatzung der Victoria:
Martin Preston, Kapitän
Ronald Walker, Obersteuermann
John Cliff, Bootsmann
Ben Margot, Untersteuermann
Adam Borg, Matrose
Abraham, Smutje
Jonny, Matrose fast ohne Zähne
Karl Bauer, Matrose
Robert, Steuermannsmaat
Joshua Petrus, Matrose
Besatzung der Fregatte Zeus:
William Egg, Kapitän
Rodger Norman, Erster Leutnant
John Aires, Zweiter Leutnant
David Hunter, Dritter Leutnant
Henry Sage, Schiffsarzt
Richard Berger, Master
Samuel Vox, Leutnant der Seesoldaten
Besatzung der Sloop Eagle:
Rodger Norman, Commander
Oscar Duncan, Erster Leutnant
Henry William, Zweiter Leutnant der Seesoldaten
David McGull, Schiffsarzt
John Allen, Master
Besatzung des Schoners Freedom:
Sven Larsson, Kapitän
William Selberg, Obersteuermann
Karl Bauer, Untersteuermann
Adam Borg, Bootsmann
Martin, Svens Bursche
Joshua Petrus, Maat
Paul Bird, Maat
Jonathan Walsch, Maat und Sanitäter
Will Crowton, Matrose
Bob Milber, Matrose
Billy Walton, Schiffsjunge
Ingmar Borgsson, Schiffsjunge
Norman Gordon, Passagier
Der weite Weg zur See (September 1763–März 1770)
Eine Frau trat aus der Tür des Blockhauses und sah sich um. Sie sog die Luft ein, und ein tiefes Glücksgefühl erfüllte sie. Alles war so schön, so friedlich. Vor der Hütte mühte sich ein kleines Mädchen ab, Zinnteller auf dem Tisch zu ordnen, den ihr Kopf kaum überragte. Die Kleine spürte den Blick der Mutter und lächelte sie an.
Es war gleich Mittagszeit. Die Sonne stand hoch über dem Tal, an dessen Rändern dunkle Wälder aufragten. Hügel begrenzten den Blick, und an einer Seite ragte in der Ferne ein hoher, spitzer Berg auf.
Ein breiter Bach murmelte durch das Tal. Der Junge, der an seinem Ufer einen Holzzuber mit Wasser gefüllt hatte, winkte der Frau in der Tür zu und ging zum Haus zurück.
Neben dem Blockhaus mit den dicken, grob behauenen Stämmen stand ein aus Brettern gebauter Stall. Ein Pferd weidete in einer Koppel. Hühner pickten vor dem Stall.
Plötzlich hörten alle den Knall aus der Richtung des spitzen Berges. »Was war das, Mutti?«, fragte die Kleine.
»Vielleicht hat Vati was für uns geschossen«, antwortete die Frau beruhigend. Aber sie blickte forschend umher, zu dem Jungen, der jetzt schneller ging, zu den Waldrändern, die nur einige hundert Meter entfernt das Tal einengten, und zu den Vögeln, die dort über dem Waldrand flatterten.
»Mutti!«, rief der Junge und stellte den Holzzuber ab. »Da kommt Dad angeritten wie der Teufel!« Er zeigte in die Richtung des spitzen Berges.
Ein Waldstück versperrte der Frau den Blick. Aber bevor sie ein paar Schritte vortreten konnte, preschte der Reiter um den Waldzipfel. Er winkte und schrie. »Indianer, Indianer!« Und »Fliehen!« hörte die Frau.
Sie zögerte keine Sekunde. »Sven, hol das Pferd! Ingrid, zieh schnell deine Schuhe an!« Und schon verschwand sie im Haus.
Der Junge, ein etwa zehnjähriger Blondschopf, rannte zur Koppel, rief nach dem Pferd und zerrte es am Strick hinter sich her zum Haus. Dort nahm er einen leichten Sattel vom Haken, warf ihn dem Pferd über und schnallte den Gurt fest. Zwischendurch blickte er kurz zu dem Reiter, konnte aber noch keine Verfolger sehen.
»Komm!«, sagte die Frau, die eben mit einem Gewehr und zwei Beuteln aus der Tür trat. »Hol schnell noch Vatis Fluchtbeutel und nimm deine Tasche.« Sie warf dem Pferd die Beutel über, sodass an jeder Seite einer herabhing, dann rief sie das Mädchen, setzte es vorn auf den Sattel, schwang sich selbst dahinter aufs Pferd und war bereit, als der Vater mit seinem Pferd vor dem Blockhaus anhielt.
»Zwei Dutzend Indianer auf dem Kriegspfad! Ohne Lucky hätten sie mich überrascht.« Er blickte kurz auf den Schäferhund, der hechelnd neben dem Pferd stand. »Wir müssen zu den Quäkern am See. Wir können nicht im Haus bleiben. Es sind zu viele. Sven, sitz auf! Los, wir reiten!«
Die Frau sah ihn an, und er wandte den Blick ab. Er war ja selbst verzweifelt und ängstlich. Wie würden sie ihr Haus, ihre Habe wiedersehen? Was würde aus der Kuh und den Schweinen werden? Er seufzte, rief dem Jungen zu, er solle sich festhalten, und gab dem Pferd die Sporen.
»Sie kommen!«, rief der Junge, der sich hinter ihm im Sattel an seinem Körper festhielt. Der Vater wandte kurz den Blick zurück und sah den Trupp Indianer in schnellem Lauf auf sie zueilen. Sie schrien triumphierend.
»Ihr kriegt uns nicht!«, knurrte der Vater und ritt hinter seiner Frau her, die gerade im gegenüberliegenden Wald verschwand.
Der Weg, dem sie folgten, schlängelte sich an den dichten Baumgruppen vorbei und war breit genug, dass auch ein Wagen auf ihm fahren konnte. Hin und wieder sah man auch Radspuren, wenn der Boden weicher war.
Nach einer halben Stunde rief der Mann: »Halt mal kurz an, Astrid! Dein Sattelgurt ist nicht richtig fest!«
Seine Frau zügelte das Pferd und fragte. »Meinst du, dass wir genug Vorsprung haben, Einar?«
»Für den Augenblick schon. Aber du weißt, wie ausdauernd und schnell diese roten Teufel laufen können.«
Sie sah ihn groß an. »Die Lenape, die wir kennen, sind keine Teufel. Von welchem Stamm sind diese denn?«
»Das konnte ich nicht erkennen. Vielleicht von Pontiacs Leuten. Komm, wir müssen weiter.« Er richtete sich wieder auf, tätschelte der Tochter die Hand, gab seiner Frau einen flüchtigen Kuss und bestieg wieder sein Pferd.
»Wann sind wir denn da?«, quengelte die Tochter. »Ich habe Hunger.«
»Da wirst du noch drei Stunden warten müssen. Aber die Anne hat für dich doch immer etwas Süßes. Freu dich drauf!«, tröstete die Mutter, aber sie selbst schien auch des Trostes zu bedürfen.
Die Pferde trabten schnell und gleichmäßig.
Nach weiteren zwei Stunden hielt die Frau ihr Pferd an.
»Astrid, was ist?«, fragte der Mann.
»Wir beiden Frauen müssen mal hinter den Busch, Einar«, sagte sie lächelnd. »Und wir müssten uns auch ein Stück Brot aus dem Sack holen.«
»Na gut. Komm, Sven, dann erleichtern wir uns auch. Der Vorsprung müsste reichen.«
Sie stiegen etwas schwer aus den Sätteln, reckten sich und sahen sich an. »So lange haben wir in Ruhe und Frieden gelebt. Höchstens ein Bär hat uns mal erschreckt. Warum gehen sie jetzt auf den Kriegspfad?«, sagte die Frau ermattet.
»Der Pontiac wird sie aufgehetzt haben. Wir haben es ihnen ja vorgemacht mit dem Krieg zwischen England und Frankreich, und jeder warb Indianer an. Aber nun wollen wir uns beeilen. Erzählen können wir noch bei den Quäkern.«
Der Vater ging hinter einen dicken Baum und öffnete seine Hose. Der Sohn ging auch zu einem Baum, während die Mutter ihre Tochter an der Hand nahm und hinter einem Busch verschwand. »Pass auf, wo du hintrittst!«, mahnte sie noch.
Die Pferde scharrten mit den Hufen. »Sie müssten etwas saufen«, stellte der Vater fest. »Wir kommen ja bald an den kleinen Bach, der zum See fließt.«
Sie wischten sich die Hände an Hosen und Röcken ab, kramten ein paar Brotkanten aus dem Sack und gingen zu den Pferden.
»Vater, schau doch mal«, flüsterte der Junge hastig und zeigte mit dem Finger.
Etwa 800 Meter hinter ihnen liefen Indianer auf eine Lichtung und betrachteten die Fährten am Boden.
»Mein Gott«, stöhnte der Vater. »Warum sind sie nur so hartnäckig. Kommt, wir reiten hier entlang weiter. Dann kürzen wir etwas den Weg ab. Aber leise!«
Sie stiegen auf und ließen die Pferde langsam laufen, bis sie hinter dichtem Unterholz waren. Dann gaben sie ihnen die Sporen.
Die Tochter weinte leise, und die Mutter hatte bei all ihrer eigenen Angst Mühe, sie zu trösten. Dann waren sie am Bach. Der Vater füllte seine Flasche. Die Pferde und der Hund soffen. Dann ging es weiter.
»Bald haben wir es geschafft«, sagte der Vater gerade, als sein Pferd plötzlich mit dem Vorderfuß einbrach und mit schmerzlichem Wiehern stürzte. Vater und Sohn flogen zu Boden. Sie rappelten sich schnell auf, denn das Pferd lag da, schlug mit seinen Hufen um sich und schrie vor Schmerz.
Der Vater griff sein Messer, rief den anderen zu: »Guckt weg!« und schnitt dem Pferd mit kräftigem Schnitt den Hals durch. Das Blut überflutete sein Hemd. Das Pferd starb röchelnd. Die Tochter schrie auf, aber die Mutter hielt ihr schnell den Mund zu.
Sven starrte entsetzt und regungslos.
»Schnell, Sven! Steig hinter Mutti auf den Sattel!«, befahl der Vater leise und entschieden.
Er griff sich sein Gewehr, sein Pulverhorn und seine Flasche. »Astrid! Reite voran, und bring die Kinder in Sicherheit. Ich halte sie auf und schlage mich durch.«
»Ich reite nur mit dir. Halt dich am Sattel fest«, antwortete sie.
»Um Gottes willen, Astrid! Es geht nicht. Ich flehe dich an! Wenn du mich liebst, rette dich und die Kinder. Ihr habt es nicht mehr weit. Aber ihr müsst los! Bitte!«
»Einar, komm uns nach! Bitte!«, weinte die Frau und trieb das Pferd an. Sie spürte Svens Arme, der sie von hinten umarmte. Sie fühlte, wie seine Tränen ihr Kleid netzten. Sie wischte sich schnell die Augen ab, damit sie wenigstens den Weg sehen konnte. »Hör auf zu weinen!«, fuhr sie ihre Tochter an und schluchzte selbst dabei.
Sie sahen schon den Rauch aus den Häusern der Siedlung, als sie hinter sich Schüsse hörten. Sven spürte, wie der Rücken seiner Mutter ganz steif wurde, und die Angst schnürte ihm die Kehle zu.
Und dann winkte ihnen ein Mann vom Feld zu. »He, Astrid Larsson! Was habt ihr?«
»Indianer! Sie verfolgen uns! Indianer auf dem Kriegspfad! Sie schießen auf Einar!«
»Gott sei uns gnädig!«, rief der Mann. »Reitet vor ins Dorf und sagt es allen! Ich laufe hinterher!«
Das »Dorf« waren vier größere Blockhäuser, ein halbes Dutzend Scheunen und Ställe sowie kleine Hütten für Hühner, Koppeln für Pferde und Rindvieh. Die Gebäude lagen dicht am See, der Ontelaunee hieß, nach einem Indianerwort. Ein Steg ragte ins Wasser. Zwei kleine Kanus lagen an ihm.
Als das Pferd sich erschöpft den staubigen Weg zwischen den Hütten entlangschleppte, traten Frauen und Kinder vor die Türen, angelockt durch die Rufe derer, die Astrid und ihre Kinder zuerst gesehen hatten.
»Was ist los, Astrid?«, rief eine kräftige Frau.
»Indianer auf dem Kriegspfad, etwa zwei Dutzend! Sie folgen uns!«
Männer waren vom Feld und aus den Ställen hinzugekommen. Einer rief laut. »Alle in die Häuser! Schließt Fenster und Türen! Bertha, nimm Astrid Larsson und die Kinder zu dir! Haltet die Gewehre bereit, aber keiner schießt! John und Will, kommt mit euren Gewehren zu mir. Wenn die Indianer kommen, will ich mit ihnen reden!«
Bertha half Astrid und den Kindern aus dem Sattel. »Nimm dem Pferd den Sattel ab und bring es zu den anderen!«, rief sie einem Jungen zu und wandte sich gleich darauf an zwei Mädchen: »Schließt schnell die Läden und legt die Balken vor.« Dann griff sie noch nach zwei kleinen Kindern und schob sie mit den Larssons in das Haus.
Sie zündete eine Öllampe an, befahl einem jungen Burschen, die Muskete und die Vogelflinte zu laden, goss selbst drei Becher Tee ein und stellte sie vor Astrid und den Kindern auf den Tisch.
»Möchtest du noch etwas haben, Astrid?«
Svens Mutter schüttelte den Kopf.
»Was ist mit Einar?«, fragte die Frau
Astrid schluchzte und wischte die Augen mit einem Tuch. »Eine halbe Stunde vor dem Dorf trat sein Pferd in einen Fuchsbau oder etwas Ähnliches. Es brach sich den Vorderfuß und stürzte. Einar musste es töten und blieb zurück, um die Indianer aufzuhalten. Er wollte sich zu Fuß durchschlagen. Aber wir haben Schüsse gehört.« Sie schluchzte, und die kleine Ingrid begann zu weinen.
Bertha strich ihr über das Haar. »Gottes Wille geschieht immer und ewig. Wir alle sind seine Kinder. Klagt nicht! Wartet, bis wir seinen Willen erkennen.«
»Da kommt unser Vater zurück!«, meldete der junge Bursche, der mit dem Gewehr hinter der Tür stand.
»Dann lass ihn ein, Albert, und pass weiter auf.«
»Wir haben nichts gesehen«, sagte der Vater. »Aber zunächst einmal entbiete ich euch meinen Gruß, Astrid, Sven und Ingrid. Gott segne euren Eingang. Frau, gib uns ein wenig von dem frischen Brot und etwas Butter. Unsere Gäste werden hungrig sein.«
Astrid brachte nichts herunter, aber Ingrid und Sven merkte man die Gier an, mit der sie aßen.
»Nun, liebe Nachbarin, sagt mir doch, was geschehen ist.«
Astrid Larssons Erzählung wurde immer wieder von Schluchzen unterbrochen. Zum Schluss flehte sie den Mann an: »Ihr müsst nach Einar suchen. Vielleicht liegt er verletzt im Wald.«
»Das können wir jetzt nicht, meine Tochter. Bis wir dort sind und suchen, kommt die Dämmerung. Wenn die Indianer kämpfen wollen, wären wir alle verloren. Morgen früh gehen wir Einar suchen. Möge Gott unsere Wege lenken! Aber sagt mir noch: Hattet Ihr Streit mit den Rothäuten?«
Astrid schüttelte den Kopf. »Nein. Wir leben gut mit den Lenni Lenape in unserer Gegend. Wir haben mit ihnen Dinge getauscht, die wir brauchten. Aber Einar rief mir etwas von Pontiac zu. Ihr habt von ihm gehört?«
Der Mann nickte. »Ja, ein Indianerhäuptling, der die Stämme im Südwesten aufhetzt. Sie haben schon manchen Siedler abgeschlachtet. Aber dass sie nun auch hier sind? Gerade erst vor ein paar Tagen kam ein Trapper vorbei und erzählte, Pontiac sei bei Bushy Run von Colonel Bouquet geschlagen worden. Vielleicht will eine versprengte Bande noch etwas zusammenstehlen, bevor sie sich in die Berge verkriecht.«
Astrid mochte nicht mehr in der Hütte sitzen und reden. Als die Läden wieder geöffnet wurden, bat sie die Gastgeber um Entschuldigung und setzte sich mit ihren beiden Kindern auf eine Bank vor dem Haus. Sie hielten sich fest umschlungen und horchten ängstlich, ob sie etwas vom Vater hörten.
Niemand aus dem Dorf war wieder auf die Felder gegangen. Alle blieben in der Nähe der Häuser. Die Menschen gehörten zur Gemeinschaft der Freunde, die die anderen auch »Quäker« nannten. Ihr Glaube gebot ihnen, friedfertig zu sein und Gutes zu tun. Sie hatten ihr Land den Indianern redlich abgekauft und lebten in Frieden mit ihnen. Nur im Notfall verteidigten sie sich. Angreifen würden sie nie.
Die Larssons waren im Jahr ein- oder zweimal mit ihrem Wagen zu den Quäkern gefahren, hatten ihnen ihre Waren gebracht, hatten getauscht und anderes für die Händler dort gelassen, die die Siedlungen von Zeit zu Zeit bereisten. Man hatte sich respektiert und toleriert. Man lebte schließlich in Pennsylvania, einem Staat, der der Toleranz verpflichtet war.
Astrid wachte am nächsten Morgen früh nach kurzem, unruhigem Schlaf auf. Sie sah den fünf Männern zu, die Pferde sattelten, um nach ihrem Mann zu suchen. Sie hatten Gewehre, aber, wie man dort sagte, ihre schwarze, schlichte und strenge Quäkerkleidung war ein besserer Schutz gegen Indianer als ein Gewehr. Quäker hatten nie gegen den Willen der Ureinwohner Land besiedelt. Sie hatten es immer gekauft und fast immer einen reellen Gegenwert bezahlt. Sie hatten auch von ihrem Wissen abgegeben und ihrerseits von den Indianern gelernt.
Sie grüßten Astrid ernst und ritten davon. Ein halbes Dutzend Hunde folgte ihnen. Den Rest riefen die Frauen des Dorfes zurück.
Sven und Ingrid schliefen noch. Ingrid hatte gestern viel geweint, weil ihr Vater nicht da war, und sie merkte, wie sich ihre Mutter um ihn sorgte. Geholfen hatte ihr wieder die Anne, die mit ihren Zuckerplätzchen kam. Geholfen hatten auch die Mädchen des Dorfes, die ihr neues Spielzeug vorführten, das die Väter aus Holz geschnitzt oder das die Mütter aus Stoffresten genäht hatten.
Als Sven und Ingrid aufwachten, waren die Bewohner des Dorfes schon alle bei der Arbeit. Nur ihre Mutter war im Haus und hatte Brot und Milch für sie.
»Ist Vati gekommen?«, fragte Sven.
Seine Mutter schüttelte traurig den Kopf. »Sie suchen nach ihm. Man hat keine Schüsse gehört. Vielleicht sind die Indianer weg.«
Zwei Stunden später, Astrid hielt es vor Unruhe kaum noch aus, ritten die Männer wieder ins Dorf. Einer trug Einars Leiche vor sich im Sattel. Astrid schrie auf. Bertha umarmte sie.
Der älteste Reiter kam zu ihnen, nahm seinen Hut ab und sagte: »Schwester Astrid, Gott hat euren Mann zu sich genommen. Wir können die Wege des Herrn nicht erforschen, aber wir sind seine Kinder, und der Herr wird auch euren Einar in Liebe annehmen. Betet für ihn!«
Astrid konnte nicht antworten. Sie ging auf die Männer zu, die jetzt behutsam den Körper aus dem Sattel hoben. Einars Gesicht war blutverschmiert, denn die Indianer hatten ihn skalpiert.
»Er hat nichts gespürt«, tröstete sie der Mann. »Zwei Schüsse in die Brust haben ihn getötet. Vorher hat er drei Feinde mindestens schwer verwundet. Wir fanden die Blutlachen. Auch Euer Hund hat ihn bis zuletzt verteidigt. Wir haben ihn im Wald begraben.«
Astrid umarmte den Oberkörper ihres Mannes und wischte sein Gesicht ab.
»Kommt, Astrid«, bat Bertha sie. »Wir legen ihn auf die Bank, verbinden den Kopf und richten ihn her. Morgen werden wir ihn auf unserem Gottesacker bestatten.«
Als sie Einar gesäubert und seinen Kopf verbunden hatten, ließ Astrid auch die Kinder zu ihm. Sie weinten und nahmen Abschied. Sven mühte sich mit aller Kraft, die Tränen zurückzuhalten, und wollte seiner Mutter Trost geben. Er spürte, wie sehr sie litt.
»Warum haben sie Vati getötet? Wir haben ihnen nie etwas getan«, fragte er schluchzend.
»Es waren fremde Indianer, die aus dem Südwesten des Landes fliehen mussten. Sie wurden aufgehetzt, haben gemordet und gebrandschatzt und wurden nun von den Milizen geschlagen. Möge Gott uns allen vergeben.«
Am Abend versammelten sich alle im größten Haus des Dorfes. Frauen und Männer standen dicht gedrängt. Alle trugen ihre einfache schwarze Kleidung ohne die geringste Zier.
Der Dorfälteste sprach: »Unser Herr sagt auch zu unserem Freund Einar Larsson: ›Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöset; ich habe dich bei deinem Namen gerufen; du bist mein. Denn so du durch Wasser gehest, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen; und so du durch Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Heiland.‹ So steht es bei Jesaja. Werdet nun eins in euren Gedanken mit unserem Gott und seinem Kind Einar!«
Sie standen und schwiegen. Einige hatten die Augen geschlossen, andere schauten nach oben, wieder andere hatten die Hand vor die Augen gelegt. Einige bewegten die Lippen, aber niemand sprach. Manchen liefen die Tränen über die Wangen, andere schluchzten leise. Astrid sah, dass einige bebten, wie in Trance. Sie schloss die Augen. Und mit der Zeit wurde sie ruhig und glaubte, ihr Mann sei in Gedanken bei ihr.
»War das ein Gottesdienst?«, fragte Sven leise seine Mutter, als sie in Berthas Haus zurückkamen.
»Ja, Sven. Sie haben zu Ehren deines Vaters gebetet.«
»Aber wo war der Pfarrer? Ihr habt mir doch erzählt, dass im Gottesdienst der Pfarrer predigt und die Gemeinde singt.«
»Die Quäker haben andere Sitten. Sie kennen keinen Pfarrer, keinen Gesang und keine Predigt. Sie beten alle stumm. Sie vereinigen ihre Gedanken mit Gott. Du hast schon gehört, dass sie sich selbst ›Gemeinschaft der Freunde‹ nennen. Sie lehnen jeden Prunk ab. Sie wollen Gutes tun. Sie wirken manchmal etwas, na ja, verschroben, aber wir haben sie nur als gute und hilfsbereite Menschen kennen gelernt.«
Der kleine Friedhof der Quäker war sehr schmucklos. Acht Hügel mit schlichten Kreuzen zeugten von den Opfern, die die Besiedlung gekostet hatte. Es waren vor allem Kinder, die den Härten des Lebens nicht gewachsen waren.
Vier Männer trugen den schlichten Sarg. Astrid folgte mit ihren beiden Kindern. Man hatte ihnen schwarze Kleidung geliehen.
Der Dorfälteste trat an das offene Grab und wandte sich an Astrid: »Der Herr spricht zu uns in seiner heiligen Schrift: ›Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesu Christo ist, unserem Herrn.‹«
Er beugte sich zur Erde und streute eine Hand voll davon über den Sarg. Dann nahm er Astrids Arm und führte sie zum Grab. Astrid hatte einen kleinen Blumenstrauß gepflückt, den sie in die Grube warf. Sie wusste, die Quäker würden keine Blumen zum Grab bringen, aber sie respektierten ihre andere Auffassung. Die Frauen nahmen sich Ingrids an, die sehr weinte. Der Älteste legte Sven, der vor Schmerz wie erstarrt schien, die Hand auf die Schulter.
Dann schaufelten sie das Grab zu und stellten ein einfaches Holzkreuz auf, in das sie eingebrannt hatten:
Einar Larssongeb. 3.4.1729 gest. 22.9.1763
»Ist Vati jetzt im Himmel?«, fragte die kleine Ingrid, als sie zurück zum Haus gingen.
»Ja, Ingrid. Er sieht uns, er hört uns, und er liebt uns wie immer. Aber wir können ihn nicht mehr sehen und hören. Doch wenn du ganz fest an ihn denkst, wirst du spüren, dass auch er an dich denkt«, antwortete ihr die Mutter.
»Morgen fahren wir in Einars Tal, Astrid Larsson. Wir wollen sehen, ob die Indianer etwas unzerstört ließen. Glaubt Ihr, dass ihr uns begleiten könnt?«
Astrid hatte einen Stich verspürt, als der Mann »Einars Tal« sagte. So hatte es einmal ein Trapper genannt, und sie waren bei dem Namen geblieben. Über fünf Jahre hatten sie es gerodet, bepflanzt und geerntet. Es war ein Tal des Glücks geworden. Ingrid war dort geboren worden und aufgewachsen.
»Ich komme mit, Ben Walker.«
Sie fuhren am nächsten Morgen in aller Frühe mit zwei Wagen los. Auf dem Kutschsitz des ersten Wagens saßen drei Männer. Astrid saß mit zwei anderen auf dem Sitz des zweiten Wagens. Die Männer hatten Musketen. Sie trug ihre Vogelflinte, die sie aus der Blockhütte mitgenommen hatte.
Der ältere Mann neben ihr sagte: »Ich fühle mich gar nicht wohl mit den Gewehren um mich herum. Wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen. Wir wollen in Frieden leben. Aber Gott will auch nicht, dass wir uns von einer Horde blutdürstiger Verrückter abschlachten lassen. Hoffentlich können wir bald wieder in Frieden leben.«
»Einar wollte nie etwas anderes. Wer zu uns kam, ob weiß oder rot, wurde in Frieden aufgenommen. Er hat für uns hart gearbeitet, damit es unsere Kinder einmal leichter haben. Und dann haben sie ihn ermordet, Nachbar Ben.«
»Es ist manchmal schwer, Gottes Willen zu verstehen, Astrid Larsson. Aber er ist unser Vater, und am Ende aller Tage werden wir erkennen, dass alles zu unserem Besten war. Nur hier und jetzt können wir es oft noch nicht begreifen.«
Astrid sah das Wäldchen, in dem Einars Pferd gestürzt war, und schluchzte leise vor sich hin. Dann kam die Lichtung, die ihnen oft angezeigt hatte, dass sie nun bald ihr Heim erreichen würden. Und dann endete der Wald, und Einars Tal lag vor ihnen. Die Wagen hielten. Ein Mann sprang vom ersten Wagen ab, lief zum Waldrand und spähte umher.
»Nichts zu sehen«, meldete er. »Kein Rauch, kein Lager, nichts.«
Sie fuhren weiter. Und dann erblickte Astrid ihre Blockhütte, sie hörte die Kuh brüllen, sah die Hühner picken und erwartete jeden Moment, dass ihr Einar aus der Hütte käme.
»Die Indianer haben nichts geplündert. Aber Vorsicht! Es könnte eine Falle sein!«, rief einer vom ersten Wagen.
Die Wagen hielten an. Sie schickten die Hunde voraus, aber die schnüffelten nur herum und fanden nichts Ungewöhnliches. Dann stieg einer ab und ging zur Hütte und zum Stall, blickte hinein und winkte den anderen.
Astrid war bewusst geworden, dass ihr Einar nie wieder aus der Hütte treten würde, und sie schluchzte leise.
Ben Walker wollte sie ablenken und sagte: »Die Indianer müssen auf der Flucht gewesen sein und haben Einar vielleicht mit einem der Kundschafter verwechselt, die sie verfolgt haben. Sie haben nichts zerstört und geplündert. Kommt, Astrid, lasst uns aufladen, was Ihr und die Kinder gebrauchen könnt.«
Sie molken zuerst die Kuh, deren übervoller Euter sie quälte, dann luden sie Wäsche, Geschirr, Handwerkszeug und kleinere Möbel auf einen Wagen. Astrid hatte ein Schrankfach aufgezogen und hielt ein Buch in der Hand.
»Was ist das für ein Buch, Astrid?«, fragte Ben Walker sie.
»Das ist der New England Primer, nach dem ich in der Schule die Kinder Lesen und Schreiben gelehrt habe. Auch Sven hat danach gelernt.«
»Ihr wart Lehrerin?«
»Ja, bis ich Einar heiratete und dann hier siedelte.«
»Davon müsst ihr mir auf der Rückfahrt erzählen. Aber nun sagt uns, was wir zuerst einladen müssen, damit wir nicht zu spät heimkommen.«
Astrid ging zu ihrem »Vorratskeller«. Das war ein Raum, den Einar in einen winzigen Hügel nahe der Hütte gegraben hatte. Er war mit Holzbalken abgedeckt, dick mit Erde belegt, auf der Gras gewachsen war. Vor dem Eingang war eine schwere Tür, um Füchse und Bären abzuhalten.
Sie sah die Früchte der gemeinsamen Arbeit, die Einar und sie im Winter verzehren wollten. Da war das Fässchen mit Sülze, dort jenes mit gesalzener Butter, die Säcke mit Mehl und Mais, mit Walnüssen und Haselnüssen, die Tontöpfe mit Honig und Marmelade, die getrockneten Schinken, die Äpfel, die getrockneten Kürbisse und noch vieles mehr. Mit welcher Vorfreude hatte Einar die Honigtöpfe hier abgestellt. Er war ein Süßschnabel.
Draußen riefen die Männer ihren Namen. Sie schüttelte sich die Gedanken aus dem Kopf und sagte ihnen, was sie zuerst aufladen sollten.
»Wir müssen an einem anderen Tag noch einmal fahren, Astrid«, erklärte ihr Abraham Miller. »Es wäre doch auch eine Sünde, das Korn auf den Halmen verfaulen zu lassen. Es ist eine so schöne kleine Farm, die ihr hier geschaffen habt. Aber allein könnt Ihr sie nicht bewirtschaften.«
»Nein, Ohm. Wenn ihm etwas passiert, so hat Einar immer gesagt, dann soll ich mit den Kindern zu seinem Vater und seinem älteren Bruder in Gloucester gehen, nahe bei Philadelphia.«
»Bis Reading bringen wir euch mindestens, meine Tochter, und sorgen für die Reise. Aber jetzt müssen wir noch das Vieh aufladen.«
Sie lockten die Hühner mit Körnern in die Hütte, fingen sie und banden ihnen die Beine zusammen. Sie griffen die Schweine und fesselten auch ihnen die Füße. Die Kuh seilten sie am hinteren Wagen an und machten sich dann auf den Heimweg.
Astrid starrte mit tränenden Augen auf ihre Hütte, bis sie hinter Bäumen verschwand. Dann schaute sie auf die Apfelbäume, die Einar gepflanzt und gehegt hatte, auf die Bank, wo sie gesessen hatten, wenn die Kinder schon schliefen und Zeit für ein Ausruhen und ein Gespräch blieb. Und dann nahm der Wald sie wieder auf. Sie würde das Tal nie wieder sehen, Einars Tal, die Heimat ihres Glücks.
Ben wartete, bis er an ihrem Atem merkte, dass sie wieder ruhiger wurde und dass ihr Schmerz abklang. »Erzählt Ihr mir jetzt von eurer Zeit als Lehrerin, Astrid? Wir wissen ja gar nichts von Eurer Jugend. Ihr seid deutscher Abstammung, nicht wahr?«
»Ja, meine Eltern sind als junges Paar aus Süddeutschland eingewandert. Ich wurde hier geboren. Mein Vater war Schneider, meine Mutter arbeitete als Hebamme. Sie haben schwer geschuftet, aber schließlich hatte mein Vater ein gut gehendes Geschäft mit zwei Gehilfen und zwei Jungen zum Anlernen. Meine Mutter arbeitete dann nicht mehr, sondern sorgte für uns alle. Ich hatte zwei ältere Brüder.«
»Leben Eure Eltern noch?«
»Nein, sie wurden beide getötet, als sie von einem Besuch bei meinem Onkel heimkamen und die Pferde in einem Gewitter scheuten. Der Wagen wurde einen Abhang hinuntergeschleudert, zerschmetterte und begrub meine Eltern. Ich hatte damals gerade begonnen, als Lehrerin zu arbeiten. Mein Vater hat immer viel Wert auf eine gute Ausbildung gelegt, die ihm selbst nicht zuteil wurde. Mein ältester Bruder war Kantor, der zweite sollte das Geschäft meines Vaters als Schneider übernehmen.«
»Leben sie denn auch nicht mehr?«
»Nein, sie starben schon zu Lebzeiten meiner Eltern an einer Typhusepidemie, die damals viele Leute hinwegraffte.«
Ben nickte. »Ich weiß. Auch zwei meiner Geschwister sind an Typhus gestorben. Dagegen leben wir hier recht gesund in unserem Dorf. Aber nun erzählt einmal von Eurem New England Primer. Ich habe Lesen und Schreiben mit einem Hornbook und mit der Bibel gelernt.«
Astrid lächelte. »Das alte Hornbook kenne ich auch noch. Das war ja kaum mehr als eine kleine Holztafel mit einem Papier, auf dem das Alphabet und einige Sprüche standen, alles überzogen von ganz dünner, durchsichtiger Haut. Der Primer ist ein richtiges kleines gedrucktes Buch mit etwa achtzig Seiten. Natürlich bringt er auch erst das Alphabet und zu jedem Buchstaben einen Merkspruch, zum Beispiel ›Nach Adams Fall, wir sündigten all‹ für das A. Dann kommen Gebete für jede Tageszeit, fromme Geschichten und Hilfen für den Tag. Heute wirkt das Buch etwas sehr streng, aber im Unterricht konnte ich manches abmildern. Doch die Bibel musste auch bei uns gelesen werden.«
»Gehört Ihr der lutherischen Kirche an?«
»Ja, wie mein Einar. Er hatte schwedische Eltern, wie Ihr wisst. Sie kamen etwas früher als meine. Sein Vater war Kapitän eines kleinen Handelsschiffes und Teilhaber. Er lebt jetzt in Gloucester. Der ältere Bruder wohnt ganz in der Nähe und hat eine Bäckerei.«
»Sie werden Euch und Eure Kinder nicht im Stich lassen.«
»Nein, das werden sie nicht. Aber die Zeit meines Glücks ist vorbei. Jetzt muss ich für meine Kinder leben.«
Als sie das Dorf am Abend erreichten, liefen ihnen die Kinder entgegen. Allen voran jubelten Ingrid und Sven der Mutter zu. Man sah, wie groß ihre Angst um die Mutter tagsüber gewesen war. Und dann entdeckten sie die Kuh, die müde hinter dem letzten Wagen hertrottete.
»Lisa, Lisa!«, riefen sie und streichelten die Kuh am Kopf und an den Schenkeln. Und Lisa muhte und sah ein wenig frischer aus.
Die Quäker im Dorf waren überrascht, wie viel die Wagen brachten. »Da habt ihr ja die ganze Einrichtung retten können, Astrid«, freute sich Bertha.
»Ja«, antwortete Astrid. »Nun kann ich mich bei euch allen bedanken und noch etwas in unsere neue Heimat mitnehmen.«
»Wir helfen nicht um Dankes willen, Astrid«, belehrte sie Bertha.
»Ich weiß. Aber dem, dem geholfen wurde, darf man den Dank auch nicht verweigern.«
Als sie abgeladen hatten, kam der älteste Quäker zu ihr. Die Gemeinschaft der Freunde kannte weder Priester noch Bürgermeister, aber es hatte sich so ergeben, dass der Mann mit der größten Lebenserfahrung öfter als Sprecher aller auftrat.
»Wir sind beschämt, Astrid, weil Ihr uns so viel von Eurer Habe überlassen wollt. Wir können Euch das nicht bezahlen, denn Ihr wisst selbst, wie knapp Bargeld in den Grenzsiedlungen ist. Wir tauschen doch fast nur. Aber wir werden uns bemühen, Dinge, die Ihr nicht mitnehmen könnt, in Reading gut zu verkaufen und Euch das Geld zu schicken. Ich weiß, dass Euer Land auch in Reading auf Einars Namen eingetragen ist. Ihr solltet jemanden beauftragen, es zu verkaufen. Es ist gutes Land und weitgehend bearbeitet. Wir können Euch einen ehrlichen Makler empfehlen. In zwei Wochen könnten wir Euch auf die Reise zu Euren Leuten bringen, wenn Euch das recht ist.«
Es war Astrid recht. Sie besuchte täglich das Grab ihres Mannes. Die Quäker hatten ihr zugesichert, dass sie auch das Metallkreuz, das sie schicken wollte, aufstellen würden.
Der Abschied war schwer und tränenreich. Die Hilfsbereitschaft dieser friedliebenden Menschen hatte alle Larssons tief beeindruckt. Und sie wussten, dass sie wahrscheinlich niemanden wiedersehen würden.
Drei Wagen fuhren nach Reading, denn die Quäker konnten die Tagesreisen nicht allein für Astrid auf sich nehmen. Sie mussten es mit ihrer normalen Fahrt in die Hauptstadt verbinden, in der sie Waren ablieferten und dafür das tauschten, was sie im Winter brauchten. Nun fuhr ein Wagen mehr mit und hatte zwei Kisten und mehrere Taschen für Astrid geladen.
Astrid musste mit den Kindern mehrmals absteigen und hinter dem Wagen gehen, wenn der Weg zu steinig oder zu steil für die Pferde war. Sie rasteten in einer Quäkersiedlung am Mittag und erreichten die Hauptstadt des Countys Berks am Abend.
Ingrid hatte die Stadt noch nie gesehen, und Sven hatte keine Erinnerung mehr an die Siedlung, durch die er als kleines Kind mit den Eltern auf dem Weg in die fernen Berge gereist war.
Thomas Penn hatte wesentlich dazu beigetragen, dass Reading 1748 als Zentrum einer Region entstand, in die immer mehr Siedler strömten, sehr viele davon aus Deutschland. Jetzt, nach fünfzehn Jahren, lebten ein paar hundert Menschen in dem Ort. Es gab auch schon drei oder vier Steinbauten und viele schöne Holzhäuser.
Sven und Ingrid rissen die Augen auf, als sie die vielen Menschen sahen, die die Hauptstraße entlang fuhren, ritten oder gingen. Sie zeigten auf die großen Läden, die alles anzubieten schienen von Eisenpflügen bis zu Schokoladenpackungen. »Wartet nur ab, bis ihr Philadelphia seht. Da wohnen jetzt 28 000 Menschen, dass sind mehr als tausendmal so viel wie hier.«
Ingrid konnte sich unter solchen Zahlen überhaupt nichts vorstellen, und Sven musste eine Weile überlegen, ehe er sagte: »Das kann doch nicht sein, Mutti. Die Leute müssten ja den ganzen Tag gehen, um zu ihrem Ackerland zu kommen. Sie brauchen doch so viel Platz zum Wohnen, da ist doch kein Raum für Ackerland.«
Astrid wusste nicht recht, wie sie ihrem Sohn das erklären sollte. »Sven, nur noch wenige Leute arbeiten dort in der Landwirtschaft, und die wohnen am Rand der Stadt. Die allermeisten arbeiten als Handwerker, Verkäufer, Schreiber, Ärzte und in vielen Berufen, die kein Ackerland brauchen. Aber lass mir jetzt einmal Zeit! Wir fahren in einen Hof, und ich muss mich zur Begrüßung fertig machen.«
Die Quäker wohnten bei einem Glaubensgefährten, der auch einen Teil ihrer Ackerwaren aufkaufte. Er hörte am Abend der Erzählung über Astrids Schicksal mit Teilnahme zu und erklärte, dass in zwei Tagen ein Transport nach Pottstown abging. Da könne ein Wagen mit Astrids Habe mitfahren, und von dort könne die Mitfahrt auf einem Flussboot den Schuylkill-Fluss hinab leicht organisiert werden.
»Und wenn ihr dem Schiffer ein paar Schilling zusätzlich gebt, dann bringt er euch die paar hundert Meter über den Delaware gerade hin- über nach Gloucester, Mrs Larsson.«
Sven und Ingrid wollten mit der Mutter am nächsten Morgen die vielen Geschäfte ansehen, aber die Mutter vertröstete sie. »Erst muss ich zur Behörde für Landvermessungen und mir eine Bestätigung für die Eigentumsrechte an unserem Tal holen. Erst dann kann ich einen Makler beauftragen, Käufer zu suchen. Die paar Stunden müsst ihr noch warten.«
Astrid fand die Behörde in den wenigen Straßen der kleinen Stadt bald. Ein Schreiber, der in einem Zimmer mit vielen Folianten und Kartenrollen vor sich hin schrieb, zeigte mit dem Federkiel auf die Tür zum Nebenzimmer. Dort saß anscheinend der Leiter der Behörde. Er hörte sich Astrids Geschichte an und zeigte etwas Teilnahme.
»Zwischen dem Ontolaunee-See und dem spitzen Berg etwa, sagten Sie?«, fragte er und ging zu dem großen Regal hinter seinem Tisch. Er nahm einen Ordner heraus.
»Ja, hier steht etwas von Einar und Astrid Larsson. Etwa zweitausend Acres, am Silberbach gelegen, der zum Schuylkill-Fluss fließt. Die Landmarken sind angegeben, das Gebiet wurde länger als fünf Jahre bewirtschaftet. Ich kann Ihnen die Eigentumsbescheinigung ausstellen. Dann können Sie auch verkaufen.«
»Haben Sie vielen Dank für Ihre Mühe, Sir«, bedankte sich Astrid.
Der Beamte griff nach einem Formular und murmelte auf Deutsch: »Nicht der Rede wert.«
Astrid staunte. »Sind Sie deutscher Herkunft, mein Herr?«
Der Beamte schaute etwas erstaunt auf. »Ja. Wie kommen Sie darauf?«
»Sie haben eben die Redensart ›Nicht der Rede wert‹ in deutscher Sprache benutzt.«
Er lächelte. »Ja, wenn ich in Gedanken bin, falle ich manchmal in die Sprache meiner Eltern zurück. Sie sind vor zweiunddreißig Jahren eingewandert, sprechen aber immer noch mehr Deutsch als Englisch. Und Sie sind auch deutscher Herkunft, wie ich Ihrer Aussprache entnehme.«
»Ja. Auch ich bin hier geboren worden. Aber meine Eltern sind leider tot.«
»Haben Sie denn noch Verwandte, Frau Larsson, wo Ihr Gatte nun tot ist?«
»Ja, den Bruder und die Eltern meines Mannes in Gloucester am Delaware.«
»Wie gut für Sie. Wenn Sie die Farm verkaufen wollen, empfehle ich Ihnen Herbert Walberg als Vermittler, ein ehrlicher und seriöser Mann, übrigens auch deutscher Abstammung. Sie können sich gern auf mich berufen. Mein Name ist Wilhelm Schreiber.«
Ihre Gastgeber kannten Herrn Walberg und konnten ihn ebenfalls empfehlen. Sie hatten mit den Quäkern vom Ontolaunee-See auch schon den Weitertransport nach Gloucester geregelt. Ein Vetter des Quäkers schickte in wenigen Tagen von Pottstown zwei Flussschiffe mit Getreide zur Mündung des Schuylkill. »Da können Sie mit Ihrem Gepäck und den Kindern leicht mitfahren. Nur für die Verpflegung am Reisetag müssen Sie selbst sorgen.«
Nun stand einem Besichtigungsgang mit den Kindern zu den Geschäften des Ortes nichts mehr entgegen. Astrid fühlte sich auch ein wenig beruhigter über ihrer aller Zukunft, nachdem ihr Besitzrecht gesichert war.
Sie hätte gedacht, dass man in dem kleinen Ort nicht mehr als eine Stunde brauche, um alles zu sehen. Aber sie hatte sich in ihren Kindern getäuscht. Nach den Tagen der immer wiederkehrenden Trauer wurden ihre Gedanken heute von den vielen neuen Dingen gefesselt.
Und für sie war ja fast alles neu und aufregend. »Sieh doch nur, Mama, ein Mann, ganz schwarz im Gesicht und an den Händen«, bemerkte die kleine Ingrid und zeigte mit dem Finger nach vorn.
»Nicht so laut, Ingrid. Der Mann hat eine schwarze Hautfarbe, wie wir eine weiße und die Indianer eine rötliche haben. Man nennt die Menschen mit schwarzer Hautfarbe hier Neger. In den südlichen Kolonien wie Carolina, wo Baumwolle in großen Plantagen gepflanzt wird, gibt es viele Neger.«
»Warum sind die so schwarz, Mama?«
»Sie lebten seit vielen Tausend Jahren in Afrika, wo die Sonne sehr stark scheint. Man glaubt, dass die Haut sich im Lauf der Zeit so an die starke Sonne angepasst hat, Ingrid.«
Nun meldete sich aber Sven zu Wort. »Ist das ein Sklave?«
»Ich glaube nicht, Sven. Bei uns in Pennsylvania gibt es hier und da Haussklaven, aber die meisten Neger sind freigelassen. Er hier sieht aus wie der Butler in einer reicheren Familie.«
Aber jede Antwort löste neue Fragen aus. Nun wollten sie wissen, was ein Butler sei, wie Sklaven lebten und vieles andere mehr. Aber zum Glück kamen sie an ein Geschäft mit Eisen- und Haushaltswaren. Und da gab es Dinge, die hatte auch Astrid noch nicht gesehen.
Sie sahen kleine Handmühlen, mit denen konnte man Kaffeebohnen, Pfefferkörner und andere Dinge mühelos mahlen und musste sie nicht mehr zerstoßen. Sie bestaunten neue Lampen, die nicht blaken und viel heller leuchten sollten. Astrid hätte am liebsten die neuen Töpfe und Saucengießer ausprobiert. Und Sven dachte nach, wie viel leichter seinem Vater die Arbeit geworden wäre, hätte er diesen neuen Patentpflug aus England gehabt.
Alles schien sich in den Jahren erneuert und verbessert zu haben, in denen sie in der Wildnis gelebt hatten. Die Webstühle waren leichter zu bedienen, die Stubenbesen fusselten nicht so aus, die Spaten und Äxte lagen besser in der Hand, und erst die Schuhe und Kleider! Da gab es praktische »Überschuhe«, wenn man durch die schlammigen Straßen gehen musste. Und die Brillen waren leicht hinter den Ohren zu befestigen und sahen viel gefälliger aus. Nebenan war auch ein Laden mit Büchern und Zeitungen, in dem man die Brillen erproben konnte.
Sven stand an der Scheibe und konnte alle Überschriften lesen, auch wenn ihm einige Wörter fremd waren. »Mutti, schau doch nur: Eine Zeitung aus New York!«
Astrid sah hin. »Ja, aber sie ist über drei Wochen alt. Na ja, sie hatte auch einen weiten Weg. Aber hier ist eine Londoner Gazette, nur sechs Wochen alt. Die muss ein Schiff direkt nach Philadelphia gebracht haben.«
Astrid musste ihre Kinder fast von den Läden wegreißen, denn sie sollten zurück zu ihrer Gastfamilie, damit Astrid den Termin beim Makler wahrnehmen konnte.
Herr Walberg, der Makler, bat Astrid, deutsch zu sprechen. »Früher haben wir unsere Heimatsprache öfter gesprochen. Jeder Zweite kam aus Deutschland. Aber heute sind wieder mehr Schotten und Iren eingewandert, und die jungen Leute reden englisch. Da bin ich froh, wenn ich mal wieder die alten Laute höre.«
Er drückte Astrid sein Mitgefühl aus und erzählte ihr, dass er von den Quäkern schon gehört habe, wie schön gelegen, fruchtbar und gut bestellt die Farm sei. »Und hier aus der Besitzurkunde entnehme ich, dass das Land auch gut vermessen wurde. Ein Vorteil und eine Sicherheit gegen spätere Grenzstreitigkeiten.«
Astrid lächelte traurig. »Mein Mann war der Sohn eines Kapitäns. Der hat ihm viel von der Bedeutung des Messens und Navigierens erzählt.«
»Das merkt man auch hier an den Angaben. Da steht nicht nur ›Hundert Yards westlich von …‹, sondern genau ›Südwest bei Süd‹. Es gibt nun zwei Möglichkeiten, Frau Larsson. Entweder Sie verkaufen an einen Spekulanten, der sofort zahlt und das Land verpachtet oder weiterverkauft. Oder Sie verkaufen an einen Vertragseinwanderer, der in Raten abbezahlt.«
»Was ist ein Vertragseinwanderer, Herr Walberg?«
»Jemand, der nicht das Geld für die Überfahrt von Europa nach Amerika aufbringen konnte. Es gibt Makler, die das Geld vorstrecken. Dafür muss der Mann seine Arbeitskraft für meist fünf Jahre nach Ankunft verpfänden. Ich kenne einen Westfalen mit Frau und zwei großen Söhnen, der auf einer Farm am Mount Penn so gut gearbeitet hat, dass er praktisch Verwalter ist. Im nächsten Frühjahr läuft seine Zeit ab, und er will unbedingt eigenes Land haben. Der würde hart arbeiten und zehn Jahre lang aus den Ernten den Kaufpreis abzahlen. Wenn Sie nicht sofort Geld brauchen, um ein Haus oder ein Geschäft zu kaufen, wäre das die beste Lösung.«
»Ich kann bei Schwager oder Schwiegervater unterkommen. Ich nehme den Vorschlag gern an.«
»Gut, dann fahre ich gleich zu dem Mann raus. Heute Abend können wir die Verträge unterzeichnen. Morgen früh lasse ich sie bei der Behörde registrieren. Dann können Sie mit allen Urkunden übermorgen abreisen.«
Es war eine seltsame Fahrt, wenn sie später daran zurückdachten. Sie waren ja nicht viel anders als gut behandelte Frachtstücke. Sie selbst hatten nichts organisiert und kannten weder Weg noch Ziel. Aber sie sahen und erlebten Dinge, die ihnen in Einars Tal in Jahrzehnten nicht widerfahren wären.
Die Fuhrleute konnten ihren Spaß kaum verbergen, als sie am Rande von Reading an einem Hurenhaus vorbeifuhren und Astrid ihren Kindern die Augen zuhielt, damit sie nicht sahen, wie die Huren immer wieder Schenkel und Busen zeigten und sich von betrunkenen Freiern anfassen ließen.
Weniger spektakulär war der Gewitterregen, der den Weg im Nu aufweichte und sie zwang, neben den Wagen herzugehen, um die Pferde zu entlasten. Ungewohnt für alle war ein Trupp britischer Soldaten, der in seinen roten Röcken vor einem Haus stand. Sven und auch einige Fuhrleute kamen aus dem Staunen kaum heraus. Wann sah man schon einmal reguläre Soldaten aus England? Der Kutscher murmelte eine Verwünschung.
»Sie sind wohl nicht beliebt?«, fragte Sven seine Mutter.
»Ich glaube nicht. Man sagt, ihre Offiziere seien arrogant und schauten auf die Kolonisten herab.«
Vielleicht hing die Anwesenheit von Soldaten damit zusammen, dass wenig später ein Mann an einem Galgen hing und von einem Dutzend Menschen bestaunt wurde. Wieder ließ Astrid ihre Kinder wegschauen und erklärte ihnen, dass kein Mensch dem anderen das Leben nehmen solle, gleichgültig, wie schwer seine Schuld wiege.
Zum Glück gab es auch heitere Dinge zu sehen: Die Schweine, die ihren Fuhrleuten entwischt waren und über die Felder davonjagten, die Hühner, die sich auf ein Gatter gerettet hatten, während unten ein kleiner Hund sie anbellte, die Frau, die einen so großen Federhut trug, dass eine Zofe neben ihr gehen und immer den Rand festhalten musste.
Und sie sahen Farmen so dicht nebeneinander, dass zwischen ihnen kein unbebautes Land blieb. Sie sahen Herden, deren Weiden richtig eingezäunt waren, und Kinder, die mit Taschen aus einer kleinen Schule kamen.
Ihre Mutter bestätigte ihren Kindern, dass in den größeren Orten die Kinder gemeinsam in Schulen unterrichtet würden. »Das werdet ihr in Gloucester auch erleben, und ihr werdet sehen, das macht Spaß.«
Und dann stiegen sie auf das Flussschiff, mussten schimpfenden Schifferknechten aus dem Weg gehen und sich einen Platz auf und zwischen der Fracht suchen. Sie hielten sich erst ängstlich fest, bis sie merkten, dass das flache Schiff sicher und leicht den Fluss hinabglitt. Erst ließen die Kinder ihre Augen wandern und sahen immer neue Dinge am Ufer, dann wollten sie auf dem Schiff herumlaufen, was die Mutter streng verbot. Schließlich machten die vielen neuen Eindrücke sie ein wenig müde. So schön und aufregend die Bootsfahrt auf dem Schuylkill auch war, nun konnten es die Kinder kaum erwarten, ihre neue Heimat zu erreichen und Onkel und Tante, Oma und Opa zu sehen.
»Wir fahren mit unseren flachen Flusskähnen nicht über den Delaware, Frau Larsson«, sagte der Flussschiffer. »Wer Ihnen das in Aussicht stellte, war eine Landratte. Der Delaware ist an dieser Stelle zwar nur ein paar Hundert Meter breit, aber er ist hier eine Meeresbucht. Wie schnell kommt ein Wind auf, und ein paar größere Wellen würden unsere flachen Kähne vollschlagen. Aber Sie finden dort, wo wir anlegen, leicht einen Kutter, der Sie für wenig Geld rüberbringt. Den alten Kapitän Larsson kennen doch alle.«
So war es auch. Der Schiffer, der mit dem Kutter gleich ablegte, war sogar einmal mit Astrids Schwiegervater gesegelt. »Guter Seemann, der alte Schwede«, hatte er gemurmelt und einen fairen Preis gemacht.
Sven und Ingrid spähten voraus und wollten von ihrer Mutter immer wissen, was dieses oder jenes Gebäude beherberge.
»Kinder, ich habe in Philadelphia gelebt und war nur einige Male mit eurem Vati hier in Gloucester, und das liegt sechs und mehr Jahre zurück. Das Rathaus kenne ich noch, ein oder zwei Werften, die Kirche, aber sonst nicht viel. Wartet ab, der Opa und Onkel Björn werden euch alles zeigen.«
Der Schiffer und sein Gehilfe brachten ihre beiden großen Kisten mit der Schubkarre an ihr Ziel. »Ist ja nicht weit, und das schulde ich dem Käpt’n«, hatte der Schiffer gesagt. Die Taschen schleppten Astrid und die Kinder.
An einem sauberen kleinen Haus an der Flussseite klopfte der Schiffer an. »Besuch, Käpt’n!«, rief er.
Sven sah, wie eine Gardine zur Seite geschoben wurde und ein graues Wollbüschel herausspähte.
Dann knarrte eine Tür, Schritte tappten, und eine Stimme rief: »Wo ist Einar?«
Dann sah Sven den Mann. Er ging gebeugt und hinkte etwas. Sein Gesicht war von einem grauen Vollbart eingerahmt und mit einem grauen Haarschopf bedeckt. Das Gesicht war faltig und wies einen großen braunen Leberfleck unter dem linken Auge auf. »Wo ist er, Tochter?«
Astrid trat ihm einen Schritt entgegen. »Er ist tot, Herr Vater. Die Indianer haben ihn ermordet. Ich und meine Kinder bitten um Aufnahme.«
Der alte Mann nahm die Hände vor die Augen, und seine Brust bebte. Dann holte eine Hand ein Tuch aus der Tasche. Er wischte die Augen trocken und sah die Ankömmlinge mit seinen graublauen Augen fest an.
»Die Frau und die Kinder meines lieben Sohnes sind mir immer willkommen. Du musst mein Enkelsohn Sven sein und du meine Enkeltochter Ingrid. Hübsche Kinder hast du uns geschenkt, Tochter Astrid. Tretet ein und seid willkommen!«
Zum Schiffer sagte er: »Ladet die Kisten dort ab, und erzähl nicht allen, dass der Alte weinen kann. Hab Dank!« Für Astrid und die Kinder waren die nächsten Stunden mit mehr Neuigkeiten gefüllt, als sie fassen konnten. Ihre Unterbringung war kein Problem. »Wir haben oben zwei Zimmer frei. Da könnt ihr wohnen.«
Aber dann kam eine kleine, etwas dicke Frau aus der Küche, und Astrid wollte sie umarmen und begrüßen. Aber die Frau wehrte ab: »Na, na, wer sind Sie denn?«
Der Großvater blickte Astrid verlegen an und flüsterte: »Die Oma vergisst jetzt sehr viel. Aber sie wird sich an euch gewöhnen.«
Zu seiner Frau sprach er laut: »Es ist Astrid, Einars Frau. Und sieh nur, hier ist Ingrid, unsere Enkeltochter, und das ist Sven, unser Enkelsohn. Sind sie nicht so hübsch, wie Einar letztes Jahr schrieb?«
Die Oma schlug die Hände zusammen. »Hübsche Kinder, ja. Unsere Enkeltochter. Wie heißt du?«
»Ingrid«, antwortete die Kleine etwas schüchtern.
»Sehr schön! Komm, ich hab einen Keks für dich. Und wer ist der Junge?«
Jetzt meldete sich Sven: »Dein Enkelsohn Sven, liebe Oma.«
»Guter Junge«, hörte Astrid den Opa murmeln. Aber dann trippelte die Oma schon in die Küche und kam mit einem Teller voller Kekse zurück. »Hier, lasst es euch schmecken, und kommt bald einmal wieder.«
Der Opa räusperte sich und sagte: »Frau, kannst du bitte Kaffee machen für uns und unsere Schwiegertochter Astrid? Und einen Saft für die Kinder wirst du auch haben. Kaffee und Saft!«
»Kaffee und Saft«, wiederholte die Oma und wandte sich um.
»Ich werde der Oma helfen«, sagte Ingrid und folgte ihr.
»Du hast liebe Kinder, Astrid«, lobte der Opa.
»Danke, Herr Vater.«
»Nun setz dich mal hin, Kind, und lass das mit dem Herrn Vater. Wir werden nun als eine Familie zusammenleben. Sag Vater oder Opa zu mir, und hab Nachsicht mit uns alten Leuten.«
Bevor Astrid antworten konnte, kam Ingrid und fragte: »Oma will wissen, ob ihr auch Kuchen möchtet.«
Der Opa sah Astrid fragend an, und die nickte. »Sag der Oma, wir hätten gern Kuchen.«
Als sie Kaffee tranken und Kuchen aßen, unterbrach der Opa die Stille: »Du weißt, Astrid. Ich war immer ein ungeduldiger Mann. Bitte, sag mir, wie mein Sohn starb.«
Astrid erzählte in kurzen Sätzen und betonte, dass er nicht gelitten habe und dass sie ihn christlich bestattet hätten. Ingrid weinte leise vor sich hin. Sven rang um Fassung.
Der Großvater saß regungslos da. Zwei Tränen rannen aus seinen Augen. Die Oma sah Ingrid weinen. »Was hat denn die Kleine? Schmeckt dir etwas nicht?«
Der Großvater legte ihr die Hand auf die Schulter und sagte: »Gudrun, liebe Frau. Unser Sohn Einar ist tot. Die Indianer haben ihn erschossen. Verstehst du? Unser Einar kommt nie wieder. Das ist seine Tochter Ingrid. Sie weint um ihn. Sie wohnt jetzt bei uns.«
Das Gesicht der Großmutter veränderte sich. Es füllte sich mit Leben. »Einar ist tot? O mein Gott. Unser armer Junge.« Sie schluchzte bitterlich. Ihr Mann umarmte. Dann griff Ingrid nach ihrer Hand und streichelte sie.
Die Oma bemerkte es nach einer Weile, sah Ingrid an und sagte: »Unsere liebe Enkeltochter!« und drückte sie an sich.
Astrid sah ihren Schwiegervater an, und der flüsterte: »Manchmal ist sie ganz wie früher.«
Die Oma trocknete ihre Tränen, nahm noch von ihrem Enkelsohn Sven Notiz und tauchte dann wieder in ihre Welt ab. Der Opa zeigte ihnen die Zimmer, half, die Kisten zu öffnen, und besprach mit Astrid, was noch besorgt werden könne.
»Du kannst uns sehr helfen, liebe Tochter, wo meine Gudrun nun nicht mehr ganz bei uns ist und ich immer hinfälliger werde. Aber du wirst auch dein Leben leben wollen. Wie hattest du es dir gedacht?«
»Ich würde gern wieder als Lehrerin arbeiten, wenn auch Ingrid und Sven die Schule besuchen. Du weißt, Einar wollte immer, dass sie etwas lernen.«
Der Alte nickte. »Ja, das sollen sie. Ich glaube, ich werde dir helfen können. Ich kenne Leute, die im Rat der Schule sitzen. Aber noch eins muss ich dir sagen: Bald werden Björn, unser Sohn, und seine Frau Christine kommen. Auch sie werden sagen, dass du bei ihnen wohnen und arbeiten kannst. Aber das geht nicht. Christine ist eine gute Mutter und Ehefrau, aber sie ist krankhaft eifersüchtig. Es hat schon den größten Streit gegeben, wenn eine Frau nur freundlich mit Björn sprach. Sie haben nur männliches oder ganz altes weibliches Personal. Christine kann sich da nicht beherrschen. Sie kriegt dann regelrechte Anfälle. Denk daran und halte immer Distanz zu deinem Schwager. Es tut mir leid, das sagen zu müssen. Aber ich weiß keine andere Lösung. Wenn wir mit Christine reden, sieht sie alles ein. Aber dann kommt es wieder über sie.«
Astrid lächelte etwas. »Auf unserer Farm ist mir solche Versuchung erspart geblieben. Ich werde es beherzigen, Vater.«
In den nächsten Wochen lebten sich Astrid und die Kinder in der fremden Umgebung ein. Ingrid fand auf unerklärliche Weise Zugang zur Großmutter, die nie vergaß, dass sie ihre Enkeltochter war. Wenn Ingrid sie anredete oder ihre Hand nahm, tauchte sie immer aus ihrer Welt empor, und ihr Gesicht füllte sich mit Leben.
»Es ist ein Wunder!«, staunte der Großvater immer wieder. Mehr und mehr bürgerte es sich ein, dass Ingrid der Vermittler wurde, wenn sie der Oma etwas sagen wollten, was sie behalten sollte.
Sven dagegen war seines Großvaters Stolz und Hoffnung. Er sollte die Enttäuschung ausgleichen, dass keiner der beiden eigenen Söhne zur See gefahren war. Der Großvater ahnte, dass Astrid diesen Wunsch nicht unterstützen würde, und fing behutsam an, Svens Interesse an der See zu wecken. Er zeigte ihm einige der vielen Werften, die es an der Küste des Delaware gab. Er nahm ihn auf das Handelsschiff mit, an dem er noch Anteile besaß, wenn es im Hafen lag. Er fuhr mit ihm im kleinen Boot zum Angeln und lehrte ihn, das Segel zu bedienen. Er zeigte ihm Bücher und Bilder aus fernen Ländern. Und es gab am Delaware viele Männer, die fremde Länder und Meere gesehen hatten und fesselnd davon erzählten, wenn man ihnen nur einen Grog spendierte.
Sven und der Großvater verstanden sich gut. Dem Opa wurde warm ums Herz, wenn ihn Sven auf Schwedisch: »God morgon, farfar (Großvater)!«, begrüßte. Er lehrte ihn das eine oder andere schwedische Wort und freute sich, wenn Sven es gelegentlich benutzte. Und er vermittelte Sven seinen Stolz auf die Schiffbauer und Seefahrer in den amerikanischen Kolonien. »Drei Viertel aller Schiffe, die zwischen Amerika und England segeln, gehören Kolonisten. Und wir bauen immer mehr Schiffe selbst. Wir werden England eines Tages überrunden.«
Mit Schwager und Schwägerin verstand sich Astrid auch gut. Sie half in der Bäckerei aus, wenn es nötig war, und achtete darauf, dass sie immer mehr Kontakt mit Christine hatte als mit Björn. Christine fasste Vertrauen zu ihr, suchte gut erhaltene Kleidung und Spielsachen ihrer ein Jahr älteren Tochter für Ingrid heraus. Und auch die beiden Mädchen mochten sich gut leiden.
Aber immer wieder packte Astrid die Erinnerung an Einar. Sie fühlte ihn, sie hörte ihn, und dann griff die Wirklichkeit nach ihr, und sie weinte bitterlich. Der Opa kam eines Tages hinzu, als sie tränenüberströmt auf der Fensterbank saß.
Er setzte sich zu ihr, umarmte und sagte nach einer Weile: »Es ist furchtbar, dass er so plötzlich von dir gerissen wurde. Aber er wird immer in deinem Gedächtnis als junger, kräftiger und begehrenswerter Mann leben. Du wolltest mit ihm gemeinsam alt werden. Aber das bedeutet auch, dass du zusiehst, wie der junge Körper hinwelkt, faltig, unansehnlich, ja abstoßend wird. Es bedeutet auch, mit den beiderseitigen Gebrechen und Krankheiten zu leben. Die Liebe erträgt das, aber es ist nicht leicht. Gott hat dir das erspart. Dein Einar bleibt in deiner Erinnerung immer jung. Wir können Gottes Willen nicht ergründen, wir sollten uns fügen.«
Astrid half diese Aussprache. Der Gedanke, dass Einar oder sie so in eine Schattenwelt hätten abtauchen können wie die Oma, erschreckte sie sehr. Sie wurde ruhiger.
Zu Astrids innerem Frieden trug auch bei, dass sie wieder ihre Aufgaben in der Schule fand. Im Staat New Jersey, in dem sie jetzt wohnten, hatte Erziehung einen hohen Stellenwert. Grundschulen für Jungen gab es seit Langem. Seit Jahren wurde auch in Philadelphia die »William-Penn-Charter-Schule« als Sekundarschule ausgebaut. Für Mädchen wurde die Grundschule jetzt durch die Privatinitiative der Eltern eingerichtet. Ingrid war eine der ersten Schülerinnen.
Der Opa war sehr am Schulbesuch seines Enkels interessiert und achtete besonders darauf, dass die Schule guten Mathematikunterricht anbot. Für Ingrid schien ihm die Anleitung zu häuslichen Fertigkeiten auszureichen. Astrid beunruhigte das nicht weiter, denn das war nun eben die vorherrschende Einstellung unter den Männern. Aber als sie eine der beiden Lehrerinnen an der neuen Grundschule für Mädchen wurde, konnte sie mitwirken, dass die Mädchen mehr lernten als die Anfangsgründe in Lesen, Schreiben und Rechnen.