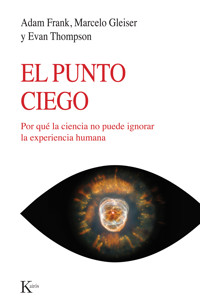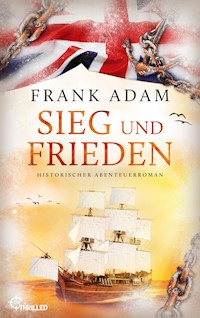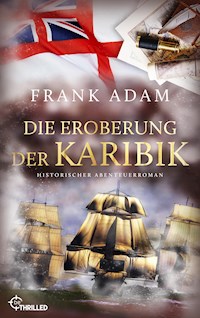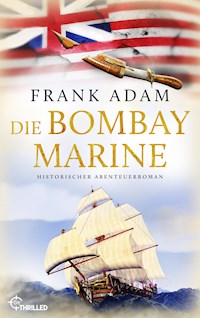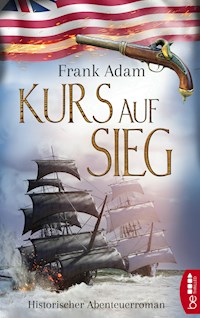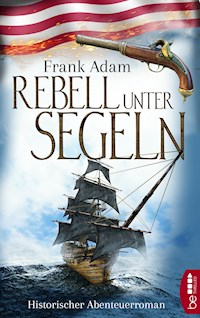6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Seefahrer-Abenteuer von David Winter
- Sprache: Deutsch
David Winter hat die Bombay-Marine verlassen und ist 1789 auf der Suche nach neuen Abenteuern. Durch einen alten Kameraden findet er den Weg in die baltische Flotte. Er wird zum Kommandanten einer Fregatte ernannt und führt seine Mannschaft tapfer in den russisch-schwedischen Krieg. Bereits nach kurzer Zeit gewinnt er die Gunst der Zarin, schafft sich aber auch mächtige Gegner. David ahnt nicht, dass sich das Blatt schon sehr bald wenden wird ...
David Winters Abenteuer sind ein Spiegelbild seiner Zeit, des rauen Lebens in der Royal Navy, aber auch romantischer Gefühle, des heldenhaften Mutes und der Kameradschaft auf See. Vom Eintritt in die Royal Navy über die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges bis in die napoleonischen Kriege verfolgen wir David Winters Aufstieg vom Seekadetten bis zum Admiral.
Aufregende Abenteuer auf See, eingebettet in die faszinierende Geschichte der Marine.
Für alle Fans von C.S. Forester, Alexander Kent, Patrick O'Brian und Richard Woodman. Weitere Bücher von Frank Adam bei beTHRILLED: die Sven-Larsson-Reihe.
eBooks von beTHRILLED - spannungsgeladene Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Titel
Verzeichnis Bilder
Vorwort
Hinweise für marinehistorisch interessierte Leser
Verzeichnis der Schiffe und ihrer Offiziere:
Der Auftrag
Vor Finnlands Küsten
Kurs Kopenhagen
Winterliche Kreuzfahrten
Kopenhagener Intermezzo
Die Schlacht in den Schären
Die Feuertaufe der Konstantin
Sieg und Niederlage
Das Duell
Glossar
Über den Autor
Alle Titel des Autors bei beTHRILLED
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Über dieses Buch
David Winter hat die Bombay-Marine verlassen und ist 1789 auf der Suche nach neuen Abenteuern. Durch einen alten Kameraden findet er den Weg in die baltische Flotte. Er wird zum Kommandanten einer Fregatte ernannt und führt seine Mannschaft tapfer in den russisch-schwedischen Krieg. Bereits nach kurzer Zeit gewinnt er die Gunst der Zarin, schafft sich aber auch mächtige Gegner. David ahnt nicht, dass sich das Blatt schon sehr bald wenden wird ...
Frank Adam
Der Kapitän der Zarin
Historischer Abenteuerroman
Verzeichnis der Abbildungen
Übersichtskarte Ostsee
Übersichtskarte Finnischer Meerbusen
Uniformen der russischen Flotte
Übersichtsszkizze Westliche Ostsee
Svensksund
Bucht von Wiborg
Vorwort
In diesem Band habe ich einen weiteren Abschnitt aus dem ereignisreichen Leben David Winters nacherzählt. Wie viele britische Seeoffiziere nahm er in der Zeit, während der die britische Flotte demobilisiert war, Dienst in der Flotte der Zarin und erlebte den russisch-schwedischen Krieg von 1788 – 1790 mit.
Nach heutiger Auffassung war er Söldner in der jetzt negativen Färbung des Wortes. Zu David Winters Zeiten sah man das anders. Der Nationalgedanke war noch nicht im Gefolge der Französischen Revolution geweckt. Der Dienst bei fremden Monarchen, soweit sie dem eigenen Herrscherhaus nicht feindlich gegenüberstanden, war nicht nur unter Offizieren ähnlich weit verbreitet wie heute ein Graduiertenstudium an fremden Universitäten. Die zaristische Flotte zog damals bei weitem die meisten britischen Flottenoffiziere an. Sie brauchte bei der fehlenden eigenen Flottentradition ausländische Experten in besonderem Maße. Aber britische Offiziere dienten in vielen Flotten, einige auch während dieses Krieges in der schwedischen.
Der bei uns kaum bekannte Kampf dieser Jahre um die Vorherrschaft in der Ostsee führt David Winter in gefährliche Situationen. Er erringt spektakuläre Erfolge, wird aber auch gefangen, gequält und schwer verwundet. Er wird leidenschaftlich geliebt und glühend gehasst. Intrigen, Korruption und Verwaltungsschlendrian erschweren seine Aufgaben als Kapitän der Zarin. Aber er bewährt sich auch in dieser neuen und oft recht fremdartigen Umgebung.
Ich habe mich wiederum um historische Genauigkeit bemüht und hoffe, dass ich dem Leser über die kriegerischen Abenteuer hinaus ein farbiges Bild dieser fernen Zeit vermitteln kann.
Für Mithilfe bei meinen Recherchen habe ich vielen zu danken, besonders Frau Dipl.-Bibliothekarin Susanne Winkler von der Universitätsbibliothek Landau, der Hessischen Landesbibliothek Wiesbaden, dem Militärgeschichtlichen Forschungsamt in Potsdam und Herrn Dr. Niemeyer vom Wehrgeschichtlichen Museum in Rastatt.
Frank Adam
Hinweise für marinehistorisch interessierte Leser
Über die maritimen, nautischen und waffentechnischen Aspekte der Segelflotten dieser Zeit und über ihre Besatzungen informiert leicht verständlich das Taschenbuch:
Adam, F.: Hornblower, Bolitho und Co., Krieg unter Segeln in Roman und Geschichte. Frankfurt: Ullstein 1992
Über die Flottenbauten Katharinas II. und ihre Kriege mit Schweden und der Türkei unterrichtet umfassend:
Bode, A.: Die Flottenpolitik Katharinas II. und die Konflikte mit Schweden und der Türkei (1768 – 1792). Wiesbaden: Harrassowitz 1979
Zum russisch-schwedischen Krieg von 1788 – 1790 ist – vor allem wegen seines Kartenmaterials – immer noch lesenswert:
Kirchhoff, H.: Seemacht in der Ostsee. 1907. Nachdruck: Neufahrn/Percha: LTR Verlag 1984
Genauer in der Darstellung ist:
Anderson, R.C.: Naval wars in the Baltic 1522 – 1850. London: 1910. Nachdruck: Edwards 1969
Speziell die Zusammenarbeit der britischen und russischen Marine untersucht:
Anderson, M. S.: Great Britain and the growth of the Russian navy in the eighteenth century. In: The Mariner’s mirror, 42, 1956, S. 132 – 146.
Die Uniformen der russischen Marine beschreibt (unter Einschluss der in diesem Roman behandelten Zeit) sehr genau:
Herrmann, F.: Die Russische Marine unter Zar Paul I. und Alexander I. In: Zeitschrift für Heereskunde 36, 1972, S. 125 – 141
Verzeichnis der Schiffe und ihrer Offiziere:
Schiff
Nicholas
Nicholas
Konstantin
Zeit
Sept. 1788–Juni 1789
Juli–Dez. 1789
Jan.–Sept. 1790
Kapitän
Winter, David
Winter, David
Winter, David
1. Leutnant
Harland, Andrew
Harland, Andrew
Borisov, Alexander Gregorowitsch
2. Leutnant
Vandamme, Wilhelm
Awenirow, Michael Stefanowitsch
Myatlev, Nikolai Iwanowitsch
3. Leutnant
Graf Kafelnikow, Bogislav Alexandrowitsch
Kalmykow, Alexej Gregorowitsch
Wiggam, Henry
4. Leutnant
–
–
Kalmykow, Alexej Gregorowitsch
Hauptmann d. Marineinfanterie
–
–
Tomski, Boris Nikolajewitsch
Leutnant d. M.
Tomski, Boris Nikolajewitsch
Tomski, Boris Nikolajewitsch
Graf Berenka, Basil Petrowitsch
Steuermann
Klimov, Wladimir Olegowitsch
Klimov, Wladimir Olegowitsch
Martinov, Iwan Fedorowitsch
Schiffsarzt
Marakow, Nicholas Petrowitsch
Elagin, Wladimir Iwanowitsch
Rogenwald, Wilhelm
Bootsmann
Lorenzo, Ricardo
Malnikow, Viktor Sergewitsch,
Bujanow, Iwanowitsch
Stückmeister
Duff, Henry
Duff, Henry
Duff, Henry
Midshipmen
Grigorij, Andrej Igorowitsch
Grigorij, Andrej Igorowitsch
Kosargoff, Andreas Petrowitsch
Kalmykow, Alexej Gregorowitsch
Kosargoff, Andreas Petrowitsch
Fürst Sorotkin, Michael Grigorowitsch
v. Löwenwolde, Christian
Fürst Sorotkin, Michael Grigorowitsch
Jönsson, Sven Antonowitsch
Der Auftrag
(Juni 1788)
Hufschläge hallten vor dem Haus. Rufe, Lachen, Pferdewiehern. Durch die offen stehende Tür des Gasthauses trat ein mittelgroßer Mann im legeren Sommeranzug ein, rief noch etwas nach draußen und blickte dann suchend in den Schankraum. Noch bevor sich seine Augen an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, eilte der Wirt auf ihn zu und sagte beflissen: »Einen schönen guten Tag, Kapitän Winter, Sir.«
Der Eintretende nahm die leichte Mütze ab und dankte. »Ihnen auch, Parker. Haben Sie einen kühlen Apfelsaft für uns, bevor wir aufs Boot gehen?« Hinter ihm schoben sich ein etwas größerer, blonder Mann und ein kleinerer Mann durch die Tür. Der erste fiel auf, weil er den linken Fuß nachzog, der zweite, weil er eine ungewöhnliche Kappe trug, die Kopfbedeckung der Malaien.
»Willkommen, die Herren«, begrüßte der Wirt auch sie und führte sie zu einem Tisch am Fenster. Aus dem Nebenraum erscholl lautes Gebrüll. Die Gäste hatten sich noch nicht gesetzt und blickten den Wirt fragend an.
»Eine Gruppe von Absolventen der Marineakademie in Portsmouth, meine Herren. Junge Midshipmen, die schon seit Stunden in sich hineintrinken.«
Gerade hatte David Winter lächelnd »Hoffentlich vertragen sie es« gesagt, da flog die Tür des Nebenraumes auf, und ein junger, schlanker Bursche stolperte in den Schankraum. »Wirt!«, schrie er. »Bring er uns Bier, aber dalli!«
Die schwarzen Haare hingen ihm wirr in sein schmales, jetzt vom Trunk gerötetes Gesicht. Die blaue Uniformjacke hatte er aufgeknöpft.
Er stierte die neuen Gäste an, grunzte abfällig und schrie wieder: »Bier! Oder soll ich ihm das Fell gerben?«
»Sofort, mein Herr. Ich bediene nur erst die Herren hier.«
Der Midshipman schüttelte ungläubig den Kopf, trat einen Schritt näher und fragte drohend: »Will er mich wegen der dreckigen Zivilisten warten lassen, Kerl?« Drohend hob er die Hand.
David Winter, der bisher den Burschen eher amüsiert beobachtet hatte, mischte sich ein. »Ich bin Leutnant Winter von der königlichen Flotte, zuletzt Kapitän der Bombay-Marine. Mäßigen Sie sich, mein Herr! Sie werden Ihr Bier gleich erhalten.«
»Ich bin Graf Kafelnikow und lasse mir von Ihnen nichts sagen«, brüllte der Angesprochene womöglich noch lauter. »Für mich sind Sie ein lausiger Zivilist.« Und jetzt wurde auch sein schwerer Akzent deutlicher, der zunächst durch die lallende Aussprache verdeckt war.
»Aber, mein Herr«, flehte der Wirt. »Das ist Kapitän Winter, ein berühmter Seeoffizier.«
Doch der trunkene Graf ließ sich nicht aufhalten. Er griff ein Glas von einem der Tische und schmetterte es an die Wand.
Der Kapitän lächelte nicht mehr. Ärgerlich und laut befahl er: »Nehmen Sie sich zusammen! Sie tragen den Rock des Königs. Verhalten Sie sich entsprechend, sonst lasse ich Sie dem Hafenadmiral vorführen!«
Aus dem Nebenraum liefen einige andere Midshipmen hinzu. Zumindest einer schien den Kapitän zu kennen, flüsterte den anderen etwas zu und griff mit ihnen nach den Armen des Randalierers.
Aber dieser schüttelte sie ab und stürzte sich auf David. Der wich zur Seite aus, trat dem Angreifer mit dem rechten Bein die Füße weg und schlug ihm mit der Hand in den Nacken, dass er auf den Boden fiel und liegen blieb.
David fragte: »Wer ist der Dienstälteste?«
Ein anderer Midshipman näherte sich betreten. »Midshipman Brant, Sir. Entschuldigen Sie bitte. Er feierte seine bevorstehende Heimkehr und wusste nicht mehr, was er tat.«
»Wohin soll er heimkehren, Mr. Brant?«
»Nach Russland, Sir, in die Flotte der Zarin.«
David sah sich fragend zu seinem Begleiter um, der den Kopf schüttelte, und entschied dann: »Nun gut, ich will vergessen, dass er mich angriff. Bringen Sie ihn zur Vernunft, ehe er noch mehr Unheil anrichtet! Sagen Sie ihm, dass ihn der Angriff auf einen ranghöheren Offizier vor das Kriegsgericht gebracht hätte, wenn er im Dienst unserer Flotte verblieben wäre.« Und er wandte sich ab, um endlich den Apfelsaft zu genießen, für den Parkers Gasthaus bekannt war.
Der etwas größere, blonde Mann setzte sich neben ihn, während der junge Mann mit der Malaienkappe als letzter ihnen gegenüber Platz nahm. David wandte sich an ihn. »Nun, Hassan, war ich schnell genug?«
»Für einen Russen reichte es, Tuan, mit einem malaiischen Piraten gerieten Sie in Probleme.« Hassan, Diener, Schatten und immer mehr auch Freund von David, lächelte.
Der blonde Mann wandte sich an David. »Was den Nahkampf angeht, so ist Hassan nie zufrieden. So streng sollten wir einmal mit ihm sein, wenn er die Enten mit seinen Fehlschüssen erschreckt.«
David hob sein Glas und nickte ihm zu. William Hansen, der große blonde Mann mit der Prothese am linken Fuß, hatte nun seit vierzehn Jahren fast immer seinen Weg in der Flotte begleitet. Morgen sollte er sich mit Davids Cousine verloben. Wer hätte das gedacht, als er selbst junger Midshipman und William Toppgast auf der Shannon war? William hatte sich emporgedient. Bootsmann, Midshipman, Leutnant waren die Stationen eines harten Weges. Und schließlich zerschmetterte eine Kugel seinen linken Fuß, als sie in Indien das Piratenlager stürmten, in dem Davids Frau den Tod gefunden hatte. Ich kenne keinen Mann, der Tapferkeit, seemännische Fähigkeiten und Charakterstärke in solchem Maß wie William in sich vereint, dachte David. Julie könnte keinen besseren finden.
»Ich werde am nächsten Wochenende mit Julie aufs Gut kommen, wenn es dir passt, David«, sagte William. Das Gut war das Landhaus, das David vor gut zwei Monaten von seinem in Indien erworbenen Geld gekauft hatte. Ein größerer landwirtschaftlicher Betrieb gehörte zum Besitz, und so nannten es die beiden ›das Gut‹. Oft sagten sie das in deutscher Sprache, denn William war von Geburt Friese wie David Hannoveraner.
Auf dem Gut arbeitete nicht nur Charly, Davids früherer Bursche als Kutscher, auch andere Seeleute hatten dort Unterschlupf gefunden. Neben Elias, der seinen Tierverstand in den Stallungen einsetzte, waren es Zimmerleute, Segelmacher und auch Mr. Duff, der Stückmeister, nebenbei ein guter Allround-Handwerker.
Mr. Rall dagegen fuhr als Maat auf dem Schiff, das Mr. Blane kommandierte, für die Reederei von Davids Onkel. Und ein neues Schiff würde bald in Dienst gestellt werden, das William von seinem Prisengeld bauen ließ und dessen erste Fahrten er wohl selbst befehligen würde. Nach der Hochzeit würde die Reederei ›Barwell, Hansen und Co.‹ heißen. Im ›Co.‹ war auch Davids Anteil verborgen.
William war glücklich. Man konnte es ihm auch ansehen, wie er braungebrannt, die blonden Haare lässig hinten zu einem Knoten zusammengebunden, neben David saß. Er hatte Julie seit vielen Jahren bewundert. Dass sie nach dem Selbstmord des leichtsinnigen George so früh Witwe wurde, hatte ihn im fernen Indien tief bekümmert. Dennoch hatte er sich nach seiner Rückkehr keine Hoffnung auf ihre Zuneigung gemacht, er, ein Krüppel mit Holzfuß.
Aber Julie war eine andere geworden, eine hart arbeitende, nüchterne und erfolgreiche Geschäftsfrau, eine Sensation in dieser Zeit. Sie analysierte nicht nur ihre Geschäfte mit ihrem scharfen Verstand, sie prüfte auch die Menschen, bevor sie ihnen vertraute.
William, seit Jahren als Davids Gefährte bekannt, beeindruckte sie zunächst durch seine Treue, seine Anständigkeit, sein Mitgefühl. Und dann lernte sie seine Willenskraft kennen, wie er mit der neuen Fußprothese eisern übte, bis ihm kaum noch eine Behinderung anzumerken war. Sie schätzte seinen Verstand, seine Urteilskraft, mit der er in allen seemännischen Fragen Rat erteilen konnte, und sie sah ihn auch etwas mit Davids Augen, für den Williams Tapferkeit, Treue und Ehrlichkeit außerhalb jeden Zweifels standen. Und aus der Wertschätzung wurde Zuneigung, an die William zunächst gar nicht glauben wollte, bis eine herzliche Liebe beide verband.
David hatte die Annäherung der beiden mit Freude und Sympathie beobachtet. Beide bedeuteten ihm viel, und ihre Verbindung schien ihm ein Glücksfall zu sein. Nun war auch die Gefahr geringer, dass Julie zu viel von ihrer Weiblichkeit verlieren könnte, wenn sie nur für das harte Geschäft der Reederei lebte. Aber sie würde auch nach der Heirat weiter die Reederei mitleiten, aber nun an Williams Seite. Auch das war ungewöhnlich und erschien Davids Onkel unnatürlich.
Davids Gedanken wanderten zu Kamala, seiner so jung ermordeten indischen Frau. Auch sie mit ihrer umfassenden Bildung und ihrem wachen Intellekt wäre wohl immer eine Partnerin in der Gestaltung des gemeinsamen Lebens gewesen und nie ein Anhängsel des Mannes ohne eigene Meinung.
»Woran denkst du, David?«, fragte William, dem die Abwesenheit seines Freundes nicht entgangen war.
»An Kamala«, antwortete dieser leise.
William legte ihm die Hand auf den Arm und sagte: »Ich denke auch oft an sie. Was für eine bewundernswerte Frau. Sie und Julie hätten sich gemocht, aber sie hätten sich wohl nie kennengelernt, denn du wärst doch in Indien geblieben, wenn Kamala noch lebte.«
Bevor David antworten konnte, mahnte sie Hassan: »Wir sollten aufs Boot gehen, Tuan, sonst kommen wir sehr spät nach Portsmouth. Der Wind steht nicht so günstig, und Mr. und Mrs. Barwell könnten sich sorgen.«
David nickte zustimmend und trank sein Glas aus. »Lasst uns gehen!«, sagte er zu seinen Begleitern und gab dem Wirt mit einigen Abschiedsworten das Geld.
Der Wirt sah ihnen nach. Über David, den neuen Landherren zehn Meilen östlich von Ryde auf der Insel Wight, hatte er viel gehört. Die Zeitungen hatten in Abständen immer wieder von seinen Kriegserlebnissen berichtet, seiner Heldenbeförderung, der Kaperung eines französischen Linienschiffes. Und als er jetzt aus Indien heimkehrte, war er für Wochen Tagesgespräch in Portsmouth gewesen. Unermessliche Reichtümer sollte er erworben haben, und dann hatte er zu Beginn seiner Heimreise ein Kind vor den Zähnen eines Hais gerettet. Der Wirt schüttelte sich bei dem Gedanken. Er mochte nie einer solchen Bestie begegnen. Besser, man ging nicht ins Wasser.
Aber dieser Kapitän Winter hatte nie in seinem Verhalten etwas Außergewöhnliches erkennen lassen. Freundlich war er, überhaupt nicht eingebildet, wenn er kurz bei ihm Station machte, bevor er im kleinen Hafen von Ryde das Boot bestieg, das ihn nach Portsmouth brachte. Aber heute, sagte sich der Wirt, da konnte man merken, dass in diesem jungen Mann Härte und Entschlossenheit verborgen waren.
Im großen Wohnzimmer der Barwells saßen sie alle um den Tisch zum Abendessen. William Daniel Barwell, der Ratsherr, Reeder und Schiffsausrüster, präsidierte an einem Kopfende, seine Frau Sally ihm gegenüber. Tante Sally war alt geworden während der Zeit, die David in Indien verbracht hatte. Als er sie nach seiner Rückkehr zum ersten Mal wiedersah, musste er sein Erschrecken verbergen. Sie hatte wohl sehr unter dem vermeintlichen Zusammenbruch der Reederei und dem Freitod ihres Schwiegersohnes gelitten. Sie war hager geworden, fast ganz ergraut, und häufig plagten sie Rückenschmerzen.
»David«, fragte sie jetzt besorgt, »du hattest einen Zusammenstoß mit einem russischen Grafen? Sei nur vorsichtig, man hört immer wieder, dass sich die Russen bei jeder Gelegenheit duellieren.«
»Keine Sorge, Tante Sally, die königliche Flotte verbietet Duellforderungen an vorgesetzte Offiziere.«
»Sonst könnte sich ein Raufbold ja wohl die Karriereleiter aufwärts duellieren«, fiel der Onkel mit seiner tiefen Stimme ein. Was die Tante abgenommen hat, dachte David, hat der Onkel zugelegt. Er hatte alles leichter überstanden, wenn er David gegenüber beim ersten Wiedersehen auch etwas befangen war, weil er damals nicht überprüft hatte, ob sein Schwiegersohn tatsächlich die Schiffe versichert hatte. Nach dieser Heimkehr hatte David auch nicht mit ihm über Geldangelegenheiten gesprochen, sondern sich für seine indischen Reichtümer in London den Rat von Experten der Kompanie geholt. »Geschäfte innerhalb der Familie sind nicht unproblematisch«, hatte sein Zahlmeister gesagt, ein ungewöhnlich ehrlicher, ja fürsorglicher Mann für diesen Beruf, der jetzt in der Kanzlei der Barwells arbeitete.
Am anderen Ende der Tafel lachten Julie und William laut über eine Geschichte, die Henry, der einzige Sohn der Barwells, über die Werft erzählt hatte. Henry war lange Zeit das Sorgenkind der Barwells gewesen, weil er, weniger intelligent als seine Schwester, in der Schule schlecht lernte und nie wusste, was er später werden wollte. Aber dann hatte er begonnen, für die Tochter des befreundeten Schiffbaumeisters Grey zu schwärmen, und lernte seit einem Jahr in der Werft den Beruf eines Schiffbaumeisters. Das bereitete ihm Freude, und er hatte wohl auch handwerkliches Geschick und technisches Verständnis, sodass er jetzt allseits anerkannt wurde.
Das hat ihm gutgetan, sagte sich David. Er ist nicht mehr so fahrig wie früher, sondern lässig und selbstsicher mit seinen knapp zwanzig Jahren.
Das Dienstmädchen trat jetzt mit einem Briefumschlag zu Onkel William, flüsterte ihm ins Ohr und gab ihm den Umschlag. Der Onkel suchte Davids Blick und sagte: »David, ein Kurier der Admiralität brachte gerade den Brief. Sie verfügen wohl noch nicht über deine neue Adresse. Er wartet draußen auf deine Quittung.«
David stand auf, unterschrieb dem Boten die Empfangsbestätigung und gab ihm ein Trinkgeld. Als er in das Zimmer zurückkehrte, lag der Brief auf seinem Platz, und alle schwiegen und sahen ihn an. Neugier, Interesse und zumindest bei der Tante Sorge über neue Fahrten in die Fremde.
David schlitzte den Umschlag auf und überflog das Schreiben. Dann informierte er die Gesellschaft: »Der Herzog von Chandos, einer der Lords der Admiralität, bittet mich in den nächsten Tagen zu einem Gespräch nach London.«
Henry, der einen Sinn für hochgestellte Bekanntschaften hatte, fragte: »Ist das nicht dein Freund Martin, mit dem du zusammen Leutnant auf der Surprise warst?«
David bestätigte: »Ja, das ist nun auch wieder fast acht Jahre her.«
»Er wird dich doch wohl nicht schon wieder auf ein Schiff kommandieren wollen. Du bist doch gerade zurückgekommen und musst dich noch erholen.« Tante Sally war immer besorgt, dass er zu viel Zeit auf See verbrachte.
»Aber, Tante Sally«, gab David zu bedenken: »Ich habe mich während der viereinhalb Monate meiner Rückreise von Indien erholen können, und jetzt bin ich schon fast drei Monate in England und genieße das Landleben.«
William nickte in Gedanken. Ja, auf der Überfahrt hatte sich David nicht von den vielen gesellschaftlichen Veranstaltungen an Bord eines Ostindienseglers ablenken lassen. Wie ein Einsiedler war er stundenlang an Deck herumspaziert, hatte nur mit dem kleinen Jungen gelacht und gescherzt, den er vor dem Ertrinken und dem Hai gerettet hatte. Allen anderen war er mit höflicher, aber nachdrücklicher Reserve begegnet. Und manche Damen hatten sich nur schwer abweisen lassen, denn seine Zurückgezogenheit erhöhte nur seine Attraktivität, die durch seine Taten in Indien, seinen Reichtum und seine todesmutige Rettung des Jungen zur Heldenverehrung geraten war. William wusste, dass Davids Gedanken immer wieder um Kamala kreisten, seine wunderbare und so schrecklich dahingeschiedene Frau. Erst die Nähe Europas hatte David wieder mehr an die Zukunft denken lassen.
Henry hatte der Verlobungsgesellschaft am nächsten Abend entgegengefiebert, denn dann wäre Claire, die Tochter des Schiffbaumeisters, den ganzen Abend mit ihm zusammen. Sie trafen sich im großen Gastzimmer des ›George‹, dem bekannten Wirtshaus für Offiziere und Herren vom Stande. Es war eine Feier im Kreis der Familie und der engsten Freunde. Schließlich war die Braut ja keine Jungfrau, sondern eine junge Witwe.
Bis auf einen Ratsherren und seine Frau kannte David alle, den Schiffbaumeister Grey mit Frau und Tochter, deren Aufmerksamkeit Henry ständig zu erregen suchte, den Reeder Foot mit seiner Frau und den Hafenadmiral, einen verwitweten, älteren Kapitän. Grey und Foot hatten ihn mit dem Onkel schon 1774 von London abgeholt, als er mit seinen dreizehn Jahren zu Besuch kam. Nach dem unerwarteten Tod seiner Eltern hatte er bei Onkel und Tante dann Heimat gefunden und wurde immer noch wie ein Sohn behandelt.
»Nun, Mr. Winter, denken Sie noch daran, wie ich Ihnen vor vierzehn Jahren die Werft zeigte? Was haben Sie alles erlebt in dieser Zeit? Wer hätte das gedacht?«
David lächelte. »Ich erinnere mich, Mr. Grey, an die Fahrt mit der Postkutsche, an die Besichtigung der Werft und auch an das Jahr dreiundachtzig, als Sie mir mein erstes eigenes Schiff zeigten. Es ist schön, Sie und Ihre Familie gesund wiederzusehen.«
Mr. Foot mischte sich ein. »Auch unsere Admiralität hätte Ihnen schon ein eigenes Schiff geben können, Mr. Winter. Gut acht Jahre sind Sie schon Leutnant. Was muss man denn noch tun, damit die Herren der Admiralität solche Taten bemerken?«
»Langsam, Mr. Foot!« Der Hafenadmiral schaltete sich ein. »Woher soll die Admiralität die Schiffe nehmen, wenn den Kaufleuten in Friedenszeiten jeder Penny für die Flotte als gotteslästerliche Verschwendung gilt? Ich kenne tapfere und fähige Offiziere, die sind nach mehr als dreißig Leutnantsjahren in Pension gegangen. Damit sage ich nichts gegen Ihre Verdienste, Mr. Winter.«
David nickte zustimmend, aber bevor er eine Meinung äußern konnte, trat der Onkel zu ihnen und sagte, sie möchten ihre Plätze bei Tisch einnehmen. Nach der Vorspeise hielt der Onkel eine kleine Rede, und David erfuhr dabei, dass das junge Paar nach der Hochzeit zu Weihnachten im Frühjahr mit dem neuen Schiff eine Fahrt nach Amerika unternehmen werde, um auch persönliche Bekanntschaften zu knüpfen oder zu erneuern, wie mit Mr. Borgmann.
Auch David erwähnte in seiner kleinen Ansprache Mr. Borgmann, dem William und er als Feind begegnet waren und der doch in schwerer Stunde mit ihnen gemeinsam dem Schicksal getrotzt habe. Aber vor allem dankte er William, der so viele Jahre an seiner Seite war, treu und unerschrocken. »Ich weiß es, liebe Julie«, schloss er, »wenn William an deiner Seite ist, kann dir niemand etwas anhaben. Er begleitet dich unbeirrt durch alle Gefahren und teilt mit dir auch alle Freuden. Möge euch Gott viele gemeinsame Jahre schenken!«
Julie trocknete einige Tränen und meinte, David müsse auch bei der Hochzeit eine Rede halten. Henry zischte so, dass seine Tante es hörte: »Wäre er doch geblieben, wo der Pfeffer wächst.«
Erschrocken fragte sie leise: »Meinst du etwa David?«
»Ja«, antwortete er kurz und wütend. »Siehst du nicht, dass Claire nur ihn den ganzen Abend anschaut, ihn förmlich anhimmelt.«
Tante Sally musste sich das Lachen verbeißen. »Du eifersüchtiger Gockel! Merkst du nicht, dass er das gar nicht beachtet. Das ist nur ein vorübergehender Schwarm für einen Helden, nichts für den Alltag.« Und sie betrachtete David, der auf ihren Wunsch in der Kapitänsuniform der Bombay-Marine erschienen war und den Orden des Nizams von Haiderabad trug. Ja, er sah blendend aus. Gebräunt, etwas melancholisch, eine Narbe auf der Stirn, eine an der Wange. Sie konnte Claire mit ihren sechzehn Jahren verstehen. Aber David würde wohl nicht einmal bemerken, wie er da bewundert wurde.
Als die Postkutsche am nächsten Morgen losratterte, sagte sich David, dass er doch etwas weniger hätte trinken sollen. Nicht, dass er sich betrunken hätte, nein, es war nur bis zu dem wohligen Schwimmen in freundlichen Gefühlen gegangen, das die ständigen Trinksprüche erzeugt hatten. Aber jetzt schmerzte der Kopf, und er schloss die Augen.
Hassan saß oben auf der Kutsche und hatte wie David die geladene Pistole im Gürtel. Immer wieder waren sie vor Straßenräubern gewarnt worden. »Old England ist nicht mehr das, was es vor dem Krieg war, Mr. Winter. Zu viel Gesindel will nicht mehr arbeiten, sondern nur kassieren«, hatte Mr. Grey die populären Klagen zusammengefasst.
Aber Stunde um Stunde verrann unbehelligt, und nach dem Mittagessen und dem Tee in einem Landgasthaus fühlte sich David besser. Für Hassan war immer noch vieles neu an der englischen Landschaft, und er erzählte David, was er von seinem luftigen Sitz aus entdeckt hatte.
David blickte nun öfter auf die Landschaft und sah sie mit den Augen eines Fremden. Wenn er sie Kamala hätte zeigen können ... Und er versank in Erinnerungen.
Die Stimme der korpulenten Dame, die neben ihm saß, riss ihn aus seinen Gedanken. »Sie sind kein unterhaltsamer Reisegefährte, mein Herr«, sagte sie vorwurfsvoll. »Wenn sich Mr. Wrigley nicht meiner erbarmt hätte, wäre ich vor Langeweile gestorben. Wie soll man eine Fahrt von mehr als zehn Stunden ohne Abwechslung ertragen?« Und sie blickte Mr. Wrigley an, einen rotbäckigen Fleischhändler, der geschmeichelt nickte.
David konnte diese dicken Schwatztanten auf den Tod nicht ausstehen, aber er bemühte sich um Verbindlichkeit und entschuldigte sich mit körperlichem Unbehagen. Das hätte er lieber nicht tun sollen, denn nun informierte ihn seine Nachbarin über alle Heilverfahren, die sie selbst erprobt hatte, und das waren nicht wenige. Seit fünf Minuten sprach sie schon über das Ansetzen von Blutegeln, als vom Kutschbock eine Stimme rief: »Zehn Minuten bis Ripley. Kurze Teepause.«
»Dann sind wir in spätestens zwei Stunden am Ziel«, hatte der dicke Fleischhändler gerade festgestellt, als ein Chaos ausbrach. Schrille, laute Stimmen von draußen, Schüsseknallen, kreischende Bremsbeläge, da der Kutscher die Klötze mit Macht an die Räder drehte, Pferdewiehern in Todesangst, und dann kippte die Kutsche langsam, aber unaufhaltsam auf die Seite, auf der David saß.
Während des Bremsens hatte er sich am Türrahmen abgestützt, um nicht auf den Fleischhändler zu rutschen, aber nun half nichts mehr. Die dicke Nachbarin fiel mit schrillem Kreischen auf ihn, drückte ihn in den Staub, der durch das offene Fenster in die Kutsche waberte, und begrub ihn fast unter ihren Massen.
David versuchte, sich auf den Bauch zu rollen, um sich abzustützen und das dicke Weib zur Seite zu drücken. Von draußen hörte er Schreie und Säbelgeklirr. Die Angst um Hassan verlieh ihm ungeahnte Kräfte, und er konnte schließlich unter der nunmehr ohnmächtigen Frau hervorkriechen.
Noch hatte er sich nicht aufgerichtet, da tauchte am jetzt himmelwärts zeigenden Kutschenfenster ein bärtiges, fremdes Gesicht auf, und eine raue Stimme brüllte: »Geld und Schmuck her, wenn euch das Leben lieb ist!«
Fast reflexartig zog David seine doppelläufige Pistole, spannte einen Hahn und schoss kniend mitten in das bärtige Gesicht. Dann richtete er sich auf, griff nach dem oberen Türrahmen und zog sich hoch. Bevor er nach außen sah, spannte er den zweiten Lauf und tastete nach seinem Säbel im Gepäckfach.
Er sah einen anderen Kerl fluchend die Kutsche erklimmen, um an die Tür zu gelangen, von der der Kumpan blutüberströmt hinuntergesunken war. Noch einmal schoss David, und der Kerl fiel zurück. Dann schwang sich David heraus und saß auf dem Türrahmen.
Fünf Meter entfernt tobte ein schwerer Kampf. Hassan wehrte sich mit dem Kris gegen drei Angreifer. Der Kutscher und der Wächter lagen bereits am Boden, aber Hassan schlug hier einen Säbel nieder, trat dort einem Burschen den Fuß vor die Brust und wehrte sich seiner Haut.
David sprang von der umgestürzten Kutsche, griff in seine Unterarmmanschette und zog das erste Wurfmesser. Er suchte festen Stand, schwang den Arm zurück und schleuderte das Messer einem Angreifer zwischen die Schulterblätter. Während dieser noch beide Arme zur Seite riss und röchelnd stöhnte, hatte David schon das zweite Messer gezogen. Laut brüllte er, damit sich der Angreifer ihm zuwandte, und warf ihm das Messer dann in die Kehle.
Hassan stieß kraftvoll den Säbel des dritten Mannes beiseite, aber der ließ den Säbel fallen und rannte wieselflink davon. »Danke, Tuan, Sie haben noch nichts verlernt.« Und er zog die Luft ein, erschöpft vom hitzigen Kampf.
David sah sich um. Der Kutscher war verletzt und ohnmächtig. Aber der Wächter, der auf dem Kutschbock mitgefahren war, gab kein Lebenszeichen mehr von sich. »Er hat sie zuerst gesehen und den ersten erschossen«, sagte Hassan und deutete auf einen Körper, der in der Fahrrinne lag.
»Dann waren es ja sechs Banditen«, stellte David erstaunt fest. Inzwischen war der Fleischermeister aus dem Kutschwagen gekrochen. »Holt denn keiner Hilfe?«, rief er klagend.
»Gehen Sie, wir kümmern uns um den Verwundeten und um die Pferde«, schlug David vor. Aber der Dicke lehnte entsetzt ab. Da könnten ja noch viele Banditen lauern.
»Sie Hasenfuß!«, knurrte David ärgerlich. »Dann schirren sie wenigstens die Pferde aus und erlösen das eine dort von seinen Qualen. Hassan, lauf du voraus ins Dorf und hole Hilfe! Sie sollen nach einem Arzt schicken.« Und er beugte sich zum Kutscher und suchte die Wunde.
Während er noch das Hemd aufriss, um an die Wunde heranzukommen, erscholl von der Kutsche her markerschütterndes Hilfegeschrei. David kümmerte sich nicht darum, sondern band die Wunde am Oberarm ab. Aber der Fleischhändler lief entsetzt zur Kutsche. Die dicke Reisegefährtin zwängte ihren Kopf aus der Tür und brüllte weiter. »Ich sterbe, ich sterbe. Zu Hilfe!«, wiederholte sie immer wieder.
Der Fleischhändler sah sich ratlos um und rief David an. »Kommen Sie und helfen Sie!«
David schüttelte den Kopf. »Die kriegen wir ohne Hilfe nie heraus. Kümmern Sie sich jetzt endlich um die Pferde! Ich untersuche die Banditen.« Und zur Reisegefährtin sagte er laut und entschieden: »Ihnen ist nichts geschehen. Es ist alles vorbei, aber Sie müssen warten, bis Hilfe aus dem Dorf eintrifft. Seien Sie ruhig, sonst locken Sie andere Banditen an!«
Die Stimme brach ab und wurde durch leises Wimmern abgelöst. David sah, dass der eine Bandit, dem er das Messer zwischen die Schulterblätter geworfen hatte, noch lebte und mit Blutblasen vor dem Mund keuchend atmete. »Wie heißt euer Anführer?«, herrschte er ihn an. Der Bandit antwortete nicht. David legte ihm die Hand um den Hals. »Sag es lieber, sonst erlebst du die Ankunft des Arztes nicht mehr.« Und als er etwas zudrückte, keuchte der Bandit heraus: »Greg Dorten.«
Von der Straße her erschollen Stimmen, und nun sah David auch Menschen heranlaufen, Hassan unter ihnen. Einer war der Bürgermeister. Er klagte, das sei schon der dritte Überfall in zehn Monaten, aber diesmal seien die Burschen wohl an die Falschen geraten. Er sah sich um und scheuchte neugierige Mitbürger von den Toten fort. »Arzt und Friedensrichter sind schon benachrichtigt«, erklärte er David. »Nun wollen wir erst mal die Kutsche aufrichten. Ach Gott, ein Rad ist gebrochen. Der Schmied soll kommen.«
Und dann dirigierte er die Leute, an der Kutsche anzupacken, und brachte die dicke Passagierin dazu, dass sie sich richtig festhielt, als sie die Kutsche langsam aufrichteten, bis sie dann mit einem Plumps wieder auf die Räder fiel.
Ein Reiter kam heran, löste eine Tasche vom Sattel und ging auf sie zu. »Der Arzt«, erklärte der Bürgermeister, aber dieser kümmerte sich nicht um Formalitäten, sondern untersuchte die am Boden liegenden Männer. »Vier Tote und ein Schwerverletzter, der kaum durchkommen wird. Das gibt Geschrei im Lande. Ist Kapitän Grant schon benachrichtigt?«, fragte er.
»Ja«, antwortete ihm der Bürgermeister, »er wird wohl bald erscheinen.«
David hatte gestutzt, als der Name genannt wurde. »Was für ein Kapitän wird erwartet?«
»Na, Kapitän Grant, der Friedensrichter. Er hat bei den Saints ein Linienschiff kommandiert. Ein strenger und gerechter Mann.«
Davids Gedanken wanderten zurück. Thomas Grant, Erster auf der Shannon anno 74, sein Kapitän auf der Ariadne und Anson, dieser großartige Kommandant. Hier sollte er ihn wiedersehen? Als Hufgetrappel erklang, hielt er sich ein wenig im Hintergrund und ließ den Arzt und den Bürgermeister mit Grant reden. Er ist immer noch hager und ernst, dachte David, aber sein Haar ist grauer geworden. Wie alt mag er sein? Etwa zweiundvierzig.
Und dann trat Grant, geleitet vom Bürgermeister, schon auf ihn zu. »Mein Herr, wie ich hörte ...«, begann Grant, aber dann hielt er inne, starrte David an, bis ein Lächeln sein Gesicht löste und er sagte: »Mr. Winter, welche Freude, Sie wiederzusehen. Nun wundere ich mich nicht mehr, dass hier so viele Banditen niedergestreckt liegen. Die hätten lieber nicht mit einem anbändeln sollen, der schon ganze Schiffe allein erobert hat.« Und er fasste Davids Hand mit beiden Händen und schüttelte sie herzlich und bewegt.
Auch David war gerührt, und seine Stimme klang belegt. »Sir, ich kann Ihnen nicht sagen, wie sehr ich mich freue, Sie gesund zu sehen. Ich war über vier Jahre in der Bombay-Marine und hatte nichts von Ihnen gehört. Ich wusste auch nicht, dass Sie hier leben.«
Grant in seiner spröden, sachlichen Art lächelte noch einmal und sagte dann: »Wir werden uns viel zu erzählen haben, wenn Sie heute Nacht mein Gast sind. Aber jetzt berichten Sie mir bitte kurz, was sich hier abgespielt hat!«
David erzählte und nannte auch den Namen des Anführers, den er erfahren hatte.
»Greg Dorten«, murmelte Grant, während der Bürgermeister erschrocken aufsah. »Ein bekannter Mörder, der dem Galgen entfloh. Wir dachten, er sei außer Landes, aber nun treibt er wieder hier sein Unwesen. Hoffentlich verleidet ihm diese Niederlage seine hiesigen Pläne.« Und Grant entschuldigte sich, um mit dem Arzt und dem Schmied zu sprechen.
Als er zurückkam, sagte er: »Heute ist an Weiterfahrt nicht zu denken. Der Schmied wird das Rad bis morgen früh repariert haben. Die anderen Reisenden kommen im Gasthof unter, aber Sie und Ihr Diener kommen mit mir. Ich habe schon nach der Kutsche geschickt. Wir können ihr langsam entgegengehen.«
David winkte Hassan, der das leichte Gepäck aus der Kutsche holte und hinter den beiden die Straße entlangging. Grant schwieg erst und sagte dann leise: »Wir haben uns zuletzt nach der Schlacht bei den Saints im März dreiundachtzig gesehen, Mr. Winter. Ich bin im Herbst dann auf Halbsold gesetzt worden, als die Anson außer Dienst gestellt wurde. Gott sei Dank hatte ich genügend Prisengeld, um uns hier ein Landhaus mit großem Garten und ein wenig Wald zu kaufen. Sie werden hier eine glückliche Familie finden. Zu meinen beiden Töchtern wurde uns ein Sohn geboren, jetzt vier Jahre alt. Wir haben keine Sorgen, wenn wir auch sparen müssen, aber, verdammt noch einmal, Mr. Winter, die Sehnsucht nach einem Kommando frisst mir das Herz ab.«
Betroffen sah ihn David an. »Hat die Admiralität in den fünf Jahren keine Verwendung für Sie gehabt, Sir?«
»Für mich nicht und für Hunderte von anderen Kapitänen und Tausende von Leutnants auch nicht. Drei Viertel der Schiffe sind außer Dienst und rotten vor sich hin. Die Mannschaften betteln, stehlen oder sind irgendwo untergekrochen. Die Offiziere drehen jeden Penny um, um vom Halbsold ihr Leben zu fristen. Aber das Schlimmste ist, dass wir an Land nur Gäste sind. Unsere Heimat ist die See, dieses unendlich große, wunderbare Meer.«
David hätte nie gedacht, dass Grant so sehnsuchtsvoll schwärmen könnte, aber er verstand ihn. Wer Jahre hindurch die Klarheit und Frische der See erlebt hat, den lässt sie nicht mehr los.
Grant sprach weiter. »Ich hätte in der russischen Flotte unterkommen können, aber das konnte ich meiner Familie nicht zumuten. Einmal habe ich als gut bezahlter Gast einem Reeder sein neues Schiff nach Kopenhagen und zurück geführt. Er wollte die Jungfernfahrt kommandieren, wusste aber, dass er Hilfe brauchte, und so war ich wieder einige Monate auf See. Ich musste Ihnen das jetzt schon sagen, denn vor meiner Frau will ich das Thema nicht anschneiden.«
Grants Frau sah nicht nur gut aus, sie schien auch eine perfekte Hausfrau und Mutter zu sein. Sie begrüßte David herzlich und sagte ihm, dass sie seinen Namen schon oft gehört habe und sich freue, ihn nun zu sehen. »Mein Mann hat mir erzählt, wie Sie ihm vor Charleston das Leben gerettet haben. Wir stehen tief in Ihrer Schuld.« Und mit leichter Hand regelte sie die Unterkunft für die beiden unerwarteten Gäste und das Abendessen.
Als sie am Abend dann noch auf der Terrasse saßen und ein Glas Wein tranken, sprach sie über das Leben auf dem Lande, den großen Garten, der sie mit Obst und Gemüse versorge. Sie erzählte von den Kindern, die ihnen Freude bereiteten, erwähnte, dass sie glücklich sei, weil ihr Mann vor Jahren zum Friedensrichter gewählt wurde. Das sei eine Aufgabe, und den Ehrensold könnten sie auch gebrauchen. »Aber ich weiß natürlich, dass ihm die See und ein eigenes Schiff fehlen. Einem Mann reicht das kleine, ländliche Glück nicht, das mich erfreut. Ich bin dankbar, dass ich es so lange genießen durfte.«
Grant nahm liebevoll ihre Hand. »Du bist eine wunderbare Frau, Rachel, und verstehst mich so gut. Wenn ich auf See bin, sehne ich mich nach dir und den Kindern. Aber die See ist in unserem Blut. Flottenoffiziere kommen davon nicht los, das weiß auch Mr. Winter.«
Sie sprachen noch über Davids Erlebnisse in Indien, über Kameraden aus früherer Zeit und darüber, was die Zukunft wohl bringen möge. David gab zu, dass sich in ihm bei der Einladung zur Admiralität Hoffnung auf Verwendung in der Flotte geregt habe. Aber wenn ein so herausragender Kapitän wie Grant kein Schiff erhalte, sei seine Hoffnung wohl illusorisch.
»Es läuft nichts ohne persönliche Beziehungen. Die eigene Tüchtigkeit zählt erst in zweiter Linie«, sagte Grant resigniert.
David lag noch lange wach und dachte über die Grants nach. Wie wäre es ihm und Kamala an Land ergangen?
Ein Sekretär holte David in der Halle der Admiralität ab und führte ihn zum Arbeitszimmer des Herzogs von Chandos. Er öffnete die Tür und ließ David eintreten. Martin erhob sich hinter dem Schreibtisch, lächelt aber nur kurz und flüchtig und bat den Sekretär: »Geben Sie mir bitte die Urkunde, Mr. Solby.«
Mit der Urkunde in der Hand schaute er David fest an und sagte: »Mr. Winter, die Lords der Admiralität haben geruht, Sie zum Master und Commander mit Wirkung zum Ersten dieses Monats zu ernennen. Ich gratuliere Ihnen recht herzlich zu dieser lange verdienten Beförderung.« Er nahm die Urkunde in die linke Hand, streckte David die rechte entgegen, der sie verdutzt ergriff und immer noch fassungslos mühsam sein ›Ergebensten Dank, Mylord‹ herausbrachte.
Nun blickte der Schalk aus Martins Augen, und er sagte zu Mr. Solby: »Sie können uns nun den Champagner einschenken und uns dann allein lassen. Wir haben viel zu besprechen.«
Als der Sekretär die Tür geschlossen hatte, trat Martin auf David zu und fasste ihn bei beiden Schultern. »David, alter Freund, haben Sie sich von der Überraschung erholt? Möge es nie eine unangenehmere für Sie geben. Gut schauen Sie aus. Gebräunt und gesund wie ein alter Seemann. Auf Ihr Wohl, und dann müssen Sie erzählen.«
Als sie den ersten Schluck getrunken hatten, sagte David: »Ich bin sehr glücklich und dankbar, Martin. Als ich gestern nach dem Überfall mit Kapitän Grant sprach, hatte ich nicht gehofft, dass die Admiralität ein Schiff für mich haben könnte.«
Über Martins Gesicht zog ein Schatten. »Tut mir leid, David, ein Schiff haben wir nicht, nicht hier. Aber darüber sprechen wir gleich. Was für einen Überfall meinen Sie, und wer ist Kapitän Grant?«
David verbarg seine Enttäuschung und berichtete von dem Überfall und von Grant, jetzt Friedensrichter. Aber er hob hervor, was für ein ausgezeichneter Kommandant Grant stets gewesen sei.
Martin fragte nach: »Kann dieser Grant aus einem verlotterten Schiff wieder eine Kampfeinheit formen? Kann er Offizieren und Mannschaften demonstrieren, was er von ihnen erwartet?«
David bestätigte es mit Nachdruck, und der Herzog läutete nach dem Sekretär. »Bringen Sie mir die Akte Janus und die Personalpapiere von Kapitän Grant. Wie heißt er mit Vornamen?«
»Thomas«, antwortete David und fügte hinzu: »Zuletzt Hector, anno dreiundachtzig.«
Martin erklärte: »Ich habe gerade gestern den Antrag eines Vetters erhalten, der sich ins Parlament wählen ließ und nun um Urlaub für zunächst zwei Jahre bat. Er kommandiert die Vierundvierzig-Kanonen-Fregatte Janus, Gott weiß, wer ihm das Kommando verschaffte. Er ist kein guter Offizier, und das Schiff ist verlottert. Da der Antrag noch nicht in der Admiralität kursierte, haben die anderen noch keine Interessen anmelden können, und ich habe gute Aussicht, meinen Vorschlag durchzubringen. Die Janus soll an der Barbareskenküste den Piraten Respekt beibringen. Wird Grant annehmen?«
Das konnte David versichern, und Martin gab dem Sekretär, als er die Akten brachte, Auftrag, die nötigen Schreiben vorzubereiten. Dann wandte er sich an David: »Aber nun zu Ihnen, David. Sie werden wissen wollen, was wir mit Ihnen vorhaben.«
Er nahm noch einen Schluck, kündigte an, dass er ein wenig ausholen und zunächst erklären müsse, dass er in der Geschäftsverteilung der Admiralität für Nachrichten über fremde Flotten und Flottenpolitik zuständig sei.
»Mit Frankreich, das seine starke Flotte auch abgerüstet hat, leben wir in Frieden. Die ehemaligen amerikanischen Kolonien haben auf eine erwähnenswerte eigene Flotte verzichtet. Von Spanien geht keine Beunruhigung aus. Sorgen bereitet uns nur der Ostseeraum. Wir brauchen ihn für unseren Handel und für Nachschub an Segeltuch, Tauen und Schiffsholz. Dänemark, Schweden und Russland haben jeder eine relativ starke Flotte. Russland ist mit Dänemark verbündet und hat mit uns gemeinsame Interessen. Aber Russlands Expansionsdrang trifft auf schwedische Hegemoniegelüste, und zwischen beiden Ländern kann jeden Tag der Krieg ausbrechen.«
David warf ein: »Aber herrscht nicht bereits Krieg zwischen Russland und der Türkei? Da kann sich die Zarin doch nicht noch einen Gegner aufhalsen.«
»Das will sie auch nicht. Sie möchte erst mit den Türken fertig sein. Aber Gustav III., der junge König von Schweden, ist mit der Türkei verbündet, kann von ihr große Zahlungen erwarten, wenn er Russland in einen Krieg im Norden verwickelt und es hindert, wieder Geschwader ins Mittelmeer zu entsenden wie anno neunundsechzig. Schweden wird außerdem traditionell von Frankreich unterstützt, hat in seiner Flotte französische Signalsysteme und anderes mehr. Wir dagegen haben seit Beginn Russland beim Aufbau seiner Flotte unterstützt. Ohne Englands Hilfe und unsere Flottenführer Elphinstone und Greigh hätten die Russen nie bei Tschesme die türkische Flotte vernichtet. Auch jetzt kommandiert Greigh die baltische Flotte der Russen, und wir entsenden Offiziere und Handwerker, um beim Flottenaufbau zu helfen. Russland kommt mir wie ein unerfahrener, tollpatschiger Riese vor. Sie haben Menschen und Bodenschätze im Überfluss, aber wo es um menschliches Können in Handwerk, Wissenschaft, Militär und Handel geht, da erreichen sie ohne fremde Hilfe nicht viel. Die Zarin hat den Ausbau der Flotte zu ihrer Herzensangelegenheit gemacht. Diese Dame ist aber ein wenig exzentrisch und hat nun ausgerechnet Paul Jones zum Konteradmiral ernannt, jenen amerikanischen Kapitän mit der etwas zwielichtigen Vergangenheit.«
David fragte: »Ist das der Jones, der mit seiner Bonhomme Richard die Serapis zur Übergabe zwang, wobei ihm das eigene Schiff unter den Füßen versank?«
»Genau der«, bestätigte Martin. »Unter ihm wollten die britischen Offiziere nicht dienen, und so haben sie den russischen Dienst quittiert. Zwar haben die Russen den Jones dann gleich zum Schwarzen Meer abgeschoben, aber der Schaden war da. Etwa achtzig Offiziere sind aus Russland abgereist. Und nun müssen wir qualifizierten Ersatz schaffen. England hat ein vitales Interesse an dieser Mission. Wir müssen zunächst einmal wissen, wie stark die russische Flotte tatsächlich ist. Vor allem aber sollen ihre Offiziere uns als Verbündete und Mentoren sehen. Darum bitten wir Sie, David, in der russischen Ostseeflotte Dienst zu tun. Wir garantieren Ihnen das Kommando über eine Fregatte und die entsprechende Heuer, die Sie in England dafür erhalten würden. Die Hälfte der Heuer kann auf Wunsch auch auf englische Banken überwiesen werden. Wenn Sie dort zwei Jahre dienen, sichere ich Ihnen zu, dass Sie nach der Rückkehr zum Kapitän unserer Flotte befördert werden. Überlegen Sie es sich gut, aber entscheiden Sie sich bitte bald. Sie müssten in drei Wochen abreisen. Ihr Freund Haddington ist übrigens jetzt Konteradmiral in der Schwarzmeerflotte.«
David war verwirrt. Das Kommando über eine Fregatte war ein verlockendes Angebot. Der Kapitänsrang in der britischen Flotte war der Traum eines jeden Leutnants, aber er wusste ja gar nichts von Russland, der baltischen Flotte, kannte die Sprache nicht. Er bemerkte, dass Martin ihn fragend ansah und auf eine Reaktion wartete. Was sollte er sagen?
Schließlich bedankte er sich zunächst einmal für das Angebot und fügte hinzu: »Ich bin so überrascht, Martin, dass ich mich nicht sofort entscheiden kann. Bitte verstehen Sie das. Ich kann ja auch kein Wort Russisch. Viele Fragen werden mir noch einfallen, jetzt schon möchte ich aber wissen, ob ich meinen Diener, bewährte Deckoffiziere und vielleicht einen Leutnant zu vergleichbaren Bedingungen mitnehmen kann.«
Martin sagte ihm zu, dass er Offiziere und Deckoffiziere anwerben könne, und sicherte auch zu, dass jedem Kapitän ein persönlicher Dolmetscher zur Verfügung stehe, der ihn schon auf der Hinreise begleiten werde. »Aber nun überlegen Sie sich das alles in Ruhe: Sammeln Sie Ihre Fragen. Und heute Abend müssen Sie erzählen. Ich lade Sie zum Dinner in meinen Klub ein, sagen wir acht Uhr?«
David überlegte, dass er zum Tee bei Susan vorsprechen wollte, dann aber genügend Zeit für Martin habe, und nahm dankend an.
»Lassen Sie sich bald eine neue Uniform anfertigen, Herr Commander, und vergessen Sie Ihre Urkunde nicht.« Martin klopfte ihm zum Abschied freundschaftlich auf die Schulter.
David verließ die Admiralität in Gedanken versunken, ohne nach rechts oder links zu schauen. Russland! Oft genug hatte ihn sein früherer Kommandant und Freund Haddington schon gebeten, zu ihm zu kommen. Ob er ihn jetzt angefordert hatte? Die britische Admiralität konnte ja anscheinend russische Kriegsschiffe vergeben, als ob es eigene wären. Und niemand kannte sich aus und konnte ihm raten. Wenn Sir Abraham noch lebte. Der wusste immer alles.
Das Schild eines Gasthauses lenkte Davids Aufmerksamkeit auf sich. Ja, erst einmal hinsetzen, ein Bier trinken und in Ruhe nachdenken. Er trank den ersten Schluck mit Genuss. Das erfrischte. Russland interessierte ihn wenig. Aber die Aussicht auf den Kapitänsrang in der britischen Flotte, das zählte. Und wenn er Martins Vorschlag jetzt ablehnte, würde der ihm noch einmal diesen Rang anbieten können? Nein, nachtragend und übelnehmend war Martin nicht. Aber hätte er unter anderen Bedingungen diese Möglichkeit?
David nahm noch einen kräftigen Schluck und sah zur Theke, ob es Sandwiches gab. Und da erinnerte er sich: In dieser Wirtschaft hatte er vor seinem Indienkommando mit Andrew Harland gesessen, Freund aus der gemeinsamen Dienstzeit auf Shannon, Exeter und Anson. Dessen Vater wollte ihn doch als Maat auf einem Schiff im Russlandhandel unterbringen. David winkte dem Wirt und fragte, ob er Leutnant Harland noch kenne.
Der Wirt kannte ihn noch. »Leutnant Harland wohnt seit einem Vierteljahr hier in der Nähe in einem Zimmer, Sir. Wenn er etwas Geld hat, kommt er noch hierher.«
David gab dem Wirt Geld und bat, Harland holen zu lassen. Sein Freund David Winter warte hier.
Andrew Harland schien es nicht sehr gut zu gehen. Er war etwas ärmlich gekleidet und sah blass aus. Aber das tat seiner Freude über das Wiedersehen keinen Abbruch. David lud ihn zu Bier und Sandwich ein, und dann wollte jeder vom anderen wissen, wie es ihm ergangen sei.
Andrew hatte nach dem Lotterurlaub in Margate (Du solltest mitkommen, weißt du noch?) drei Jahre auf einem Handelsschiff gedient und war immer zwischen London und St. Petersburg oder Reval hin- und hergesegelt. »Wenn wir London anliefen, bin ich immer sofort zur Admiralität gerannt und habe um eine Kommission gebettelt. Vor einem halben Jahr erweckten sie Hoffnungen auf eine bevorstehende Kommandierung, und ich gab die Stelle als Maat auf. Aber es wurde wieder nichts, ich musste das Zimmer im Hotel räumen, hause jetzt hier in einem kleinen Loch und lasse mich von den Tintenklecksern in der Admiralität weiter vertrösten.«
David war bei Reval und St. Petersburg hellhörig geworden. »Dann kennst du die dortigen Gewässer. Kannst du auch etwas Russisch?«
»Etwas schon, um im Hafen und den Kneipen zurechtzukommen. Aber die Schrift kann ich nicht lesen. Das ist ein verrücktes Land, sage ich dir. Wer Geld hat, kann dort sein Glück machen. Die Zarin lässt sogar Handelsschiffe bauen und verleiht sie, um den Auslandshandel auf russischen Schiffen zu fördern. Die eigenen Händler haben überhaupt keine Courage.«
»Andrew, was würdest du tun, wenn sie dir ein Kommando in der russischen Flotte anböten?«
»Annehmen, David, dann hätte ich wenigstens wieder etwas Anständiges zu beißen. Und die Flotte ist englandfreundlich und wird ausgebaut.«
David war das keine große Hilfe, denn zu beißen hatte er auch hier genug. Er fragte nach. »Was weißt du über die russische Flotte, Andrew?«
»Gott ja, sie bauen viele Schiffe, manche wohl auch aus schlechtem und frischen Holz, wie man sagt. Ihnen fehlen gute Seeleute. Unter den Mannschaften sind viel ausgehobene Bauernburschen. In den Reihen der Offiziere findest du Engländer, aber auch Holländer, Italiener und welche aus dem Deutschen Reich. Warum fragst du?«
David erwiderte mit einer Gegenfrage. »Warum hast du dich nicht selbst um Dienst in der Flotte der Zarin bemüht?«
»Weil sie genug Offiziere hatten, als ich dort war. Und jetzt habe ich nicht das Geld, um hinzukommen, und hier kenne ich niemanden, der mir das vermittelt. Aber jetzt rück endlich raus, was hinter dieser Fragerei steckt!«
»Mir wurde heute das Kommando über eine russische Fregatte angeboten. Heuer nach englischen Stufen garantiert, auf Wunsch Auszahlung der Hälfte auf britische Banken. Die Dienstzeit wird hier angerechnet. Ich wurde zum Commander befördert, und mir wurde nach Rückkehr sogar eine Beförderung zum Kapitän in Aussicht gestellt. Was würdest du an meiner Stelle tun?«
Andrew war perplex. »Donnerwetter, das ist ja großartig. Ich gratuliere dir. Jetzt muss ich ja ›Sir‹ sagen.«
David wehrte ab. »Doch nicht, wenn wir unter uns sind, Andrew. Aber würdest du mit mir kommen, wenn du als Erster Leutnant auf einer Fregatte dienen könntest?«
Ohne Zögern antwortete Andrew: »Sofort, David. Und du würdest es nicht bereuen.«
»Gut«, sagte David. »Wenn ich annehme, bist du dabei. Wir treffen uns hier morgen Mittag und gehen dann essen. Jetzt muss ich zum Schneider, dann steht ein Besuch auf dem Programm, und abends esse ich mit dem Herzog von Chandos.«
»Du hast wohl das Glück gepachtet, David. Aber lieber du als ein anderer.«
»Morgen werde ich dir erzählen, Andrew, warum ich vor wenigen Monaten glaubte, das Unglück gepachtet zu haben. Und was mir jetzt geboten wird, wiegt den Verlust nicht auf. Aber das lassen wir bis morgen.«
Der Schneider, der für David schon mehrere Uniformen angefertigt hatte, gratulierte herzlich und begann sogleich, mit dem Messband zu hantieren. »Etwas mehr um die Hüften, der Magen etwas stärker, die Schultern ausladender, Länge gleich«, murmelte er seine Vergleiche mit den letzten Maßen vor sich hin.
»Ich bin wohl richtig fett geworden?«, scherzte David und wollte das Gegenteil hören.
»Nun ja, Sir, man wird älter, und Sie haben auf See nicht viel Bewegung, aber man kann es noch nicht fett nennen. Und wir kaschieren das alles mit einem geschickten Schnitt. Übrigens könnten Sie in zwanzig Minuten schon einen Ersatzrock haben. Ich bräuchte vom Uniformrock für einen Kapitän nur die weißen Revers abzutrennen und durch hellblaue ersetzen zu lassen, Sir.«
David überlegte einen Augenblick. Warum sollte er Susan nicht gleich mit dem neuen Rang gegenübertreten? »Gut, ich warte den Augenblick und schaue etwas in die neueste Gazette. Können Sie meinen eigenen Leutnantsrock noch in die Alltagsuniform für einen Commander umarbeiten?«
»Ich sehe ihn mir gleich an. Wir tun, was wir können, Sir.«
Als Susan den Salon der Bentrows betrat, in dem David einen Augenblick gewartet hatte, erkannte sie den neuen Rang sofort. Sie fasste David um und küsste ihn leicht auf die Wange. »Wie freue ich mich, dich gesund wiederzusehen, David, und dann noch als Commander des Königs. Herzlichen Glückwunsch! Ich habe so sehr gewartet, seit ich von deiner Rückkehr hörte. Der Hausmeister sagte, dass du vor drei Monaten vorgesprochen hast, aber damals waren wir auf den Gütern in Schottland. Aber nun setz dich erst einmal.«
Susan hatte sich verändert in den fünf Jahren. Sie war eine reife Schönheit, dezent und geschmackvoll gekleidet. Um die Augenwinkel sah man erste Fältchen. David wusste seit seiner Liebe zu Kamala, dass er Susan nicht mehr liebte. Er fühlte auch bei ihrem Anblick nicht anders. Aber das tiefe Gefühl der Verbundenheit, der Zuneigung und Wertschätzung war geblieben.
»Du bist unverändert schön«, sagte er fast ehrlich. »Ich hoffe, es geht dir gut und auch John, unserem Sohn.«
Susan reichte ihm ein Glas Portwein und setzte sich ihm gegenüber. »Ja, es geht uns gut, David. John ist groß für seine sieben Jahre, ein kluger, unternehmungslustiger Junge. Er erinnert mich immer wieder an dich. Sein Hauslehrer ist sehr zufrieden mit ihm. John wird in einer halben Stunde kommen. Ich wollte erst mit dir allein sein. Stimmt es, dass du in Indien verheiratet warst und deine Frau verloren hast?«
David neigte den Kopf. Der Schmerz stieg wieder empor. Er sprach leise, und Susan musste sich anstrengen, ihn zu verstehen. Er versuchte, Kamalas Schönheit zu beschreiben, ihre Klugheit, ihre Weisheit, anders konnte er es auch bei einem so jungen Menschen nicht nennen, und ihre alles umschließende Liebe.
»Sie wurde von Piraten entführt, die ihren Vater erpressen und sich vielleicht auch an mir rächen wollten. Sie tötete sich, als man sie entehrte. Ich fand nur ihre Leiche. Sie trug unser Kind in sich.« Seine Stimme versagte, und er nahm eine Hand vor seine Augen.
Susan setzte sich neben ihn, legte die Hand um seine Schulter und lehnte ihren Kopf gegen seinen. »Armer David! Wie furchtbar. Du leidest mehr, als ein Mensch ertragen kann. Wie musst du sie geliebt haben. Wenn ich dir nur helfen könnte.«
»Niemand kann mir helfen, Susan. Ich muss den Schmerz selbst überwinden. Es hilft mir sehr, dass Kamala so fest an eine Wiedergeburt auf dieser Erde glaubte. Manchmal fühle ich fast, dass sie mir nahe ist. Sie war die Tochter eines der engsten Freunde deines Vaters, des Bankiers Rustomjee.«
Susan hatte ihm mitfühlend, auch ein wenig verwirrt zugehört, aber jetzt wanderten ihre Gedanken nach Kalkutta. »Ich erinnere mich dunkel an einen sehr reichen und sehr klugen Mann, an zwei Söhne und ein kleines, schönes Mädchen. Und dann waren dort die bärtigen Sikhs als Wachen. Wir waren manchmal bei ihm. Mein Vater schätzte Mr. Rustomjee sehr. Und nun fehlt mir mein Vater so sehr. In seiner letzten Stunde sagte er: ›Grüßt David, meinen Sohn.‹ Er wusste, dass du der Vater seines geliebten Enkelsohnes warst, obwohl ich es ihm nie gesagt hatte, und er liebte dich deswegen noch mehr, David.«
Sie saßen beide mit feuchten Augen auf dem Sofa und hielten ihre Hände, als John lebhaft und neugierig in den Salon lief. Er stutzte. »Warum weinst du, Mutti? Ist das Onkel David? Hat er dir etwas angetan?«
»Aber nein, das könnte er nie. Wir haben an deinen Großvater gedacht, den wir beide so lieb hatten, und darum sind wir traurig. Aber nun kannst du uns zum Lachen bringen. Gib Onkel David die Hand. Er war so lange Jahre in Indien.«
»Guten Tag, Sir. Erzählen Sie von Ihren Abenteuern?«
David musste lächeln. Die Augen Johns erinnerten ihn an Sir Abraham, die Wangen an Susan, und die Nase und die lebhafte, zupackende Art, das war wohl er. »Lass uns erst auspacken, was ich dir aus Indien mitgebracht habe, John. Vielleicht gefällt es dir.«
Und er packte die Kriegsrüstung eines malaiischen Piraten mit Brustharnisch, Federhaube und Langspieß aus. John war zunächst sprachlos und jubelte dann: »Sieh nur, Mutti, so bunt geschmückt. Haben Sie den Piraten im Kampf getötet, Onkel David?«
»Ja, vor Borneo«, antwortete David und zwinkerte Susan zu, denn er hatte die Sachen in Malakka gekauft. Die Piraten, mit denen er gekämpft hatte, waren nicht so prächtig geschmückt gewesen. Und dann griff er eine weitere große Schachtel, die seit drei Monaten bei der Ostindienkompanie aufbewahrt worden war, und nahm Stück für Stück eine indische Jagdgesellschaft heraus. Elefanten, Maharadschas, Diener, Tiger, alles aus edlen Hölzern kunstvoll geschnitzt. Sogar die Jagdflinten waren fein modelliert.
Auch Susan war diesmal begeistert. »Habe ich dir nicht erzählt, John, wie dein Großvater mich einmal zu einer Jagd mitnahm? So war es! Siehst du hier die Treiber, die den Tiger zum Maharadscha treiben sollen? Und hier ist sein Prunkelefant. Ja, und dort ist der Elefant, der die Lieblingsfrauen trägt. Nun können wir alles nachstellen.«
»Und was haben Sie Mutti mitgebracht, Onkel David?«, fragte John.
Susan protestierte. »Aber, John.« Doch David griff zu einer weiteren Schachtel, in der ein wunderschöner Seidenschal mit reicher Goldstickerei lag.
»Sehr geschmackvoll«, lobte Susan. »Wir haben zu danken, nicht wahr, John?«
»O ja, vielen Dank, Onkel David«, sagte John.
David fühlte sich zu dem Jungen hingezogen, aber sein Gefühl war nicht mehr so stark und schmerzlich wie vor seiner Abreise nach Indien. War alles andere durch das starke Gefühl für Kamala zurückgedrängt worden? Er fragte: »Weißt du schon, was du werden willst, John?«
Ohne zu Zögern antwortete der Junge: »Flottenkapitän.«
Susan zog eine Grimasse und sah David an. »Ich habe ihm das nicht eingeredet.«
David beugte sich hinab, fasste John an beide Schultern und sah ihm in die Augen. »Das ist ein schöner Beruf, John. Aber du bist selten bei den Menschen, die du liebst, und die See entfremdet dich ihnen.«
»Aber ich kann doch viel kennenlernen und erleben. Und es reicht ja, wenn man sich von Zeit zu Zeit sieht. Ich sehe meinen Vater auch selten.«
David richtete sich auf und suchte den Schmerz zu verbergen. Auch Susan sah erschrocken aus. David fasste sich: »Ja, John, das sind Wochen oder Monate. Aber sieh, ich war jetzt fünf Jahre weg. Wenn man wiederkommt, leben manche nicht mehr, wie der Hausdiener meines Onkels und unser Hund. Es ist auch ein gefährlicher Beruf, John. Das Meer kann sehr grausam sein.«
»Aber Sie sind doch auch heimgekehrt, Onkel David, und haben Ruhm und Reichtum erworben, wie mir Mutti erzählte.«
Susan mischte sich ein. »Onkel David muss einen guten Schutzengel haben, bei all den Gefahren, die er schon überlebt hat. Aber schau dir nun die neuen Sachen noch genauer an. Ich will mit Onkel David noch ein paar Worte sprechen.«
Sie ging mit David zur anderen Ecke des Salons und setzte sich an einen kleinen Tisch. Nachdem das Mädchen den Tee serviert hatte, fragte David: »Was hast du denn vom Reichtum gehört, Susan?«
»Nichts Genaues, David. In den Salons munkelten die Indienleute, du habest Schätze erobert, geschenkt bekommen und geerbt. Von Diamanten war die Rede. Aber sie reden ja immer und übertreiben oft.«
»Es stimmt schon. Natürlich habe ich nicht das Vermögen, das ein Hastings zurückgebracht hat. Dafür ist es ehrlicher erworben, und es würde reichen, mit Frau und Kind wie ein Lord zu leben. Wenn ich darüber als junger Mann verfügt hätte ...«
Susan sagte leise, aber bestimmt: »David, ich habe Lord Bentrow nicht wegen des Reichtums geheiratet. Und wer weiß, ob du nicht verdorben und verweichlicht worden wärst, hättest du schon jung solchen Reichtum besessen.«
»Ich wollte dich auch nicht kränken, Susan. Du hast sicher recht. Aber ich ändere mein Leben auch mit dem Vermögen nicht. Ich werde wohl jetzt in der russischen Flotte Dienst nehmen.«
Nun war Susan erschrocken und erhob Einwände. Er solle sein Leben genießen, es nicht schon wieder in der Fremde aufs Spiel setzen und dann noch für eine fremde Monarchin. Sie sprachen über Gründe und Gegengründe, und dann kam wieder John und wollte wissen, ob David morgen wiederkomme.
Sie verabredeten, dass sie morgen am späten Nachmittag eine Fahrt auf einer Barkasse unternehmen und dann zu Abend essen würden.
David blieb nicht viel Zeit, ins Hotel zu gehen, sich umzuziehen, denn in Martins Klub wollte er nicht in Uniform. Dann musste er schon wieder nach der Kutsche rufen. Da es dunkel werden würde, brauchte er gar nicht erst zu diskutieren. Hassan würde ihn begleiten, ob er es wollte oder nicht.
»Wo kann mein Diener essen, und wo kann er danach auf mich warten?«, fragte er den Portier des Klubs.
»Wir haben im Kellergeschoss einen netten kleinen Speiseraum und daneben auch einen Aufenthaltsraum für diese Gelegenheiten, Sir.«
»Dann mach es dir gemütlich, Hassan. Es wird wohl spät werden«, sagte David und wandte sich zum Portier. »Mich führen Sie bitte zum Herzog von Chandos.«
Das Essen war ausgezeichnet, und Martin belastete es noch nicht durch intensive Gespräche. Sie plauderten nur ein wenig über alte Zeiten und über Indien. Aber als sie dann mit einem Glas Rheinwein im Sessel saßen, fragte Martin David detailliert nach der Bombay-Marine und nach seinen Ansichten über Lord Cornwallis und seine Pläne aus.
David machte keinen Hehl daraus, dass er die von Cornwallis beabsichtigte Zurückdrängung der Inder aus der Verwaltung für unklug hielt.
»Die meisten Rückkehrer aus Indien sind anderer Meinung, David. Warum halten Sie Cornwallis’ Misstrauen gegen eine Beteiligung der Inder für falsch?«