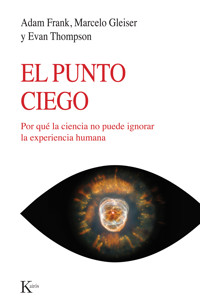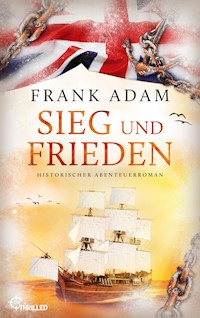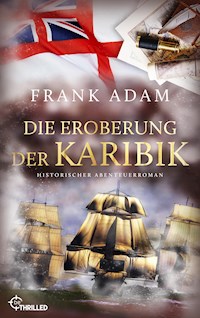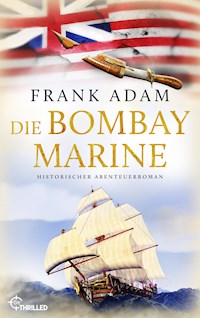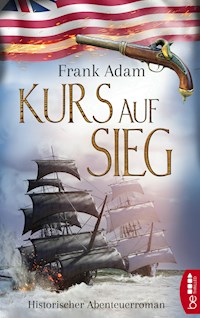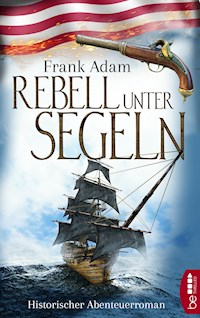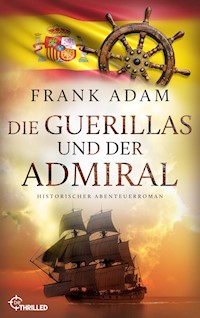
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beTHRILLED
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Seefahrer-Abenteuer von David Winter
- Sprache: Deutsch
Obwohl die Franzosen weiterhin ganz Europa beherrschen, lässt der Widerstand nicht nach. Die britische Flotte wird nicht müde, die Küsten des von Napoleon regierten Europas anzugreifen. Ein weiterer Dorn im Auge der Franzosen sind die Guerillas: Spanier, die unabhängig von den Regierungen für die Freiheit ihres Landes und gegen die Franzosen kämpfen. Ihnen schließt sich Sir David Winter 1812 an und gemeinsam erobern sie wichtige Küstenstädte und Häfen. Doch dann wird Davids Sohn von den Franzosen gefangen genommen ...
David Winters Abenteuer sind ein Spiegelbild seiner Zeit, des rauen Lebens in der Royal Navy, aber auch romantischer Gefühle, des heldenhaften Mutes und der Kameradschaft auf See. Vom Eintritt in die Royal Navy über die Zeit des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges bis in die napoleonischen Kriege verfolgen wir David Winters Aufstieg vom Seekadetten bis zum Admiral.
Aufregende Abenteuer auf See, eingebettet in die faszinierende Geschichte der Marine.
Für alle Fans von C.S. Forester, Alexander Kent, Patrick O’Brian und Richard Woodman. Weitere Bücher von Frank Adam bei beTHRILLED: die Sven-Larsson-Reihe.
eBooks von beTHRILLED - spannungsgeladene Unterhaltung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 668
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Cover
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Vorwort
Hinweise für marinehistorisch interessierte Leser
Verzeichnis der Schiffe und ihrer Offiziere
Verzeichnis der Abbildungen
Lissabon (September bis Oktober 1810)
Handstreich an der Algarve (November 1810)
Die Guerillas und ihr Oberst (Dezember 1810 bis Februar 1811)
Vertreibt sie über die Grenzen! (März bis Mai 1811)
Verrat und Sühne (Juni bis November 1811)
Der Besuch (Dezember 1811 bis März 1812)
Die Vorbereitung des Angriffs (April bis Mai 1812)
Siegeskurs auf Santander (Mai bis Juli 1812)
Hafen der Verheißung (Juli bis November 1812)
Glossar
Über den Autor
Alle Titel des Autors bei beTHRILLED
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
vielen Dank, dass du dich für ein Buch von beTHRILLED entschieden hast. Damit du mit jedem unserer Krimis und Thriller spannende Lesestunden genießen kannst, haben wir die Bücher in unserem Programm sorgfältig ausgewählt und lektoriert.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beTHRILLED-Community werden und dich mit uns und anderen Krimi-Fans austauschen möchtest. Du findest uns unter be-thrilled.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich auf be-thrilled.de/newsletter für unseren kostenlosen Newsletter an.
Spannende Lesestunden und viel Spaß beim Miträtseln!
Dein beTHRILLED-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Obwohl die Franzosen weiterhin ganz Europa beherrschen, lässt der Widerstand nicht nach. Die britische Flotte wird nicht müde, die Küsten des von Napoleon regierten Europas anzugreifen. Ein weiterer Dorn im Auge der Franzosen sind die Guerillas: Spanier, die unabhängig von den Regierungen für die Freiheit ihres Landes und gegen die Franzosen kämpfen. Ihnen schließt sich Sir David Winter 1812 an und gemeinsam erobern sie wichtige Küstenstädte und Häfen. Doch dann wird Davids Sohn von den Franzosen gefangen genommen ...
Frank Adam
Die Guerillas und der Admiral
Historischer Abenteuerroman
Vorwort
Einer der wichtigsten Beiträge der britischen Flotte zum Sieg über Napoleon war die Mitwirkung bei der Eroberung der Iberischen Halbinsel. Napoleon herrschte auf der Höhe seiner Macht über das europäische Festland. Aber die Segel, die seine Soldaten vor den Küsten sahen, waren fast immer die Segel britischer Schiffe. Sie beherrschten die Meere und griffen immer wieder von anderen Stellen der Peripherie aus Napoleons Macht an.
Seit 1808 hat die britische Armee Portugal im Kampf gegen Napoleon unterstützt. Ihre Siege sind vor allem mit dem Namen des Herzogs von Wellington verbunden, der 1813 dann mit den portugiesischen und spanischen Verbündeten den Krieg in das französische Mutterland hineintragen konnte.
Aber Wellington war in allen seinen Erfolgen von der britischen Flotte abhängig. Alle Waffen, alle Munition, fast jedes Gramm an Verpflegung wurde in unzähligen riesigen Konvois über See herangeschafft. Ohne diesen Nachschub hätte Wellington nie die Franzosen niederringen können.
Über diese entscheidende Leistung hinaus war die britische Flotte auch ein aktiver Kampfpartner. Sie griff Städte von der See aus an und eroberte sie. Sie kämpfte mit ihren Kanonenbooten die Flüsse frei und bahnte nicht nur Wellingtons Armee, sondern auch den portugiesischen und spanischen Guerillas den Weg. Sie lieferte ihnen Waffen und zerschoss mit ihren Kanonen die Mauern der Küstenfestungen, die für die Guerillas sonst uneinnehmbar waren.
Die Ruhmestaten der britischen Flotte im Kampf um die Iberische Halbinsel haben bisher auch nicht annähernd den ihnen zustehenden Platz in der Romanliteratur gefunden. Sie schienen vielleicht mit ihrem großen Anteil an Konvoidienst nicht so spektakulär wie Kaperfahrten von Fregatten im Pazifik. Aber sie waren historisch ungleich bedeutsamer.
Ich habe mich im ersten Teil des Buches locker an die Taten von Vizeadmiral George Cranfield Berkeley angelehnt und bin bei den Kämpfen an der nordspanischen Küste stärker den Operationen von Kommodore Sir Home Popham gefolgt, der Santander eroberte und damit den Nachschubhafen für den Einmarsch nach Frankreich bereitstellte. Dieser ungewöhnlich einfallsreiche Flottenoffizier hat in Verbindung mit den Guerillas nicht nur die spanische Biskayaküste erobert, sondern auch die französische Nordarmee gehindert, Truppen für den Kampf gegen Wellington zu delegieren.
Ich bin überzeugt, dass viele Leser an den wirklich kriegsentscheidenden Handlungen der britischen Flotte interessiert sind und auch in ihnen genug Spannung und Erlebnisse finden werden.
Für Hilfen bei Literaturrecherche und -beschaffung bin ich den Damen Garrecht, Geick und Winkler von der Universitätsbibliothek Landau sowie Herrn Dr. Niemeyer vom Wehrgeschichtlichen Museum Rastatt zu großem Dank verpflichtet.
Frank Adam
Hinweise für marinehistorisch interessierte Leser
Zur Information über Schiffe, Waffen und Besatzungen der britischen Flotte verweise ich auf mein Buch mit zahlreichen Abbildungen und Literaturangaben:
Adam, F.: Herrscherin der Meere. Die britische Flotte zur Zeit Nelsons. Hamburg: Koehler 1998
Für die Flottenaktivitäten um die iberische Halbinsel sind immer noch lesenswert:
Clowes, Wm. Laird: The Royal Navy, a history from the earliest time to the present, Vol. V. London: Sampson Low 1899
James, W.: The Naval History of Great Britain, Vol. V. Neuauflage London: Bentley 1886
Neuere Darstellungen sind z. B.:
Woodman, Richard: The Victory of Seapower. Winning the Napoleonic War 1806 – 1814. London: Chatham Publishing 1998
Hall, Christopher D.: The Royal navy and the Peninsular War. In: Mariner’s mirror, 79, 1993, S. 403 – 418
Howard, Donald D.: Wellington, Berkeley, and the Royal navy. In: The British historical society of Portugal: 18th annual report and review 1991, S. 85 – 104
Die Lebensgeschichte von Admiral Sir Home Popham wird dargestellt in:
Popham, Hugh: A damned cunning fellow. Cornwall: Old ferry Press 1991
Zu den Operationen der Armee kann man heranziehen:
Fortescue, J. W.: A history of the British army. Vol. VIII. London: Macmillan 1917
James, Lawrence: The iron duke. A military biography of Wellington. London: Weidenfeld and Nicolson 1992
Hinweis: Große Entfernungsangaben auf See erfolgen in Meilen (1 852 m) und Knoten (Seemeilen pro Stunde). Diese Angaben wurden beibehalten.
Kürzere Entfernungsangaben erfolgten in der Flotte in ›Kabellänge‹ (185,3 m), ›Faden‹ (1,853 m), ›Fuß‹ (30,48 cm), seltener auch in ›Yard‹ (91,44 cm). Zur Vereinfachung für den Leser habe ich immer in Meter umgerechnet.
Verzeichnis der Schiffe und ihrer Offiziere
FlaggschiffTonnant
Konteradmiral
Sir David Winter, K.B.
Flaggkapitän
Andrew Harland
Flaggleutnant
Timothy Napier
Major der Seesoldaten
Douglas Blair
Flottenarzt
Dr. James Cotton
Erster Leutnant
William Padwick
Zweiter Leutnant
Samuel Hay
Dritter Leutnant
Martin Sedlau
Master
John Pemrose
Admiralssteuerer
Alberto Rosso
2. Admiralssteuerer
Mustafa Dukat
Diener des Admirals
Edward Crown
Sekretär des Admirals
George Roberts
Linienschiff Abercrombie
Kapitän
Christopher Hall
Linienschiff Ardent
Kapitän
William Stap
Erster Leutnant
Andrew Hair
Linienschiff Glasgow
Kapitän
Thomas Broadley
Fregatte Amazon
Kapitän
Robert Hallowell
Fregatte Enterprise
Kapitän
Howard Leslie
Fregatte Cesar
Kapitän
Jonathan Wilken/Nathaniel Rowlandson
Fregatte Sparrow
Kapitän
Henry Woodley/Abraham Sunder
Fregatte Diadem
Kapitän
Charles Zanger
Sloop Sirius
Commander
Nathaniel Rowlandson/Dudley Hayward
Sloop Ariane
Commander
John Milton
Sloop Alkmene
Commander
Abraham Sunder/Andrew Hair
Sloop Eagle
Commander
André Hunter
Kanonenbrigg Britta
Leutnant
Dudley Hayward/Samuel Hay
Kutter Bristol
Leutnant
Josephus Ward
Verzeichnis der Abbildungen
Übersichtskarte Spanien und Portugal
Die Linien von Torrès Vedras
Cadiz um 1812
Wellingtons Feldzüge auf der Iberischen Halbinsel
Die Nordküste Spaniens
Lissabon (September bis Oktober 1810)
Die Jolle des Admirals näherte sich dem Flaggschiff, das sie mit backgebrassten Segeln erwartete. Der Admiral saß auf der hinteren Bank und glich mit seinem Körper die Bewegungen der Jolle aus, die auf den Wellen tanzte. Landbewohner hätten das für raue See gehalten. Für die Seeleute war das Wasser aber fast spiegelglatt.
Der Admiral trug die kleine Dienstuniform, die auch mit Epauletten geschmückt war, aber nicht die reiche Goldverzierung und den Stehkragen aufwies, die der Extrauniform vorbehalten waren. Der eine Stern auf der Epaulette zeigte den Rang eines Konteradmirals an.
Konteradmiral Sir David Winter würde in wenigen Wochen seinen neunundvierzigsten Geburtstag feiern. Er war mittelgroß, eher kräftig als schmal und sah so alt aus wie er war. Sein Gesicht drückte Klugheit und Willenskraft aus.
Jetzt ragte die Bordwand wie eine riesige Felsklippe über der Jolle auf. Der Bootssteuerer rief seine Befehle. Seeleute ergriffen herunterhängende Taue. Die Ruderer der einen Seite zogen die Riemen ein, und die Jolle berührte leicht die Bordwand des Flaggschiffes.
Alberto Rosso, der Bootssteuerer, war seit elf Jahren bei David Winter. Vorher hatte er zwei Jahre dem neapolitanischen Prinzen Caracciolo gedient, den die Häscher 1799 vor Neapel an Nelson auslieferten. Caracciolo hatte David angefleht, seinen jungen Diener, den letzten, der ihm treu geblieben war, zu retten. Er habe keine Schuld auf sich geladen. David Winter, damals Kommodore, verabscheute Nelsons Beihilfe zu den Morden des Pöbels und rettete Alberto. Seither war dieser sein Gefährte und Freund.
David Winter blickte missmutig auf die nassen Holzstreben der Seilleiter, die man vom Schiff herabgelassen hatte. Er redete sich ein, er sei zu alt für solche Klettereien. In Wirklichkeit war er, im Denken und Planen rastlos, körperlich ein eher bequemer Mensch. Zwei Seeleute hielten das untere Ende der Leiter fest. Alberto reichte David seinen Arm zur Stütze und sagte: »Sir!«
David glaubte eine gewisse Ermunterung im Tonfall zu hören, stand auf, schob seinen Säbel so an die Seite, dass er nicht zwischen die Beine geriet, drückte den Hut fest auf den Kopf und griff nach den beiden Seilen, ohne Albertos Hand zu beachten. Zügig stieg er empor und wunderte sich wieder einmal, wie leicht ihm das immer noch fiel.
Als sein Kopf vom Deck aus zu sehen war, gab der wachhabende Offizier sein Zeichen, und die Trommler und Pfeifer intonierten ihren Begrüßungsmarsch. Für Fremde ungewohnt war vielleicht, dass ein Dudelsackpfeifer die Kapelle begleitete. Aber wer schon mit David Winter gesegelt war, wusste, wie sehr dieser die Töne des Dudelsacks mochte und dass auf seinen Flaggschiffen immer für einen gesorgt wurde.
Der Admiral hatte diesen Empfang nicht abgewehrt, wie er es sonst bei kurzen Abwesenheiten tat. Aber in seiner Zeit auf dem Flaggschiff hatte er bisher nur selten Gelegenheit gehabt, das Empfangskomitee zu erleben. Er wollte sicher sein, dass bei den zu erwartenden häufigen Besuchen anderer Kapitäne alles gut klappte. Ob die Pfeifer richtig spielten, konnte er bei seiner Unmusikalität nicht beurteilen. Aber der Rhythmus der Trommler stimmte, und die Seesoldaten standen mit ihrem Präsentiergriff exakt richtig.
»Danke, Mr Sedlau«, sagte David zu dem wachhabenden Leutnant, zog den Hut und grüßte zum Achterdeck. Dann ging er mit schnellen Schritten dorthin, wo ihn der Flaggkapitän, einige Offiziere und Midshipmen mit gezogenen Hüten erwarteten.
»Vielen Dank, Mr Harland, meine Herren«, sagte er und griff grüßend an seinen Hut. Die anderen setzten ihre Hüte wieder auf. »Lassen Sie bitte zum Geleit aufschließen, Mr Harland«, bat er den Flaggkapitän. Der gab den Befehl weiter, und Leutnant Sedlau lief zur Reling, prüfte, ob die Jolle eingeholt war, schaute zum Konvoi, der etwa sieben Meilen vor ihnen segelte, und brüllte dann die Befehle zum Brassen der Segel.
David Winter hatte sich wieder Kapitän Harland zugewandt und erzählte: »Kapitän Wilken sagte, dass er Sie kenne, Mr Harland. Sie hätten ihn um die Jahrhundertwende in Sheerness vor einem Presskommando gerettet, das ihn in Zivil aufgegriffen hatte.«
»O ja«, bestätigte Harland. »Ich erinnere mich. Dann war er damals Erster Leutnant auf einem Vierundsiebziger. Ich hatte ihn am Vortag beim Hafenadmiral in Uniform gesehen und kam vorbei, als ihn am nächsten Morgen ein Presskommando wegschleifen wollte. Ich musste den Leutnant, der den Rekrutierungstrupp führte, richtig anschreien, ehe sie ihn losließen. Diesem Kerl war völlig egal, wen er aufgriff, Hauptsache, er konnte große Zahlen präsentieren.«
»Ja, so etwas kommt immer wieder vor«, bestätigte David. Auch er hatte mit diesen Rekrutierungstrupps, die zu Anfang der Kriege gegen Frankreich Seeleute in den Küstenprovinzen für die Flotte aufgreifen sollten, die absonderlichsten Erfahrungen gesammelt. »Ich erfrische mich etwas und komme dann wieder an Deck. Wenn Sie Lust haben, können wir noch ein wenig gehen.«
»Gerne, Sir«, antwortete Harland.
Kein Fremder, der die beiden erlebt hätte, wäre auf den Gedanken verfallen, dass die beiden sich seit über dreißig Jahren kannten und gute Freunde waren. Sie hatten gemeinsam auf der Shannon 1774 als ›Captain’s servants‹, als junge Offiziersanwärter, gedient und waren oft gemeinsam gesegelt. Andrew war Davids Erster Leutnant gewesen, als dieser in der russischen Flotte diente. Wenn sie allein waren, duzten sie sich. Aber in Gegenwart anderer wahrten sie die Form, wie es in der Flotte üblich war.
Harland war kleiner als David und zwei Jahre jünger. Obwohl nun Flaggkapitän, erinnerte er David immer wieder an den flinken und lustigen Kameraden seiner ersten Dienstzeit.
Vor der Tür zu den Admiralskajüten hielt ein Seesoldat Wache. Er öffnete die Tür und stand stramm, als David seine Räume betrat. Sein Diener Edward stand mit der Alltagskleidung bereit. Der Schäferhund lag in seinem Weidenkorb und wedelte mit dem Schwanz.
»Dann will ich es mir mal wieder bequem machen«, sagte David, setzte sich auf einen Stuhl und ließ sich von Edward beim Ausziehen der Seidenstrümpfe und der engen Bundhosen helfen. »Warte, bis ich die alten Sachen anhabe, Lucky, dann kannst du zu mir kommen.«
»Möchten Sie noch etwas trinken, Sir?«, fragte Edward.
»Nein, danke. Sie haben mich auf der Fregatte Cesar mit Kaffee traktiert. So, Lucky, nun kannst du zu mir. Wir gehen dann auch noch ein wenig an Deck.«
Der Hund lief schweifwedelnd auf ihn zu, rieb seinen Kopf am Oberschenkel des Admirals und ließ sich Brust und Kopf kraulen. Es war ein außergewöhnlich kräftiger und schöner Schäferhund, ein Nachkomme jenes Wolfshundes, den David aus dem finnischen Krieg mitgebracht hatte. Seinem Vorgänger Barry war die Karibik nicht so gut bekommen. Er bewachte nun wieder mit den anderen Hunden Davids Gut Whitechurch Hill auf der Insel Wight.
»Komm«, sagte David zum Hund und ging an Deck. Auf einen Wink hin lief Lucky zu der mit Sand gefüllten Schütte an der Reling, wo er sich immer entleeren konnte. Dann folgte er David zum Achterdeck, und der eine oder andere Offizier oder Midshipman rief ihn zu sich und streichelte ihn.
David ging mit Harland auf und ab. Die Tonnant, das Flaggschiff, von Nelson bei Abukir erbeutet und im letzten Jahr völlig überholt, war mit ihren achtzig Kanonen zwar ein recht großes Linienschiff, aber das Achterdeck erlaubte keine großen Spaziergänge. Nach wenigen Metern musste man sich umdrehen und den gleichen Weg zurück abschreiten. In der Flotte drehten sich die Offiziere dabei immer mit den Körpern zueinander und wechselten nicht die Seiten, sodass die Gespräche nicht unterbrochen werden mussten.
»Wie fanden Sie die Cesar, Sir?«, fragte Harland.
»Bei der kurzen Inspektion machte sie einen guten Eindruck. Kapitän Wilken wirkte kompetent und berichtete sachkundig über die Operationen der Britischen Armee und der Freischärler, mit denen er Kontakt hält. Ich habe ihn darauf hingewiesen, dass er richtige Landungstrupps aufstellen muss, die immer wieder das Ausbooten und den Kampf an der Küste üben sollen.«
»Wie entwickelt sich der Krieg an Land, Sir?«
»Der französische Oberbefehlshaber Masséna hat auf seinem Vormarsch aus Salamanca nun auch die Grenzfestung Almeida eingenommen und rückt auf Lissabon vor. Er soll jetzt bei Viseu sein. Das liegt etwa hundert Kilometer östlich landeinwärts von unserer jetzigen Position. Wellington soll sich auf die Serra do Buçaco zurückgezogen haben, einen unzugänglichen Höhenzug vor dem Rio Mondego.«
»Ich weiß nicht genau, wo das liegt«, gab Harland zu, »aber Rückzug hört sich nicht so gut an.«
»Wir müssen nachher einmal schauen, ob unsere Karten von den Küstenlandschaften genau genug sind oder ob wir uns bessere in Lissabon besorgen müssen. Aber als ich gegenüber Kapitän Wilken eine ähnliche Bemerkung machte, erklärte er mir, dass nach seinem Eindruck aus den letzten zwei Jahren die britisch-portugiesische Armee wesentlich verstärkt und verbessert worden und dass Wellington auf die Abnützung des Gegners aus sei. Die Franzosen werden auf ihrem Vormarsch ständig von den Freischärlern angegriffen, und Wellington habe das Land, das er verlässt, von allen Lebensmitteln entblößt, sodass die Franzosen alles heranschaffen müssten, was sie nicht können, so letztlich doch weichen müssen.«
Harland schüttelte den Kopf. »Dieser Landkrieg ist mir zu kompliziert und so furchtbar zeitraubend. Da ist mir unser Krieg lieber. Ich kenne mein Schiff, sehe den Gegner, und dann hängt alles davon ab, wie wir segeln und schießen können.«
David lachte ihn an. »Na, dann kann ich nur hoffen, dass wir das richtige Schiff haben und dass Sie es gut segeln. Mein letztes Flaggschiff, die Neptune, war, wie Sie wissen, ein schlechter Segler. Da ist die Tonnant wesentlich besser, und das macht zehn Kanonen weniger mehr als wett.«
»Ja«, stimmte Harland zu. »Ich bin mit der Tonnant sehr zufrieden. Und die Besatzung ist eingespielt und hat gute Ergebnisse im Übungsschießen. Sehen Sie nur, wie schnell wir auch bei dem geringen Wind zum Konvoi aufschließen.«
David schaute voraus, wo der Konvoi mit seinen zweiundvierzig Transportern segelte. Das Warten auf diesen Konvoi hatte seine Abreise fast drei Wochen verzögert, eine Zeit, die er und Britta gut genutzt hatten. Der Konvoi brachte Waffen, Munition und Truppen, auf die Wellington sehnsüchtig wartete. Und mit den beiden Fregatten, drei Sloops, zwei Briggs, zwei Mörserschiffen und einem Kutter, die jetzt den Konvoi begleiteten, segelte auch eine Verstärkung für den Kampf an den Küsten heran.
Konteradmiral Sir David Winter, Ritter des Bath-Ordens, würde ein Geschwader von zwei Linienschiffen, fünf Fregatten, acht Sloops, vier Kanonenbriggs, zwei Kuttern und zwei Mörserschiffen kommandieren und sollte den Küstenstreifen von Coruña bis zu Portugals südlicher Grenze angreifen, sobald dort Franzosen auftauchten. Er würde die Freischärler unterstützen, Truppen transportieren und Nachschub sichern müssen, wann immer es der Kampf an Land erforderte. Flottenoperationen waren nicht ganz auszuschließen, aber eher unwahrscheinlich. In erster Linie war die Unterstützung des Landkrieges seine Aufgabe.
Der kommandierende General Arthur Wellesley, seit Kurzem Herzog von Wellington, galt als schwierig. Die Admiralität konnte ein Lied singen von seinen ständigen Klagen über mangelnde Unterstützung. In einigen Fällen hatte er Recht, in anderen nicht. Aber seine vereinigte britisch-portugiesische Armee hing in allen Dingen vom Nachschub über See ab. Lissabon war das Herz, von dem aus das Blut nach Portugal gepumpt wurde.
Hier würde auch David Winter sein Hauptquartier haben, obwohl er selten an Land, oft aber auf See sein würde. Dabei hatte er nicht vor, nur auf seinem Flaggschiff zu segeln. Ihm lag es viel mehr, auf einer Brigg oder Sloop in die Buchten an der Küste hineinzutauchen und überraschende Angriffe auf den Feind zu planen.
Wegen dieser Erfahrungen und Neigungen hatte sein Freund, Sir George Abercrombie, dem Herzog von Wellington nachdrücklich empfohlen, Davids Berufung durchzusetzen.
Abercrombie kannte den Herzog von Wellington aus Indien, wo er eine Reihe von Feldzügen siegreich geführt hatte, was ihm den Spitznamen ›Der Sepoy-General‹ eingebracht hatte, nicht unbedingt eine Empfehlung für den Krieg in Europa.
Abercrombie hatte David auch in Indien getroffen, aber sie kannten sich schon seit dem amerikanischen Unabhängigkeitskrieg. Jetzt kommandierte und reorganisierte Abercrombie die portugiesische Armee, und David befehligte das Geschwader vor Portugals Westküste. Alle, die in Englands Sold irgendwo Kommandostellen innehatten, kannten sich mehr oder weniger.
Sie hatten den Konvoi erreicht. Die Tonnant nahm ihren Platz an der Spitze des Geleitzuges ein. Vor ihr segelten zwei Sloops, darunter die Sirius von Commander Nathaniel Rowlandson, der in Davids Ostsee-Geschwader gedient hatte. Jetzt stieg dort am Mast ein Signal empor.
Der Signal-Midshipman auf der Tonnant presste das Teleskop ans Auge und sagte die Flaggen leise vor sich hin. Er brauchte nicht in der Kladde nachzusehen. Es war ein bekanntes Signal: ›Segel auf Gegenkurs‹.
»Lassen Sie bitte feststellen, wer uns da entgegenkreuzt«, sagte David zu seinem Flaggkapitän.
Der hatte schon einen Midshipman mit einem Teleskop in den Mast geschickt und wartete auf die Meldung.
»Deck«, schallte die helle Stimme vom Mast. »Fischkutter mit britischer Flagge.«
David und Kapitän Harland sahen sich an. Ein Fischkutter mit der britischen Flagge? Das konnte nur bedeuten, dass er für die Überbringung einer wichtigen Nachricht benutzt wurde. Sie würden es bald erfahren.
Der Schäferhund Lucky richtete sich mit einem Mal auf, stellte die Ohren hoch und knurrte. Jetzt hörten auch die Menschen an Achterdeck ein dumpfes Grollen. Ein Gewitter kann es nicht sein, dachte David. Und so viele Kanonen schossen nicht auf einmal.
»Deck!«, rief es da wieder. »Explosionswolke backbord siebenundzwanzig Strich etwa sechs Meilen voraus!«
David nahm sein Teleskop und blickte zur nahen Küste hinüber. Dort voraus sah er eine riesige Explosionswolke, die schnell in den Himmel stieg. Sie war schon über fünfhundert Meter hoch. Da musste ein ganzes Munitionsdepot in die Luft geflogen sein. Aber dort lag doch gar keine Garnison.
»Können Sie sich das erklären, Mr Harland?«
»Nein, Sir. Ich gehe in die Kartenkammer, um zu sehen, was da liegen könnte.«
»Warten Sie, ich komme mit.«
Das Studium der Karten machte sie auch nicht klüger. »Die Explosion muss sich etwa hier bei San Joäo da Madeira ereignet haben. Aber weder dieses Nest noch die anderen in der Nähe geben irgendeinen Hinweis auf ein Depot, eine Festung oder Ähnliches. Hier führt die Straße entlang von Porto nach Lissabon. Das ist alles.«
»Und wenn man auf der Straße Munition transportiert hat?«, warf Harland fragend ein.
David nickte. »Guter Gedanke. Aber das müsste ja ein gewaltiger Transportzug gewesen sein.«
Ihr Gespräch wurde durch Klopfen an der Tür unterbrochen. »Ja, was ist?«, rief David.
Der Midshipman der Wache meldete mit gezogenem Hut: »Sir, der Fischkutter ist längsseits. Ein Leutnant der Königlich Deutschen Legion möchte an Bord kommen.«
»Danke«, sagte David. »Aber sagen Sie künftig in solchen Fällen: Ein Mann in der Uniform eines Leutnants der Königlich Deutschen Legion. Sie wissen noch nicht, ob er das ist, was er scheinen will. Man kann nie vorsichtig genug sein.«
Harland schmunzelte versteckt, denn er kannte Davids ›Vorsichtstick‹, aber der Midshipman antwortete mit unbewegter Miene: »Aye, aye, Sir!«, und marschierte ab.
»Schauen wir uns den Vogel an!«
Der Ankömmling kletterte die hinuntergeworfene Jakobsleiter recht gewandt empor und grüßte zum Achterdeck. Anscheinend war er nicht zum ersten Mal an Bord eines Kriegsschiffes. Der wachhabende Leutnant begrüßte ihn und führte ihn dann zum Achterdeck.
»Leutnant Hellmer von der Königlich Deutschen Legion bittet, Sir David sprechen zu dürfen«, meldete er.
David trat einen Schritt vor, streckte seine Hand aus und sagte: »Willkommen an Bord. Gehen wir in meine Kajüte.«
Harland und Leutnant Hellmer folgten ihm. In der Kajüte bat David zuerst Edward, ihnen etwas Kaffee zu kochen, und fragte dann den Leutnant: »Welche Meldungen haben Sie, Mr Hellmer?«
»Sir David, ein Bataillon unserer Truppen ist nach dem erfolgreichen Überfall auf die Belagerungsartillerie Massénas von seinen Rückzugswegen abgeschnitten und bittet dringend um Evakuierung über See. Oberst von Rostow hat Fischerboote in Richtung Porto und Lissabon gesandt, um britische Schiffe zu finden.«
»Wie viel Mann hat die Truppe?«, fragte David.
»Knapp zweihundertfünfzig, Sir, darunter etwa zehn Verwundete.«
»Wo möchte Ihr Oberst einbooten, Herr Leutnant?« David hatte jetzt Deutsch gesprochen, aber der Leutnant schien es gar nicht zu bemerken. Automatisch antwortete er in deutscher Sprache:
»Er marschiert von Furadouro aus auf diese Nehrung, Sir. Sie wissen sicher von der Karte, dass dort eine Art See ist. Auf der Landzunge kann er sich gut verteidigen. Der Strand ermöglicht ohne Schwierigkeiten das Einbooten.«
David sprach wieder Englisch. »Sie sind automatisch zur deutschen Sprache übergewechselt und kannten sogar den Ausdruck ›Nehrung‹, für den ich keinen englischen Begriff wüsste. Woher stammen Sie?«
Leutnant Hellmer schien verdutzt. »Das ist mir gar nicht aufgefallen, Sir. Ich komme aus Cammin, das liegt in der Nähe des Stettiner Haffs.«
David wandte sich an Kapitän Harland, während der Diener Edward mit dem Kaffee kam. »Bitte veranlassen Sie, dass die Sirius und der Transporter Aberdeen uns in Kiellinie mit Kurs auf Furadouro folgen sollen. Sagen Sie dem Transporter bitte, er solle sich auf die Aufnahme von hundertfünfzig Mann vorbereiten. Die anderen nehmen wir.«
Harland trank noch einen Schluck Kaffee und ging dann. Auch David und der Leutnant tranken.
David fuhr dann in deutscher Sprache fort: »Ich bin Hannoveraner von Geburt, Herr Leutnant. Aber erzählen Sie mir mehr von Ihrem Oberst.«
»Oberstleutnant von Rostow ist Preuße, Sir David, und ein sehr beliebter und erfolgreicher Offizier. Die Franzosen wollten ihn in seiner Heimat verhaften, weil er im Krieg aus ihrer Gefangenschaft floh, dabei einen Wachtposten tötete und Truppen hinter den französischen Linien kommandierte. Da ist er nach England geflohen und dient nun in der Legion.«
»Hat er einmal erzählt, wer ihm bei der Flucht half?«
»Ja, seine heutige Frau. Britische Schiffe haben beide aufgenommen.«
»Gut, Herr Hellmer. Ich kenne Ihren Obersten. Kommen Sie! Gehen wir an Bord, und sehen wir zu, wie wir die Truppen schnell und unbeschadet evakuieren können.«
An Deck waren die Seeleute beschäftigt, alle Boote zu Wasser zu lassen und hinter dem Schiff zu schleppen. Sie bereiteten Jakobsleitern vor, damit die Truppen an Bord klettern konnten. Auch der Bootsmannsstuhl wurde aufgehisst. David sah mit Befriedigung, dass Harland die Truppen an der dem Land abgewandten Seite aufnehmen wollte, damit er zum Strand freies Schussfeld behielt, falls feindliche Truppen die Einschiffung verhindern wollten.
»Geben Sie bitte Signal, dass die Sirius längsseits kommt«, sagte David.
Als die Sloop dicht neben ihnen segelte, rief David durch die Sprechtrompete: »Segeln Sie bitte so dicht an die Halbinsel heran, wie Sie können, Mr Rowlandson! Beobachten Sie, ob Sie Truppen der Königlich Deutschen Legion oder Feinde sehen.«
Der außergewöhnlich kleine Commander auf dem Achterdeck rief zurück: »Aye, aye, Sir!«, und brüllte sofort die Kommandos zur Kursänderung.
David trat zu Kapitän Harland. »Hat Ihr Master einen Vorschlag für den besten Platz zum Einbooten?«
»Nein, Sir. Die Karten sind zu ungenau. Wir beginnen in Kürze mit dem Loten. Aber dichter als zweihundert Meter werden wir nicht an die Küste herankommen. Eine Meile voraus stehen ein paar Fischerhütten mit Booten am Strand. Dort kann man also anlanden.«
»Ja, wenn jemand da ist, den man holen kann«, sagte David und winkte dann den Major der Seesoldaten zu sich heran. Es war nicht mehr Major Ekins, der Gefährte so vieler Jahre und Fahrten. Ekins war Oberst geworden und kommandierte jetzt die Seesoldaten in Portsmouth. Aber auch Major Douglas Blair war ein erfahrener Kämpfer.
»Mr Blair«, informierte ihn David. »Sobald wir die Landungsstelle erreicht und unsere Truppen gesichtet haben, setzen Sie mit zwei Kuttern zwei Trupps mit je dreißig Seesoldaten an Land, um die Landungsstelle zu sichern. Vor allem die Sicherung nach Norden ist wichtig, denn ich erwarte eigentlich nur von dort den Feind.«
Der Major bestätigte und rief nach seinem Sergeanten.
»Sirius signalisiert, Sir«, meldete der Erste Leutnant.
David blickte zur Sloop. Das Signal ›Freund in Sicht‹ wehte. David nahm sein Teleskop und suchte den Strand ab. Tatsächlich, dort stapfte ein Trupp über die kleine Düne zum Strand. Die Soldaten hatten provisorische Tragen mit Verwundeten bei sich.
»Leutnant Hellmer!«, rief David. Als der zu ihm trat, erklärte er: »Wir setzen Sie jetzt an Land. Sie verabreden mit den Offizieren, dass wir die Truppen dort vorn, wo die Fischerhütten stehen, aufnehmen. Sie sollen die dreihundert Meter noch marschieren. Bleiben Sie dort, und helfen Sie, die Einbootung zu organisieren.«
Die Tonnant hatte den Strand mit den Fischerhütten erreicht. Die Sirius lag ein paar hundert Meter nördlich von ihr näher am Strand und sollte ein feindliches Vorrücken verhindern. Der Transporter, der Verwundete nach England bringen sollte, lag etwas seewärts von der Tonnant. Die Kutter mit den Seesoldaten waren unterwegs zum Strand. Einige Fischer liefen überrascht aus den Hütten.
Als die Seesoldaten ihre Positionen an Land eingenommen hatten und auch der Ausguck auf dem Mast meldete, dass kein Feind zu sehen sei, legten die ersten Kutter ab, die die Truppen holen sollten. Es waren immer mehr, die den Strand entlang zu den Fischerhütten marschierten. Sie hatten ihre Waffen und wirkten auch sonst diszipliniert und professionell, voller Vertrauen in ihre Schiffe, die dort mit ausgerannten Kanonen lagen.
David konnte sich denken, wie erleichtert sie bei diesem Anblick waren. Auch er hatte schon am Strand in Feindesland auf eigene Schiffe gewartet. Da wurde einem schon mulmig.
Jetzt kam hinter der Düne ein größerer Trupp in Sicht. Vor ihm ritt ein Offizier. Aber David erkannte nicht von Rostow. Den erwartete er auch erst mit der Nachhut.
Die ersten Soldaten wateten zu den Booten und stiegen ein. Ein Kutter legte ab. »Es scheint alles planmäßig zu laufen, Sir«, sagte Harland neben David.
»Beschreien Sie es nur nicht, Mr Harland. Sie wissen doch, ich bin abergläubisch wie ein altes Weib«, sagte David lachend.
Immer mehr Truppen sammelten sich am Strand. Die ersten Kutter kehrten schon zurück, um die zweite Tour zu unternehmen. Auf dem Transporter Aberdeen kletterten sie die Jakobsleitern empor. Verwundete wurden mit dem Bootsmannsstuhl an Bord geholt.
Da krachten Gewehrschüsse. Das musste die Nachhut des Bataillons sein. David spähte durch sein Teleskop. Er sah Soldaten, die vorwärts rannten, sich dann hinwarfen und zurückzielten. Ein Offizier stand bei ihnen und dirigierte heftig mit den Armen. Und dort ritt jetzt ein ganzer Pulk Kavallerie heran. Die Soldaten schossen auf sie.
»Signal an Sirius: Feuer frei!«, rief David. »Die Heckgeschütze der Tonnant sollen nach Zielauffassung feuern!« Der Batterieoffizier rannte zu den achteren Kanonen und instruierte die Geschützführer. Aber da krachten schon die Kanonen der Sirius. David sah, wie die Kavalleristen ihre Pferde herumrissen und Schutz suchten. Die Nachhut der Legion marschierte im Geschwindschritt heran.
Ja, es waren genug Boote unterwegs. Die beiden Kutter für die Seesoldaten lagen rechts und links von der Anlegestelle und hatten ihre Bootskanonen bereit. Die ersten Soldaten der Nachhut booteten ein.
David sah Leutnant Hellmer, der zu dem Offizier ging und salutierte. Ja, das war von Rostow. Der schaute sich immer wieder um und trieb dazwischen seine Leute an. Er würde als Letzter einbooten. So kannte ihn David.
Die Sirius feuerte schon wieder. Die Kavallerie hatte einen erneuten Vorstoß probiert. Aber wenn die großen Karronaden der Sloop mit Traubengeschossen dazwischen donnerten, dann konnten das weder Pferde noch Reiter aushalten. Wer nicht getroffen wurde, galoppierte zurück.
So, nun waren nur noch die Seesoldaten an Land. Wie auf dem Exerzierplatz liefen sie zurück zu den Booten. Erst legte das eine ab, dann das andere.
An Bord der Tonnant war es unruhig geworden. Soldaten kletterte über die Jakobsleitern und wurden von den Maaten dahin gewiesen, wo sie sitzen konnten. Es war eng an Bord der Linienschiffe. Da wurde es zum Problem, wenn fast hundert Mann zusätzlich untergebracht werden mussten. Einige Offiziere würden ihre Kammern für die Offiziere der Legion räumen. David würde Oberst von Rostow in seinen Räumen aufnehmen. Dort kam er jetzt an Bord und grüßte zum Achterdeck.
Offiziere und Seeleute sahen mit Erstaunen, wie ihr Admiral den fremden Obersten umarmte und wie sich beide herzlich die Hände schüttelten und anlachten.
»Kommen Sie, Herr von Rostow. Es sind nur wenige Schritte zu meiner Kajüte. Dort können Sie sich erst einmal erholen.« Er wandte sich dann noch um zum Kapitän. »Bitte lassen Sie wieder zum Konvoi aufschließen, Mr Harland. Essen Sie bitte mit Dr. Cotton und Oberst von Rostow mit mir zu Abend, damit wir alle erfahren, was sich zugetragen hat.«
Oberst von Rostow schaute sich in Davids großer Kajüte um. Die Bilder von Davids Frau und Kindern fielen ihm in die Augen.
»Ihre Gemahlin, Sir David?«, fragte er.
»Ja, Herr von Rostow. Das ist meine Frau Britta, eine geborene Dänin. Das ist meine älteste Tochter Christina, jetzt sechzehn Jahre alt. Hier sehen Sie Charles, der fünfzehn ist, und hier Edward, elf. Dieser junge Bursche will um jeden Preis im nächsten Jahr zur See gehen. Aber sagen Sie mir doch einmal, was macht diese tapfere junge Frau, die Sie damals aus der Gefangenschaft befreite?«
»Sie wurde meine Frau, Sir David, und schenkte mir einen Sohn Wilhelm, jetzt drei Jahre, und eine Tochter Luise, jetzt zwei. Alle leben in Lissabon.«
»Ich gratuliere von ganzem Herzen«, rief David. »Dann kann ich Ihre Familie ja sehen.«
»Das müssen Sie sogar. Darauf wird Gesine bestehen. Aber Sie erraten nicht, wer unser Trauzeuge war.«
»Einer der preußischen Kommandanten, die ich kenne?«
»Herr von Gneisenau war auch dabei, aber ich meine eine Trauzeugin.«
David hob hilflos die Arme. »Mir fällt nur Königin Luise ein, aber das wäre zu unwahrscheinlich.«
»Ganz so hoch konnte ich nicht greifen, aber es war die Fürstin von Sorotkin, die Gesine im Damenstift kennen- und schätzen gelernt hatte.«
»Elisabeth«, hatte David unwillkürlich gesagt. Er kannte die Fürstin aus seiner Petersburger Zeit und aus dem Jahr 1807, als sie ihm die Abschrift des Geheimvertrages von Tilsit aushändigte. Damals wollte sie in ein norddeutsches Damenstift reisen, um dort ihre letzten Jahre zu verbringen.
»Ich sage ja immer wieder: ›Die Welt ist ein Dorf‹. Die Fürstin ist eine wunderbare Frau.«
»Ja«, bestätigte von Rostow. »Meine Gesine war ein ungeschliffener Diamant. Die Fürstin hat sie zu einer Dame mit Kultur und Geschmack geformt. An Charakter und Intelligenz brauchte sie ja nichts hinzuzufügen.«
»Weiß Gott nicht. Ich habe Ihre Gattin immer bewundert. Aber jetzt verplaudern wir uns. Kommen Sie. Hier, diese Kajüte haben Sie für sich. Frederick wird Ihnen helfen, wenn Sie sich erfrischen. Sagen Sie ihm, wenn ich Ihnen mit Kleidung aushelfen soll. In einer Stunde essen wir mit dem Flaggkapitän und dem Flottenarzt. Sie kennen ihn, und er kann Ihnen von Ihren Verwundeten berichten.«
Peter Kemp, Davids Koch, hatte ihnen ein Menu zubereitet, das Oberst von Rostow in den höchsten Tönen lobte. »Die Franzmänner liebe ich wirklich nicht, aber ihre Küche genieße ich immer wieder gern.«
Die anderen nickten, und David brachte den Toast auf den König aus. »Nun wollen wir aber erst einmal hören, was Sie an Land angestellt haben, lieber Herr von Rostow. Dann erst wird der Nachtisch serviert.«
Der Oberst trank noch einen Schluck und erzählte dann, wie sich der Herzog von Wellington vor der überlegenen französischen Armee zur Serra do Buçaco zurückgezogen habe. Dort halte er Stellungen, an denen sich die Franzosen die Köpfe einrennen könnten.
»Von den Freischärlern erfuhren wir dann, dass Masséna seine Belagerungsartillerie auf einen küstennäheren Weg dirigiert hatte. Ich bin mit einem Bataillon durch die Berge marschiert und habe den Tross bei Viseu abgefangen. Aber der Rückweg durch die Berge war inzwischen durch die Franzosen blockiert. Da sind wir zur Küste ausgewichen, und ich habe Fischkutter ausgesandt, um unsere Flotte zu suchen.«
»Aber wie kam es zu dieser riesigen Explosion?«, fragte Harland.
»Nun, die Franzosen hatten allein fünfzig Ochsenwagen mit Pulver bei sich. Die haben wir alle zusammengefahren, die Geschützrohre mit Pulver gefüllt und dann verpfropft, die Mörsergranaten dazu, und als der Hauptteil meiner Truppen am Strand war und Franzosen in unsere Nähe kamen, haben wir mit einer ganz langen Lunte gezündet. Ich muss zugeben, ich konnte die nächsten drei Stunden nichts hören, so hat es gekracht.«
Die Briten applaudierten und tranken ihm zu. »Ein Glück, dass Sie dabei nicht so zugerichtet wurden wie damals, als ich Sie vor Lübeck zurechtflicken musste, Mr Rostow«, sagte Dr. Cotton.
»Was war denn da?«, fragte Harland.
»Nun, die Franzosen hatten den Herrn Oberst gefoltert, kaum ein Fetzen Haut war nicht zerschunden.«
»Ja«, bestätigte von Rostow. »Sie haben damals gute Arbeit geleistet, Dr. Cotton. Aber es waren süddeutsche Truppen, keine Franzosen. Auch jetzt hat der Masséna mehr Polen, Holländer und Deutsche bei sich als Franzosen.«
Edward und Frederick servierten die Nachspeise, und die Herren wandten sich anderen Themen zu. Der Oberst erzählte von Lissabon und der großen Befestigungsanlage, die Wellington bei Torrès Vedras, etwa fünfzig Kilometer nördlich von Lissabon, zwischen der Küste und dem Tejo angelegt habe.
»Dort kommen die Franzosen nicht durch, und das Land bietet ihnen keine Nahrung.«
»Aber was machen Sie mit den Bewohnern des Landes? Die können doch nicht verhungern«, fragte Dr. Cotton.
»Die ziehen mit den Truppen zurück. Lissabon ist schon überfüllt mit Flüchtlingen. Ohne den Nachschub über See könnten wir das nicht durchhalten. Doch die Franzosen erhalten diesen Nachschub nicht und müssen früher oder später zurück.«
Die Befestigungslinien bei Torrès Vedras waren ein System sich gegenseitig deckender Forts, das britische Ingenieure geplant und portugiesische Arbeiter gegen Bezahlung gebaut hatten.
»Verteidigt wird es von der Militia, die man etwa so einschätzen kann wie die britische Heimatverteidigung. Dadurch sparen wir die gut ausgebildeten Feldtruppen für die Offensive, und im Rücken der Belagerer greift die ordenança an, wie die Portugiesen ihre Freischärler nennen. Die Spanier sagen Partidas oder Guerillas«, erklärte von Rostow.
Kapitän Harland wandte ein: »Lieber Herr Oberst, hat die Führung diese Freischärler, die doch in kleinen Banden operieren, überhaupt im Griff? Die plündern doch lieber, als dass sie Truppen angreifen. Das ist doch wie bei den Freibeutern auf dem Meer.«
»Sie haben Recht, Herr Kapitän, die ordenança ist nur begrenzt steuerbar. Aber im Unterschied zu den Freibeutern haben sie aus Patriotismus zu den Waffen gegriffen, nicht aus Gewinnsucht. Und durch Prämien für Angriffe gegen Truppen kann man sie schon in gewisser Weise lenken. Und bei den Überfällen auf den feindlichen Nachschub verbinden sich beide Motive in einer für unsere Armee nützlichen Weise.«
Der Wind hatte am Morgen etwas aufgefrischt. David war jetzt sicher, dass sie vor dem Abend in Lissabon einlaufen könnten. Er ließ dem Kutter signalisieren, dass er mit Post voraussegeln müsse. Der Kutter kam längsseits. Eine Leine wurde hinübergeworfen, an der der Postsack dann zum Kutter schwebte. Der Konvoi kündigte die bevorstehende Ankunft an und meldete, welche zusätzlichen Truppen sie aufgenommen hatten. So würde auch für die Verwundeten alles vorbereitet sein.
An Bord der Tonnant war an diesem Sonntag die fällige Inspektion der Seeleute, ihrer Kleidung und ihrer Hängematten wegen der vielen Soldaten an Deck nicht möglich. So wurde nur der Gottesdienst abgehalten. Dann wurde Mittagessen ausgegeben. Die Soldaten erhielten ihren Rum wie die Seeleute, und am Nachmittag saßen alle vereint an Deck und erfreuten sich ihrer Freizeit.
David ging mit von Rostow auf dem Achterdeck auf und ab. Von Zeit zu Zeit sahen sie dem Treiben zu. »Sehen Sie, in manchen Gruppen gehen Soldaten und Seeleute gemeinsam ihren Freizeitunterhaltungen nach«, sagte David.
»Meine Leute sind den Kontakt zur Marine gewohnt. Wir waren eine Zeit lang in Gibraltar, dann lebten wir auf Sizilien, und jetzt sind wir hier. Das erforderte nicht nur Schiffstransporte, sondern oft auch Operationen, bei denen uns die Flotte an Land brachte und wieder zurückholte. Das hat das Verständnis füreinander gefördert.«
Dann wurden sie abgelenkt, weil vor der Tonnant eine riesige Schule von Delfinen im Wasser spielte. Die Decks füllten sich mit Zuschauern. Aber niemand dachte daran, eine Angel auszuwerfen. Das war auf allen Schiffen, auf denen David Winter etwas zu sagen hatte, stets verboten gewesen. Seitdem sein erster Schiffsarzt, der nun verstorbene Richard Lenthall, seine Liebe für diese intelligenten Tiere geweckt hatte, konnte er nie genug davon bekommen, ihnen zuzusehen.
Auch jetzt stand er mit Herrn von Rostow an der Reling und wies ihn auf diese oder jene Gruppe hin, die ihr Schiff umspielte.
»Die lachen uns ja an«, sagte Rostow.
»Nein«, belehrte ihn David. »Sie haben nur so schräge Augenfalten. Das erweckt diesen Eindruck. Aber es ist schon möglich, dass sie sich über unsere plumpen Schiffe amüsieren.«
Die Soldaten zeigten mit lauten Rufen auf die Zweiergruppen, die immer wieder synchron aus dem Wasser sprangen und elegant wieder eintauchten. Dann erregten die kleinen Delfine ihre Aufmerksamkeit, die ein Muttertier umspielten.
»Deck!«, unterbrach sie die Stimme des Ausgucks. »Kap Raso backbord voraus!«
Sie schauten nach vorn. Es war kein spektakulärer Anblick, denn das Kap ragte weder hoch auf noch besonders scharf ins Meer hinaus. Aber jeder wusste, nun waren es nur noch wenige Meilen zur Mündung des Tejo. Bald würde man wissen, ob der Wind günstig war, um einzulaufen und den Duft der großen Stadt zu schnuppern.
»Kommen Sie, Herr von Rostow, gehen wir noch eine Tasse Kaffee trinken, ehe wir uns das Einlaufen ansehen.«
Als sie wieder an Deck traten, war das Achterdeck gefüllt mit allen, die es betreten durften, also auch der Zahlmeister, die Offiziere der Seesoldaten, der Schiffsarzt, der Schulmeister und fast alle Midshipmen. Von Zeit zu Zeit scheuchte sie der wachhabende Offizier an die Seite, wenn Schiffsmanöver es erforderten.
David sah, wie der Master die Midshipmen um sich versammelt hatte und ihnen erklärte: »Dort an der südlichen Tejo-Mündung sehen Sie die Insel Bugio. Man erkennt sie an dem Turm, den sie Torre de Bugio nennen.«
Er wies sie dann auf die Untiefen hin, die sich südlich und westlich der Insel und westlich vom Nordufer erstreckten, erklärte ihnen, dass die Fahrrinne des Tejo, auch Tagus genannt, nur etwa eine Meile breit sei und man sofort ankern müsse, wenn der Wind nicht mehr aus westlicher Richtung wehe.
»Es ist wie anno vierundsiebzig, als ich als junger Spund fast wörtlich die gleichen Erklärungen von unserem Master hörte«, sagte David.
»Waren Sie seitdem nicht mehr hier?«, fragte von Rostow zurück.
»Doch. Zuletzt vor acht Jahren, als ich mit meiner Familie eine Reise ins Mittelmeer unternahm. Wir hatten gerade einmal Frieden damals. Die Brigg werden wir vielleicht bald sehen. Sie heißt nach meiner Frau Britta und wurde als Kanonenbrigg von der Flotte angekauft.«
Als sie zurückblickten, sahen sie, wie sich der Konvoi mühsam in eine einzige Kolonne für die Einfahrt in den Tejo gruppierte. Glücklicherweise stand der Wind günstig. Sie passierten das Fort Sao Juliao an der Nordseite und nahmen den Lotsen an Bord. Die Zoll-, Gesundheits- und Hafenformalitäten, die in Friedenszeiten vor Trafaria zu erledigen waren, entfielen jetzt. Der Geleitzug würde erst in der Bucht kontrolliert werden.
Der Master lenkte ihre Aufmerksamkeit nach Norden. »Dort ist der Turm von Belem, eines der Wahrzeichen Lissabons. Er steht im seichten Uferwasser und hat zwei bis vier Geschütze in einer hoch gelegenen Kasematte.«
»Gebaut im maurischen Stil«, ergänzte Kapitän Harland.
Jetzt übernahm der Schulmeister die Instruktion der Midshipmen und erzählte von dem schrecklichen Erdbeben, das diese schöne Stadt, von der man auch sagte, sie sei auf sieben Hügeln erbaut, vor über einem halben Jahrhundert betroffen hatte.
Dreißig- bis vierzigtausend Menschen hätten während der Gottesdienste an Allerheiligen den Tod gefunden, als die Erde bebte und hundertzehn Kirchen und etwa fünftausend Paläste und Häuser einstürzten. Fast ein Viertel der Bevölkerung starb, erschlagen von den Trümmern, ertränkt von den Flutwellen oder verkohlt in den Bränden.
»Dort auf der rechten Seite sehen Sie die Burg mit der Altstadt, links die obere Stadt. Hier in der Mitte war fast alles zerstört. Aber nun ist alles wieder aufgebaut mit breiteren, zum Teil schnurgeraden Straßen.«
Dann mussten alle, die nicht mit den Ankermanövern beschäftigt waren, an die Seite treten. Vor ihnen öffnete sich das Hafenbecken.
»An Deck!«, rief der Ausguck. »Zehn britische Kriegsschiffe im Hafen. Flaggen auf Halbmast.«
David nahm das Teleskop. Was sollte das bedeuten? Aber jetzt stiegen die Flaggen ganz am Mast empor, und die Schiffe begannen, den Salut für den ankommenden Admiral zu schießen.
Das konnte nur bedeuten, dass sein Vorgänger verstorben oder gefallen war und dass sie Halbmast gesetzt hatten, bis der Nachfolger eintraf.
»Sehen Sie das Flaggschiff meines Vorgängers, Mr Harland?«, fragte David.
»Nein, Sir. Aber dort kommt ein Boot mit einem Admiral an Bord.«
David sah sich das Boot an. Das konnte nur der Zweitkommandierende, Admiral Thomas Williams, sein.
Der Admiral wurde mit allen Ehren begrüßt, schritt auf David zu, stellte sich vor und drückte sein Bedauern aus, dass er ihn mit der Nachricht vom Tode seines Vorgängers begrüßen müsse.
»Das Flaggschiff, das den Leichnam in die Familiengruft überführt, segelte gestern Abend. Der Tod kam ganz plötzlich. Ein Malariaanfall, ein altes Leiden, aber diesmal hat das Herz ihn nicht ausgehalten. Der Admiral starb in Sekunden. Er freute sich so, dass Sie ihn ablösen würden und er sich in der Heimat erholen könne, Sir David.«
»Das ist ein tragisches Schicksal. Möge ihm der Herr den ewigen Frieden gönnen.« David nahm seinen Hut ab. Die Umstehenden taten es ihm gleich. Und sie verharrten einige Augenblicke schweigend.
»So, Mr Williams, bitte begleiten Sie mich in meine Kajüte, damit Sie mir und meinem Flaggkapitän die dringendsten Aufgaben schildern können.«
Dann wandte sich David noch einmal um. »Herr von Rostow, der plötzliche Tod meines Vorgängers ändert meinen Terminplan. Wir müssen erst die nächsten Schritte besprechen. Mein Schreiber hat Ihre Adresse. Ich nehme Kontakt auf, sobald ich kann. Grüßen Sie Ihre Gattin. Es war eine Freude, Sie an Bord zu haben.«
General Sir George Abercrombie hockte hinter einem mannshohen Felsbrocken und studierte mit dem Teleskop die anrückenden französischen Truppen. Links und rechts hinter ihm verbargen sich hinter dem Gebirgskamm die Soldaten von Sprys portugiesischer Brigade und von der Loyal Lusitania Legion, alles portugiesische Soldaten, die er und seine Offiziere ausgebildet hatten.
Wellington hatte die Stellung auf dem etwa zwölf Kilometer langen Gebirgszug der Serra do Buçaco gut gewählt. Sie lag genau in der Marschrichtung der französischen Armee unter Masséna und ragte bis zu sechshundert Metern auf. Die Hänge brachen teilweise schroff ab. Tiefe Rinnen durchzogen sie. Das war kein Gelände für Kavallerie.
Die Engländer und Portugiesen hatten den Kanonenhagel der französischen Artillerie unbeschadet in Deckung hinter den Kuppen überstanden und warteten nun auf den Angriff der Infanterie.
Abercrombie sah diese jetzt in starken Kolonnen langsam die Abhänge erklimmen. Es war wieder halb Europa unter Frankreichs Fahnen vereint: Polen, Holländer, Hessen, Pfälzer und auch eine hannoveranische Legion. Landsleute standen gegeneinander, denn in den britischen Reihen kämpfte von Löwes Brigade von der Königlich Deutschen Legion, auch zum großen Teil Hannoveraner, wie sein Freund David Winter. Ob der wohl schon in Lissabon war?
Knatternde Schüsse rissen den General aus seinen Gedanken. Die vorgeschobenen Scharfschützen der Briten nahmen die anrückenden Kolonnen unter Feuer. Die Schützen waren in den steinigen Hügeln kaum zu entdecken. Sie würden den Angreifern mächtig zusetzen. Und dann würden seine Soldaten auf den Kamm vorrücken und ihre Salven in die feindlichen Kolonnen schießen. Abercrombie war ganz gelassen. ›Seine‹ Portugiesen würden die Bewährungsprobe bestehen. Die Stellung war zu gut gewählt. Und beim nächsten Mal waren sie dann vielleicht erfahren genug, um im offenen Gelände zu widerstehen.
Es waren Truppen des Divisionsgenerals Reynier, die gegen sie anrückten. Am rechten Rand der Kolonne war der Vormarsch ins Stocken geraten. Die Scharfschützen hatten zu viele Opfer gefunden. Soldaten warfen sich zu Boden, um Deckung zu finden. Andere blieben ratlos stehen. Einige wandten sich zur Flucht.
Da ritt ein französischer Offizier mit zwei Adjutanten heran, schwang den Säbel und brüllte auf die Zögernden ein. Sie stellten sich wieder auf, und der Offizier ritt an ihrer Seite, um sie zur Kolonne zurückzuführen. Da traf ihn die Kugel eines Scharfschützen in die Brust. Er riss den Arm mit dem Säbel hoch. Der Säbel löste sich und flog weiter. Der Offizier sackte zusammen und rutschte seitwärts vom Pferd. Ein Adjutant stieg ab und lief zu ihm. Der andere reihte sich bei den Soldaten ein und führte sie voran.
»Tapfere Kerle«, murmelte Abercrombie. Dann rief er seinen Truppen zu: »Fertig machen! Gewehre überprüfen!«
Jetzt waren die Kolonnen der Angreifer auf fünfzig Meter heran. Dumpf hallten die Schläge ihrer Trommler. »En avant!«, brüllten die Offiziere.
Abercrombie hob die Hand. Dann schrie er: »In Linie vorrücken!«, und winkte mit dem Arm. Nun ratterten ihre Trommeln. Die Portugiesen stapften zum Bergkamm und hielten die Gewehre fest vor dem Körper umklammert. Die Offiziere riefen Befehle, als sie den Kamm erreicht hatten. Die erste Reihe kniete nieder und hob die Kolben an die Schulter. Sie zielten, dann senkte der Bataillonskommandeur den Degen, die Leutnants riefen »Feuer!«, und eine etwas unregelmäßige Salve schlug aus nächster Nähe in die französische Kolonne. Dutzende von Angreifern fielen.
Die zweite Reihe der Portugiesen trat vor, kniete nieder, legte an und zielte: Wieder knatterte die Salve hinaus. In den Kolonnen der Angreifer stürzten erneut viele. Sie stockten. Dann trieben Offiziere sie wieder voran.
Die erste Reihe der Portugiesen hatte nachgeladen, trat nach vorn und feuerte erneut. Jetzt wankten die Kolonnen. Das war der Augenblick! Abercrombie schrie mit aller Kraft: »Bajonett pflanzt auf! Angriff voran!« Er lief mit gezogener Pistole auf den Feind zu. Aus den Augenwinkeln sah er, dass seine Soldaten folgten. Er hörte ihr Hurrageschrei.
Vor ihm hob ein riesiger Korporal sein Gewehr, um ihm den Kolben über den Schädel zu hauen. Abercrombie schoss ihm in die Brust. Er trat über den zusammengesunkenen Leichnam hinweg und schlug mit dem Säbel auf die Feinde ein. Neben ihm stachen die Bajonette zu. Dann sah er die Füße, die sich auf dem am Boden liegenden Gegner abstützten, die Hände, die das Bajonett aus dem Leichnam zogen und es wieder zum Vormarsch vorausreckten. Wie sie es gelernt haben, dachte Abercrombie und war stolz auf seine Soldaten.
Die Kolonnen der Angreifer wandten sich zur Flucht. Jetzt half kein Geschrei der Offiziere mehr.
»Halt!« schrie Abercrombie. »Formt die Linie! Gewehre laden!« Er atmete heftig während der Pausen zwischen den Befehlen und hörte, wie seine Offiziere alles wiederholten. »Legt an!« Sie zielten. »Feuer!« Einige der Flüchtenden stürzten, die anderen rannten noch schneller. »In die Ausgangsstellungen zurück!«, befahl Abercrombie und blickte ins Tal, wo sich neue Kolonnen formierten.
Er ging die Linien seiner Soldaten ab, die sich wieder hinter dem Bergkamm hingekauert hatten und Bajonette und Gewehre reinigten. Abercrombie lobte sie. »Gut gemacht, Männer! Aber sie werden wieder kommen. Diesmal schicken sie ein italienisches Regiment. Aber wir werden sie immer wieder zum Teufel jagen!«
Zuerst schoss die französische Artillerie, doch sie richtete keinen Schaden an. Hin und wieder riss ein Steinsplitter eine Schramme, aber niemand verließ seinen Posten. Dann hörten sie erneut die Trommeln. Abercrombie sah die Fahnen flattern und die Kolonnen mühsam den unwegsamen Hang hinaufsteigen. Warum lässt der Masséna seine Leute hier frontal anrennen?, dachte Abercrombie. Sie haben doch keine Chance.
Die Scharfschützen fanden ihre Ziele, sprangen auf und rannten in die nächste Deckung zurück. Die Kolonnen marschierten langsamer als die vorigen. Hinter den Kolonnen sah Abercrombie eine Linie anders uniformierter Soldaten. Das waren Franzosen. Die sollten wohl aufpassen, dass die Italiener nicht zurückrannten.
Noch einmal schlugen französische Kanonenkugeln auf dem Bergkamm ein. Dann schwiegen die Geschütze, weil die eigenen Kolonnen zu nahe herangerückt waren. Abercrombie ließ eine Linie der Portugiesen zum Bergkamm vorrücken. Sie legten sich auf den Boden und schossen schon auf größere Entfernung auf die Kolonnen.
Viele Angreifer stürzten und brachten die Kolonnen in Unordnung. Aber sie fassten noch einmal Tritt. Abercrombie ließ auch die zweite Reihe vorrücken und feuern. Und nun war kein Halten mehr. Die Angreifer flohen den Hang hinunter, auch wenn von unten die eigenen Leute auf sie schossen.
»Schaut euch das nur an! Sie feuern auf die eigenen Leute!«, rief Abercrombie. Er sah die Rauchwolken in der Ebene, aber er hörte die Kanonenkugel nicht, die über ihm in den Hang schlug und den großen Stein ins Rollen brachte.
»Sir George!«, rief sein Adjutant entsetzt, aber Abercrombie konnte nur etwas ausweichen, und der große Stein traf noch seine rechte Brust und warf ihn um, ehe er weiter den Hang hinunterpolterte.
Abercrombie wollte sich aufrappeln, aber es stach und schmerzte an seiner rechten Seite, dass er den Schmerz hinausstöhnte und zurücksank.
»Sind Sie verletzt, Sir George?« Der Adjutant beugte sich über ihn.
Abercrombie tastete mit der linken Hand an die rechte Brust. »Keine offene Wunde. Vielleicht Rippen gebrochen oder geprellt. Ich brauche einen festen Verband. Suchen Sie einen Sanitäter, der eine Binde hat. Und sagen Sie, dass den Mannschaften Verpflegung ausgegeben wird. Sie haben sich gut gehalten.«
Sie richteten ihn auf. Er stützte sich an einem großen Felsen ab, und der Sanitäter wickelte eine Binde fest um die Brust. Abercrombie atmete flach und probierte ein paar Schritte. »Es geht. Ich reite zum Konvent zum Herzog. Generalmajor Hamilton übernimmt mein Kommando. Sagen Sie bitte meinem Burschen, er soll die Pferde bringen.«
Abercrombie erreichte Wellingtons Hauptquartier fast ohne Bewusstsein. Sein Adjutant und sein Bursche hoben ihn vom Pferd. Der Adjutant gab ihm etwas Kognak aus einer Taschenflasche zu trinken. Der Bursche hatte einen Lappen am nahen Brunnen befeuchtet und rieb Abercrombies Gesicht ab.
»Danke, es geht schon besser. Helft mir zum Herzog!«
Sie führten ihn in das alte Kloster zu Wellington. Der studierte die Karte und erteilte Befehle. Aber er ging sofort zu Abercrombie, als er seinen Zustand erkannte.
»Sind Sie verwundet, Abercrombie? Wie steht es an Ihrem Abschnitt?«
Abercrombie antwortete mit Mühe. »Es ist nur eine Rippenquetschung oder ein Bruch. Wir haben zwei Angriffe zurückgeschlagen. Wenn sie es noch einmal versuchen, werden sie wieder zurückgejagt. Die portugiesischen Truppen haben sich gut gehalten.«
»Ausgezeichnet, mein Lieber. Auch bei uns haben sie sich tapfer geschlagen. Aber jetzt bringen wir Sie ins Nebenzimmer, und mein Leibarzt kümmert sich um Sie. Danach fahren Sie zu den Forts bei Torrès Vedras und sagen, dass sie alles alarmieren sollen. Masséna will unsere Stellung umgehen, und ich ziehe mich bald nach Torrès Vedras zurück. Dort können sich die Franzosen die Köpfe einrennen. Ich verabschiede mich dann noch von Ihnen. Viel Glück erst einmal.«
Der Arzt untersuchte Abercrombie gründlich und drückte, dass der ein Stöhnen nicht unterdrücken konnte.
»Wie heißt Ihr Adjutant?«, fragte er dann etwas überraschend.
»Elting«, antwortete er fast automatisch.
Der Arzt rief nach Hauptmann Elting und sagte dann: »Bitte hören Sie gut zu, Hauptmann. Achten Sie darauf, dass der Patient alle Anordnungen befolgt. Auf Patienten selbst kann man sich nicht immer verlassen.«
Dann erklärte er, dass Abercrombie schwere Quetschungen habe und eine Rippe möglicherweise angebrochen sei. Er werde Salbe einreiben und einen festen Verband anlegen. Der Patient dürfe auf keinen Fall reiten, sondern müsse liegend transportiert werden.
»Die nächsten vier Tage muss der General liegen. Der Verband bleibt. Dann muss ein Arzt einen neuen Verband anlegen, und der General darf mit schräger Rückenlehne sitzen. Aber keine weichen Kissen, sondern zusammengelegte Decken. Nach weiteren drei Tagen darf er gehen, aber nicht ohne Binde. Keinesfalls reiten! Ich gebe jetzt noch ein Schmerzmittel.«
Wellington schaute herein. »Wie gut, dass es nichts Ernstes ist. Sie können sich in Ihrem Hauptquartier ausruhen. Werden Sie wieder ganz gesund. Wir alle brauchen Sie, mein Lieber. Ach ja, vor einer Stunde kam der Melder, dass der Konvoi mit dem Flaggschiff Ihres Freundes in Lissabon eingetroffen ist. Dann haben wir endlich die Kanonen, die wir brauchen.«
Abercrombie schlief meist während der Fahrt mit dem Pritschenwagen, in dem er auf einem Deckenpolster lag. Im Hauptfort der Linie von Torrès Vedras weckte ihn sein Adjutant so weit auf, dass er dem Befehlshaber die Befehle Wellingtons übermitteln konnte. Dann fuhren sie ihn weiter in sein Hauptquartier in Sintras. Der schöne Ort war die Sommerresidenz der Könige gewesen. Eine der Villen war ihm zur Verfügung gestellt worden. Dort brachten sie ihn ins Bett, verabreichten ihm noch Tropfen, die der Arzt mitgegeben hatte, und ließen ihn schlafen.
Admiral Williams war ein kleiner, hagerer Mann, der sich und seine Kleidung ständig auf Korrektheit kontrollierte. Das Glas, mit dem sie auf den König tranken, wurde korrekt an der Grenze zum oberen Drittel des Stieles angefasst, er richtete sich straff während des Toastes auf, stellte das Glas exakt auf den Untersetzer zurück, tupfte den Mund mit einem Tüchlein ab, das er aus dem Umschlag seiner Uniformjacke holte, und sah David an.
»Darf ich beginnen, Sir David?«
»Ich bitte darum, Admiral Williams.«
Und Williams schilderte zunächst in sorgfältig gewählten Worten die militärische Lage und dann seinen Aufgabenbereich, wie ihn Davids Vorgänger abgesteckt hatte.
»Ich war für die Konvois und die inländischen Aufgaben zuständig, wenn ich so sagen darf, Sir David. Das beinhaltete die Unterstützung der Armee mit Kanonenbooten und Flachschiffen auf dem Tejo, die Abordnung von Seesoldaten zur Armee und die Vorbereitung von Brückenschlägen, falls die Armee den Tejo überqueren muss. Natürlich heißt das nicht, dass sich Ihr Vorgänger nicht die Verantwortung für alles vorbehalten hätte, aber die unmittelbaren Aufgaben besonders in der Organisation der Konvois hat er auch gern delegiert, und ich habe sie mit der Außenstelle des Transportamtes in Lissabon wahrgenommen.«
David war das sehr angenehm. »Ich werde nicht an der bewährten Ordnung rütteln, Admiral Williams. Aber ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie die Zeit erübrigen würden, mich in Ihren Bereich einzuführen. Besonders die Kanonenboote auf dem Tejo interessieren mich sehr. Erinnerungen an die Zeit werden wach, als ich als Jüngling ein Kanonenboot auf dem Lake Champlain kommandierte. Aber jetzt muss ich mich erst beim Gouverneur vorstellen. Vielleicht können Sie mir noch ein paar Tipps geben. Heute Abend würde ich gerne mit Ihnen speisen. Wäre Ihnen das recht?«
David saß mit seinem Flaggleutnant William Napier vor dem Gouverneur, schlürfte aus der Tasse den bitterschwarzen Kaffee und tauschte mit Hilfe des Dolmetschers, Mr Pinto Eanes, Höflichkeiten mit dem Gouverneur aus. Der Gouverneur fragte David, ob er darauf vorbereitet sei, außer der britischen Armee auch die portugiesischen Beamten und ihre Angehörigen zu evakuieren.
»Nach meinen Informationen beabsichtigt die britische Armee keine Evakuierung, Exzellenz. Sie ist im Gegenteil sicher, die Franzosen vor Lissabon zurückzuschlagen. Aber wenn sich gegen alle Erwartungen die Notwendigkeit einer Evakuierung ergibt, haben wir etwa zweihundertfünfzig Schiffe zur Verfügung, um alle zu evakuieren, die es wollen.«
»Die Bevölkerung ist ängstlich, Sir David. Sie fürchtet die Übergriffe der Franzosen. Das müssen Sie verstehen.«
Die Tür öffnete sich unvermittelt, und ein Offizier trat ein. Der Gouverneur sah ihn ungehalten an, aber der Offizier meldete, dass ein Kurier vom Herzog von Wellington mit dringenden Nachrichten eingetroffen sei.
»Geben Sie her!«, sagte der Gouverneur, murmelte ein Wort der Entschuldigung zu David, öffnete den Umschlag und las. Sein Gesicht hellte sich auf.
»Ein Sieg, Sir David. Der Herzog von Wellington hat gestern am 27. September bei Buçaco den Franzosen eine Niederlage beigebracht. Sie rannten mehrmals gegen seine Linien an, wurden aber immer mit hohen Verlusten zurückgeschlagen. Der Herzog schreibt, dass sich die portugiesischen Brigaden mit Bravur geschlagen haben. Vertraulich teilt er noch mit, dass er sich langsam auf Torrès Vedras zurückziehen werde, da Masséna ihn zu umgehen versuche.«
»Ich gratuliere, Exzellenz. Das wird die Sorgen der Bevölkerung lindern.«
»Ich bin nicht so sicher, Sir David. Mit dem Rückzug flüchten wieder viele Einwohner nach Lissabon, müssen untergebracht und verpflegt werden. Sie wollen Mitleid erregen und verbreiten Schauergeschichten. Das kennen wir. Lassen Sie Ihre Seeleute ruhig an Land, Sir David, damit die Leute nicht denken, sie blieben segelbereit auf den Schiffen.«
David äußerte die Hoffnung, dass auch die Polizeibehörden nicht zu streng reagierten, wenn die Seeleute etwas über die Stränge schlügen. Dann verabschiedete er sich.
Alberto und Mustafa begleiteten ihn zur Kutsche. David ließ dem Kutscher sagen, er möge ihn zum Restaurant Chiado in der Rua Puertas fahren. »Zu einem Restaurant?«, fragte der Dolmetscher erstaunt.
»Ja«, sagte David kurz. »Ich habe dort eine Verabredung.« Sein Ton war so, dass Mr Eanes keine weiteren Rückfragen wagte.
David hatte vor seiner Abfahrt zum Gouverneur eine Nachricht von Luis Camon erhalten, der um dieses Treffen bat. Luis Camon war der portugiesische Mittelsmann und Vertraute seines Schwagers und Freundes William Hansen und hatte sich bereit erklärt, für David Informationen in Portugal zu sammeln und Agenten anzuwerben. Aber er hatte darauf bestanden, dass man ihn nie mit David sehen dürfen und er war daher auch nicht auf Davids Flaggschiff gereist, sondern als Maat auf einem der Schiffe der Reederei Barwell und Hansen.
Vor dem Restaurant sagte David zu Alberto: »Geh mit Mustafa rein, und sorgt dafür, dass uns keiner stört. Sie, Mr Eanes, warten Sie in der Kutsche.«
Alberto und Mustafa betraten das mit wenigen Gästen gefüllte Restaurant und wurden vom Wirt wortlos zu einem Zimmer im ersten Stock geführt.
»Ich geh rein, und wenn es noch eine andre Tür gibt, warte ich vor der. Du bewachst diese«, sagte Alberto.
Dann klopfte er und trat ein. Er kannte Luis Camon, und sie begrüßten sich kurz. »Wer ist der Mann, der aus dem Kutschenfenster schaut?«, fragte Luis.
»Der Dolmetscher Pinto Eanes«, antwortete Alberto wortkarg. Dann fragte er, wo die andre Tür hinführe.
»Zum Hintereingang, durch den ich das Haus verlassen werde.«
Alberto öffnete die Tür und sagte, dass er vor ihr warten werde. Dann trat David ein.
Er begrüßte Mr Camon und fragte, ob er eine gute Reise gehabt habe.
Camon bedankte sich und sagte: »Entschuldigen Sie, Sir David, dass ich nach dem Mann in der Kutsche frage, der sich Pinto Eanes nennt. Seit wann kennen Sie ihn?«
»Seit er sich in Portsmouth an Bord meines Flaggschiffes vor etwa vier Wochen meldete. Aber ich hatte bisher wenig mit ihm zu tun. Ich brauche ja erst jetzt einen Dolmetscher.«
»Sir David, ich bin so gut wie sicher, dass ich diesen Mann vor zwei Jahren in Viana do Castelo gesehen habe, als ich dort Matrosen für Mr Hansen anwarb. Er war der Führer der Franzosenanhänger. Ich müsste noch sehen, wie er sich bewegt, und hören, wie er spricht, um sicher zu sein.«
»Hm«, brummte David. »Er meldete sich mit einer Weisung der Admiralität, aber die kann man fälschen, und nachgeforscht haben wir nicht. Ich werde nachher mit ihm in der Wirtsstube ein Glas Wein trinken und ihn den Wirt etwas fragen lassen. Können Sie unbemerkt lauschen, Mr Camon?«