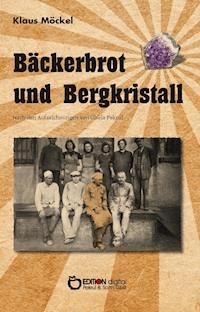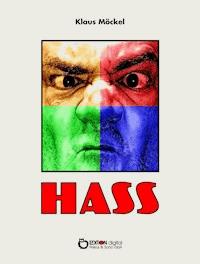8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frankreich, Mitte des 18. Jahrhunderts. In einer Zeit feudaler Machtherrschaft, des Sittenverfalls und verbissener religiöser Streitigkeiten beschließen der noch wenig bekannte Philosoph Diderot und sein Verleger Le Breton, ein Lexikon des Wissens und damit der geistigen Aufklärung herauszugeben. Doch diese „Große Enzyklopädie“ trifft auf erbitterten Widerstand. Der Polizeipräfekt und seine Spitzel, der Erzbischof von Paris, die Gerichtshöfe und Dunkelmänner aller Couleur bekämpfen das Werk. Während Diderot Mitstreiter um sich schart (d’Alembert, Voltaire, Rousseau), ist er stetiger Bedrohung ausgesetzt. Intrigen werden angezettelt, die Affäre um einen jungen Abbé und ein Attentat auf den König beschwören höchste Gefahren herauf. Es kommt zu Zerwürfnissen unter den Verbündeten und am Ende zum Verrat, der das Werk fast noch scheitern lässt. In dieser historisch fundierten, spannenden Novelle des schon mit „Die Gespielinnen des Königs“, „Gold und Galeeren“ und „Heiße Ware unterm Lilienbanner“ erfolgreichen Autors und Romanisten prallen die Gegensätze einer ganzen Epoche aufeinander. Nicht nur die genannten Personen, auch der König selbst und seine Mätresse, die berühmte Pompadour, greifen ins Geschehen ein. Adlige unterschiedlicher Couleur, Kirchenmänner, reiche Bürger wie der Verleger Le Breton, aber auch Handwerker, Lakaien, Dirnen, bevölkern ein von Widersprüchen erfülltes aufregendes Geschehen. Die Auseinandersetzungen um die „Große Französische Enzyklopädie“, von der Literatur bisher wenig beachtet, sind voller Dramatik und fordern den Vergleich mit den religiösen wie weltlichen Konflikten unserer Tage geradezu heraus.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Impressum
I. Teil
1
2
3
4
5
6
II. TEIL
1
2
3
4
5
6
7
III. TEIL
1
2
3
4
5
Einige Angaben zu den handelnden Personen
I. Die Enzyklopädisten
II. Die Gegner
Klaus Möckel
E-Books von Klaus Möcke
Impressum
Klaus Möckel
REBELLISCHES WISSEN
Diderots Kampf um die Große Französische Enzyklopädie
Historische Erzählung. Mit Kurzbiografien der wichtigsten handelnden Personen
ISBN 978-3-96521-205-3 (E-Book)
ISBN 978-3-96521-207-7 (Buch)
Gestaltung des Titelbildes: Ernst Franta
2020 EDITION digital
Pekrul & Sohn GbR
Alte Dorfstraße 2 b
19065 Godern
Tel.: 03860-505 788
E-Mail: [email protected]
Internet: http://www.edition-digital.de
Der Despotismus, meine Freundin, ist die schrecklichste aller Versuchungen: Man kann ihr nicht widerstehen. Wer alles ungestraft tun kann, tut viel Böses.
(Brief Diderots an Sophie Volland vom 1. 11. 1760)
Der achte Textband geht seinem Abschluss entgegen … Zuweilen war ich versucht, Euch einige Passagen abzuschreiben. Gewiss wird dieses Werk mit der Zeit eine Revolution im Denken bewirken, und ich hoffe, dass die Tyrannen, Unterdrücker, Fanatiker und Unduldsamen das Nachsehen haben. Wir werden der Menschheit einen Dienst erweisen, doch wir werden schon lange Staub und Asche sein, bevor man uns dafür Dank weiß.
(Brief Diderots an Sophie Volland vom 26. 09. 1762)
I. Teil
1
Die Finger, vorsichtig, zurückhaltend, fuhren über die Seiten, die noch nach Druckerschwärze rochen, glitten Zeile um Zeile den Text entlang, verweilten, wenn ein Satz, ein Wort ins Auge sprangen, kamen bei weniger interessanten Passagen ins Laufen. Schließlich ergriffen sie das Buch und blätterten es durch, von hinten nach vorn, bis sie das Titelblatt mit der Zeichnung erreicht hatten, mit der langen Aufschrift und dem Horaz-Zitat:
Tantum series junturaque pollet, tantum de medio sumptis accedit honoris!
„So viel Wissen ihr ansammeln könnt, so viele Ehren werden euch zuteil werden!“, übersetzte Nicolas-René Berryer, der Polizeipräfekt von Paris, frei und lehnte sich in seinem Sessel zurück. „Ein interessantes Buch, nicht ohne Geschick zusammengestellt. Ich bewundere die Arbeit, die diese Leute aufgewandt haben, um all die Seiten mit Wissen zu füllen. Eigentlich sollten wir ihnen dankbar sein.”
Der Mann, an den diese Worte gerichtet waren, zwinkerte überrascht mit den Augen. Ein Uhu im grauen Überrock, aufgeplustert, dickköpfig. Die Nase klein und krumm wie der Schnabel des Nachtvogels, die Backen welk, doch gleichzeitig sonderbar ausgestopft. Nur die vergilbte Perücke, unter der es wahrscheinlich von Läusen wimmelte, passte nicht zum Bild.
„Es ist ein sehr gefährliches Buch, Monsieur”, erklärte er eifrig. „Ein Buch, das sich gegen die heiligen Gesetze unseres Staates und gegen den Glauben richtet. Die Artikel sind voller Gotteslästerung. Und das Schlimmste: Es ist nur das erste einer ganzen Reihe. Ich habe es von Anfang bis Ende gelesen und einen Bericht darüber geschrieben.” Er deutete auf ein zusammengerolltes Pergament in seiner Hand. „Unter den unscheinbarsten Überschriften verbirgt sich das Gift der Zersetzung.“
Berryer legte den Band auf den Schreibtisch und schaute den anderen nachdenklich an. Mein Gott, dachte er, mit wem muss ich mich verbünden. Ich, Erster Polizeibeamter der Hauptstadt, der für die Sicherheit in den Straßen verantwortlich ist, der das Verbrechen und das Unrecht bekämpfen soll. Er schüttelte sich, als hätte er eine Schlange berührt. Nicht dass er seine Pflichten gegenüber dem Staat vernachlässigen wollte, aber der Kerl war ihm widerlich. „Findet mir ehrliche Leute, die den Beruf eines Spitzels ergreifen”, hatte einer seiner Vorgänger, der Graf d’Argenson, erklärt. Berryer hätte das sehr gern versucht. Doch er wusste, dass solche Bemühungen nichts, aber auch gar nichts brachten.
„Die Leute, Glénant, die an diesem Werk arbeiten, sind bekannte und geachtete Gelehrte”, sagte er lässig, beinahe belehrend. „Nehmt zum Beispiel Monsieur d’Alembert. Er ist ein bedeutender Mathematiker und Physiker, Mitglied mehrerer Akademien. Würde er seinen Namen für ein Unternehmen hergeben, das die von Euch erwähnten Anschauungen enthält? Ich kenne ihn, er ist ein vorsichtiger Mann.”
„D’Alembert ist ein Freigeist”, erwiderte der Mann mit dem Uhugesicht. „Es mag sein, dass er Vorsicht walten lässt, doch huldigt er subversiven Theorien. Außerdem ist er bei weitem nicht der Schlimmste im Bund. An der Spitze des Werkes steht als Organisator Diderot, ein höchst verdächtiges Subjekt. Er steckt seine Nase in alle möglichen Dinge. Er treibt sich in Cafés und Tavernen herum, wo er sich mit dem Pöbel gemein macht. Wie auch andere dieser sogenannten Philosophen, hat er eine Vorliebe für zweideutige Schriften. In einem seiner Bücher, das er ‚Die indiskreten Kleinode’ nennt, sind Dinge beschrieben …”
2
3
Die Kerzen in den schweren Silberkandelabern flackerten, leise klirrten die Scheiben der hohen, geschwungenen Fenster. Monseigneur Christophe de Beaumont, der Erzbischof von Paris, schritt erregt durch die Räume seines Palastes. Ein heftiger Zorn hatte ihn erfasst, rüttelte ihn durch, ließ ihn nicht zur Ruhe kommen. Den Saum seines Hausgewandes, eines violetten, seidenen Talars, achtlos am Boden schleifend, das schmucklose Obergewand mit dem herabhängenden Kragen aufgeknöpft, eilte er durch die Gänge und Galerien, scheuchte die Vikare, die Priester, die Ordensgeistlichen auseinander, die sich ihm demütig näherten, hastete die Treppen hinauf und hinunter. Erst als er wieder am Ausgangspunkt seiner Wanderung war, an einem Schreibpult, wo zu Füßen einer geschnitzten Jungfrau Maria ein kostbares, in Kalbsleder gebundenes Buch lag, blieb er stehen, und es hatte den Anschein, als wollte er mit der Faust auf die lackierte Platte donnern. Aber im letzten Augenblick besann er sich, ließ die schon erhobene Hand sinken und nahm den Marsch wieder auf.
Der Erzbischof war bis ins Innerste aufgebracht, weil trotz seiner unausgesetzten Bemühungen, seiner nie erlahmenden Anstrengungen, die Ketzerei auf ewig von Gottes Erde zu verbannen, Unglaube und Auflehnung gegen die Gesetze der wahren Kirche überhand nahmen. Erst heute Morgen hatte wieder einer seiner Pfarrer einem Tagelöhner die Sterbesakramente verweigern müssen, weil dieser sich nicht zur päpstlichen Bulle Unigenitus bekennen wollte, sondern an Quesnels verwerflichen Irrlehren festhielt. Aber nicht genug, dass die Jansenisten, diese Abtrünnigen, frech wie zu Zeiten des Port Royal ihr Haupt erhoben, es nahmen auch von Jahr zu Jahr in erschreckendem Maß Schriften zu, die das Wort Gottes überhaupt in Frage stellten. Deistisch-atheistische Machwerke schwemmten auf den Buchmarkt, griffen die Bibel an und zogen die heilige Offenbarung in den Schmutz. Meist erschienen diese Schriften anonym, gleichsam dem Schoß der Verdammnis entquollen, oder wurden unter einem Decknamen gedruckt und nach Frankreich herübergeschmuggelt. Aus der Schweiz, aus Holland. Aber das Buch, das da auf seinem Schreibpult lag, war nicht von solcher Verschämtheit. Hier in Paris publiziert, bekannten sich seine Herausgeber offen zu ihm. Sie verhielten sich in höchstem Grade aggressiv und taten dabei noch so, als breiteten sie vor den Lesern die natürlichsten Dinge der Welt aus.
Dieses Werk – schon den Namen „Enzyklopädie” empfand der Erzbischof als Herausforderung – erhob den Anspruch, das Wissen der Welt in seiner Gesamtheit, seiner Vielfalt und Fülle darzustellen. Er kannte die vor einem Jahr öffentlich gemachte Einleitung zu den Bänden, und schon sie hatte ihm das ungemein Bedrohliche dieses Vorhabens verdeutlicht. Schlug nicht zum Beispiel die These, dass jegliches Wissen über die Sinne zu den Menschen kam, ihrer Erfahrung entsprang, der Lehre von der göttlichen Eingebung ins Gesicht? Wurde nicht das Wunder der Schöpfung negiert, wenn man den Menschen als tabula rasa, als unbeschriebenes Blatt zur Welt kommen ließ, gleich den unbegnadeten Tieren und Pflanzen? Wo blieb in diesem Werk die erhabene Idee vom Weiterleben nach dem Tod, der Gedanke von der unsterblichen Seele, um welche die katholische Kirche mit all ihren Kräften rang? Die Verfasser predigten Toleranz, er aber wusste, was er davon zu halten hatte. Dieses Werk, das ersah der Erzbischof aus jedem bisher geschriebenen Wort, war Gift aus den Sudelküchen frecher Alchimisten, eitles Blendwerk des Satans und musste mit aller Schärfe bekämpft werden. Diderot und sein allseits gerühmter Mitstreiter, der Mathematiker d’Alembert, standen an der Spitze einer starken ketzerischen Streitmacht. Beaumont, der sich in Frankreich zum obersten Hüter des unverfälschten Glauben auserkoren fühlte, sah seine unabdingbare Aufgabe darin, ihr mit Feuer und Schwert zu begegnen.
Aber der Erzbischof war sich noch nicht über die Mittel im Klaren, mit denen er den Kampf am besten führen konnte. Es musste mehr geschehen als bisher, es musste viel energischer durchgegriffen werden, doch welche Maßnahmen waren die wirksamsten? Vor Wochen bereits, als er das Buch zum ersten Mal in der Hand hielt, hatte er seinen Einspruch bei allen zuständigen Stellen erhoben. Doch der Oberste Gerichtshof, das Parlement, setzte sich zu großen Teilen aus Jansenisten zusammen, die ihn hassten, und selbst beim König waren seine Bemühungen ohne Erfolg geblieben. Begriff der Monarch denn nicht, dass die Vorstellung, jeder Mensch erblicke mit gleichen Gaben und Voraussetzungen das Licht der Welt, auch an seinem Thron rüttelte? Autorität, so verkündete die „Enzyklopädie”, könne im Staat nur besitzen, wer sich auf das Recht stütze. Das sogenannte Naturrecht jedoch, das die Philosophen ihren Ausführungen zugrunde legten, missachtete die bestehende Ordnung. Es stand dem Prinzip, die geistlichen und weltlichen Herrscher seien von der Vorsehung zur Führung auserwählt, feindlich gegenüber, stellte die Rangordnung im Reich und das gesamte Ständewesen in Frage.
Christophe de Beaumont führte das Kreuz, das er um den Hals trug, an die Lippen. „Emitte lucem tuam!”, „Herr, schicke dein Licht.” Offensichtlich hatte die Freigeisterei bereits am Hof Fuß gefasst und nistete sich im engsten Bekanntenkreis Ludwig XV. ein. Kein Wunder übrigens bei der schrankenlosen Hurerei des Königs, bei der Mätressenwirtschaft, die allem moralischen Anstand Hohn sprach. Die Pompadour war ja nicht die einzige, an der Ludwig die Kraft seiner Schenkel erprobte. Seit den drei Nesle-Schwestern, die den damals noch jungen Monarchen nacheinander in ihre mit Damast bezogenen Betten gelockt hatten, versuchten die adligen Damen immer wieder, die offizielle Geliebte auszustechen und sich von der Majestät ein Kind machen zu lassen. Für die notwendigen Kontakte sorgten Höflinge, die der Pompadour die niedere Abstammung übelnahmen und größeren Einfluss gewinnen wollten. Der König selbst aber nahm die Liebesdienste gierig entgegen, genoss das sündige Reiterspiel. Sein Treueschwur auf die durch Gottes Priester geheiligte Ehe zählte dabei nicht.
Wie aber bei den Lüsten, so auch in vielen Bereichen sonst – das Wort aus Rom galt nicht mehr, und angebliche Freidenker hoben immer frecher ihr Haupt. Am Hof wollte man das nicht begreifen. Doch der Erzbischof war gewillt, dem Monarchen die Augen zu öffnen, ihm und den anderen, die das Böse gut redeten. Aus diesem Grund ereiferte er sich immer wieder, wenn er an die Enzyklopädie dachte. Und auch heute, da er sich erneut zu einer Attacke gegen das Werk rüsten wollte, hatte ihn Wut übermannt.
Er entwarf in Gedanken bereits einen Hirtenbrief, den er der Enzyklopädie entgegenschleudern konnte, als ihm durch einen Dienstboten hoher Besuch gemeldet wurde.
„Seine Exzellenz, der Bischof von Mirepoix, ist soeben vorgefahren, Monseigneur.”
Beaumont lebte augenblicklich auf und eilte dem Gast, ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten, über den Korridor und die breite Steintreppe, die zum Vestibül hinunterführte, entgegen. Obwohl er den anderen nicht erwartet hatte, kam ihm sein Besuch am heutigen Tag besonders gelegen.
De Boyer war ein lebensgewandter, nicht gerade kluger, aber außerordentlich geschickter Mann, der es verstanden hatte, Mitglied dreier Akademien zu werden, ohne ein einziges Werk veröffentlicht zu haben. Der Erzbischof hatte ihm, dem bereits Achtzigjährigen, sein Amt zu verdanken, denn als Angehöriger des Königlichen Rates war der Bischof für die kirchlichen Angelegenheiten des Landes und für die Benefizien zuständig. Aus diesem Grund herrschte ein etwas eigenartiges Verhältnis zwischen den beiden Würdenträgern. Ihre Auffassungen deckten sich in allen wesentlichen Punkten, aber obwohl Christophe de Beaumont den höheren geistlichen Rang bekleidete, kam er dem greisen Bischof von Mirepoix mit besonderer Ehrerbietung entgegen.
„Es ist leider kein erfreuliches Ereignis, Monseigneur, das mich heute zu Euch führt”, erklärte de Boyer, nachdem er sich umständlich in einem Sessel zurechtgesetzt, die oberen Knöpfe seines bis zu den Ellbogen reichenden Schulterkragens geöffnet und die steifen Schnallenschuhe gegen eine warme Fußbekleidung getauscht hatte. „Die Sorge um die uns anvertrauten Seelen treibt mich zu Euch.”
Christophe de Beaumont zwang sich, das Problem, das ihn soeben noch völlig beansprucht hatte, beiseite zu schieben. Es fiel ihm schwer, doch der Gast hatte das Recht, als erster gehört zu werden. Da er unangemeldet kam, musste es sich um eine wichtige Angelegenheit handeln.
„Ihr erschreckt mich, Exzellenz”, erklärte er, während zwei Ordensgeistliche in einfachen Gewändern ein kleines Diner, bestehend aus leicht bekömmlichen Speisen, auftrugen. Ein mageres, aber gut gewürztes Kalbssteak, gedünsteten Hecht, ein Rebhuhnfrikassee mit Reis, dazu verschiedene Salate sowie Käse, Obst und Gebäck zum Nachtisch. „Von welchem wenig erfreulichen Ereignis sprecht Ihr?”
Die Unmutsfalten auf der runzligen Stirn des Gastes glätteten sich, als er den Fisch, den Kuchen, die übrigen Leckereien sah. Sein hohes Alter brachte ihm zwar mancherlei Magenbeschwerden, dennoch liebte er ein gutes Mahl. Das Wasser lief ihm im Mund zusammen, aber er zwang sich noch zur Zurückhaltung. Seine Stimme hatte nicht den gewichtigen Unterton verloren, als er begann:
„Was ich Euch berichten will, Monseigneur, betrifft die Universität. Das Verhalten der Sorbonne gibt in letzter Zeit Anlass zu ernster Beunruhigung.”
Beaumont schaute ihn verblüfft an. Das Verhalten der Universität sollte Anlass zur Besorgnis geben? Das war kaum denkbar. Die Sorbonne war eine der wichtigsten Stützen des rechten Glaubens, und wenn er auch in jüngster Vergangenheit mit allem hatte rechnen müssen, von dieser Seite her glaubte er sich gesichert.
Er brauchte Zeit, um zu antworten. Während de Boyer nun kräftig zulangte, nahm er nur einige Schluck von einem köstlichen indischen Tee, den er bevorzugte. Er bemühte sich, ruhig zu bleiben, die eingetretene Stille zum Nachdenken zu nutzen.
„Worum geht es?”, wollte er schließlich wissen. „Ihr versetzt mich in Bestürzung.”
De Boyer kostete das Gefühl aus, besser informiert zu sein. Der Ton, in dem er antwortete, war greisenhaft eitel. Er berichtete von Professoren und Doktoren, die gefährliche Thesen unterstützt oder in Umlauf gebracht hätten. Die angeführten Beispiele freilich waren sehr allgemein. Endlich kam er auf den Kern seines Besuchs.
„Das schrecklichste Exempel von Glaubensverwirrung wurde erst vor einigen Tagen gegeben, Monseigneur. Ich meine die Doktorarbeit des Abbé de Prades über das Himmlische Jerusalem. Ihr habt noch nichts von dieser Angelegenheit gehört? Dann lasst Euch durch mich unterrichten. Dem äußeren Schein nach unterstützt der junge Mann die geheiligten Lehren unserer Kirche, doch redet er in Wirklichkeit der abscheulichsten Ketzerei das Wort. Er wagt es, die Heilungserfolge des Heiden Äskulap mit den Wundern gleichzusetzen, die einst Christus vollbracht hat. Leider sind seine Thesen von der Sorbonne ohne Widerspruch hingenommen, ja mit allen erdenklichen Ehren bedacht worden.”
Obwohl das Feuer im Kamin hell loderte und das Zimmer durch die dicken Mauern des Bischofspalastes vor der Dezemberkälte geschützt war, fror Christophe de Beaumont plötzlich. Musste er denn überall auf die Symptome der Verderbtheit stoßen? Nervös griff er nach einem Stück Biskuit, zerbröselte es aber zwischen den Fingern, anstatt es in den Mund zu stecken. Der Abbé de Prades? Ihm war, als hätte er den Namen schon früher gehört.
Der Bischof schien seine Gedanken zu erraten.
„De Prades”, fuhr er fort und knabberte dabei am gebratenen Kalbfleisch, „ist ein Bekannter Diderots, ein Freund jener Leute, die an der Enzyklopädie arbeiten. Seine Thesen sind im Sinne dieses Werkes abgefasst. Sie verbreiten Zweifel an unseren Glaubensprinzipien.”
„Ihr sprecht einen schweren Vorwurf aus”, wagte der Erzbischof einzuwenden. „Seid Ihr Euch Eurer Sache sicher?”
„Ihr könnt die Thesen selbst nachprüfen, Monseigneur, ich stelle Euch ein Exemplar der Arbeit zur Verfügung. Auch an meinen Informationen über den Abbé de Prades gibt es keinerlei Zweifel. Ihr kennt doch Glénant, den Polizeispitzel. Er arbeitet nicht nur für Berryer, sondern lässt sich seine Einkünfte auch ab und an von mir aufbessern. Seine Angaben sind zuverlässig.”
Ein Windstoß fuhr in den Kamin, verursachte ein Jaulen, als sei der Leibhaftige persönlich zugegen. Christophe de Beaumont hielt es nicht länger auf seinem Sitz. Vorbei war die Gemessenheit, zu der er sich gezwungen hatte.
„Aber die Sorbonne, die Sorbonne”, stöhnte er, während er mit großen Schritten den Raum durchmaß. „Warum nur hat sie den Frevel zugelassen, warum hat sie den Ketzer nicht zur Ordnung gerufen?”
De Boyer zuckte die Achseln, das Warum erschien ihm im Augenblick wenig wichtig.
„Vielleicht hat sich die Sorbonne nur täuschen lassen”, antwortete er schließlich, „vielleicht ist die Sache aber auch schlimmer. Freigeistige Ansichten nehmen in unserem Land in einem Maße überhand …” Er unterbrach sich, hustete; ein Stückchen Fleisch war ihm in die Luftröhre gekommen. Hochrot im Gesicht, erfüllte es ihn dennoch mit Genugtuung, dass er Beaumont mit seiner Nachricht hatte überraschen und verwirren können. Zwar tat der Erzbischof eine ganze Menge, um der schlimmen Entwicklung Einhalt zu gebieten, doch leider mit zu wenig Erfolg. Deshalb konnte man ihm gewisse Vorwürfe nicht ersparen.
Aber er hatte noch nicht alles erzählt.
„Man berichtet mir, die Sache sei bereits verschiedenen Leuten zu Ohren gekommen, die ihren Nutzen daraus ziehen werden. Dem Bischof von Auxerre in etwa und dem Parlement.”
„Dem Parlement?”
„Ganz genau.” Obwohl de Boyer selbst wenig erfreut war über diese Tatsache, konnte er ein triumphierendes Lächeln nicht unterdrücken. Er wusste, dass den Erzbischof diese Nachricht höchst unangenehm berührte. Denn das Parlement, diese aus dem Bürgertum hervorgegangene Advokatenaristokratie, war nicht eben wählerisch in seinen Mitteln. Es würde die Kritik an den Thesen als Waffe gegen ihn und die Jesuiten benutzen. Seht die Sorglosigkeit der Sorbonne und des Erzbischofs, dieser angeblich so unfehlbaren Streiter für den Glauben! Seht, wir müssen juristische Maßnahmen ergreifen, um die Religion zu schützen! Und der Bischof von Auxerre, gleichfalls ein bekannter Anhänger Quesnels, würde als Sieger dastehen, wenn er verdammen konnte, was von der Universität gebilligt worden war.
„Es muss etwas geschehen, Exzellenz, es muss sofort etwas getan werden!”
„Gerade deshalb bin ich zu Euch gekommen.”
„Aber was schlagt Ihr vor?”
De Boyer genoss seine Überlegenheit. Er legte die Stirn in Falten, nahm einen letzten Schluck Wein und wischte sich dann mit der Serviette sorgfältig die Bratensoße von den Lippen. Es gab nur eins, die Sorbonne musste ihren Irrtum eingestehen und ihre Zustimmung zu de Prades’ Doktorarbeit zurücknehmen.
„Die Sorbonne muss selbst Maßnahmen gegen diesen Abbé ergreifen”, sagte er, „und zwar noch bevor das Gericht etwas unternimmt.”
Sie schwiegen erneut. Der Erzbischof, ein wenig beruhigt, hatte sich wieder in seinen Sessel gesetzt.
„Vielleicht”, dachte er laut, „kann alles noch zur rechten Zeit in Ordnung gebracht werden. Nihil est quod deus efficere non possit. Es ist eine schwierige Situation, aber der Herr wird uns auch diese Prüfung bestehen lassen.”
„Gottes Wege”, pflichtete de Boyer bei, „scheinen oft verschlungen, doch wer seinem Wort folgt, findet die Mittel, aller Gefahr zu trotzen. Vielleicht ist es sogar von Vorteil, dass gerade der Abbé de Prades diese ketzerischen Thesen verfasst hat.”
„Von Vorteil? Ich verstehe nicht …”
„Ich sagte Euch doch, dass de Prades Mitarbeiter der Enzyklopädie ist.”
„Ihr meint”, äußerte der Erzbischof vorsichtig, „man könnte mit der Verurteilung der Arbeit zugleich … Man könnte die …”
„Oh, alles muss genau bedacht sein”, unterbrach ihn de Boyer.
Christophe de Beaumont erhob sich, trat an das Schreibpult und nahm das verhasste Buch in die Hand. Erst jetzt verstand er die ganze Bedeutung dieser Nachricht. Nie wieder würde es einen ähnlich triftigen Grund geben, die volle Schärfe des Gesetzes gegen die Gemeinschaft der Ketzer zu fordern, nie wieder ein treffenderes Argument, den königlichen „Großen Rat” und den Monarchen selbst von der Gefährlichkeit solchen Machwerks zu überzeugen.
„Ich wollte einen Hirtenbrief gegen die ‚Enzyklopädie’ entwerfen”, sagte er.
„Man muss den Angriff auf allen Ebenen führen”, stimmte de Boyer zu. „Macht aber auf jeden Fall Euren Einfluss auf die Sorbonne geltend. Die Sorbonne muss widerrufen. Ich verspreche Euch, dass ich die Hände in der Zwischenzeit nicht in den Schoß legen werde.”
Damit war alles gesagt. Der Bischof von Mirepoix erhob sich schwerfällig und trat zum Kamin, wo sein Schuhwerk stand. Er war mit seinem Besuch zufrieden, nicht zuletzt des Mahles wegen, das ihm die Zeit verkürzt und den Magen gefüllt hatte. Er bekreuzigte sich, die Augen auf die geschnitzte Heilige gerichtet, suchte nach einem passenden Abschiedswort, einem Zitat bei den Kirchenvätern, fand aber nichts, das der Situation Genüge getan hätte. Wie hatte ihn Voltaire, dieses eitle Großmaul, kürzlich genannt: den „Esel von Mirepoix”. Nun wohl, er würde es diesem niederträchtigen Lumpen zeigen. Wenn der Schlag gegen de Prades gut geführt war, konnte sein Fall bald zu den Akten gelegt werden. Doch die Enzyklopädisten und auch Voltaire würden nicht ungeschoren davonkommen. Sie sollten ihr blaues Wunder erleben – er, de Boyer, würde dafür sorgen.
Der Bischof, innerlich erregt, stampfte mit dem Fuß, so dass Beaumont erstaunt aufblickte.
„Ich kann Euren Zorn gut verstehen, Excellenz”, beeilte er sich kundzutun.
4
Nur wenige Wochen später – der zweite Band der Enzyklopädie war inzwischen erschienen – wurde der Abbé de Prades eines Morgens unsanft aus dem Schlaf gerüttelt.
„Monsieur, es hat geklopft. Monsieur, so hört doch, wacht auf! Jemand ist draußen an der Tür.”
De Prades, benommen vom Schlaf und von Rotwein, den er noch gegen Mitternacht in großen Mengen getrunken hatte, kam nur langsam zu sich. Er sah verständnislos die junge Frau an, die sich halb über ihn gebeugt hatte, ließ den Blick erstaunt über ihr Gesicht, die Schultern, die vollen nackten Brüste gleiten, die aus dem Ausschnitt eines dünnen Nachthemdes hervorschauten.
„Ach du, Jeannette”, sagte er schließlich beruhigt. „Was ist los, was gibt’s, weshalb weckst du mich? Draußen ist es noch finster, und ich bin todmüde. Leg dich wieder hin, und lass mich schlafen!”
„Nein, Monsieur”, sagte die Frau. „Ihr hört doch, dass es schon wieder klopft. Vielleicht ist es etwas Wichtiges. Verhaltet Euch ganz ruhig. Ich werde nachsehen, was man zu so früher Stunde von uns will.”
Sie schob behutsam die Hand des Mannes weg, der sie zu sich heranziehen wollte, und sprang aus dem Bett. Im Zimmer war es unangenehm kalt. Fröstelnd schlüpfte sie in einen wollenen grünen Schlafrock, der ihre Formen recht eindringlich zur Geltung brachte, streifte ein paar Pantöffelchen von gleicher Farbe über und verließ auf leisen Sohlen den Raum. Der Abbé, nun endgültig wach geworden, richtete sich leicht verstimmt in den Kissen auf.
Er ließ den Blick durch den großen, mit Mäanderornamenten über der Tür bemalten Raum schweifen. Billige Teppiche an den Wänden und vor dem Bett. Neben dem einteiligen Wäscheschrank befand sich ein Toilettentischchen mit einem messinggerahmten, ovalen Spiegel; in der Ecke beim Fenster stand in einem Kübel ein mannshohes Gewächs. Eine dunkel gestrichene Kommode, zwei Stühle, auf denen Jeannettes Unterwäsche und ein paar Kleidungsstücke des Abbé lagen. Eine Uhr, nach der Art des Rokoko verziert, vervollständigten das Mobiliar.
De Prades fuhr sich mit der Hand durchs Haar. Er versuchte seine Gedanken zu ordnen, sich möglichst genau die Nacht, den vorangegangenen Abend ins Gedächtnis zu rufen. Er musste sich eingestehen, dass er es mit den Grundsätzen, die ihm sein Gewand eigentlich auferlegte, wieder einmal nicht so genau genommen hatte.
„Wohin so schnell, mein Herr Abbé?
Ich fürchte sehr, Ihr tut Euch weh.
Ihr geht ganz ohne Kerze –
Hoho! –
Wohl zu galantem Scherze!”,
hieß es in einem bekannten Spottlied. Aber De Prades verspürte keine Gewissensbisse. Das Leben war kurz, und es war ja nur die eigene Seele, die er in Gefahr brachte. Außerdem – wer konnte ihm wirklich sagen, was es mit der göttlichen Gnade, mit dem Weiterleben nach dem Tod auf sich hatte?
Er rieb sich den Schlaf aus den Augen, reckte und streckte sich. Im vielbesuchten Café Procop waren sie gewesen, im Restaurant Toulouse und zuletzt in einer Taverne in der Nähe des Palais du Luxembourg. Eine fröhliche Gesellschaft von Anfang an: sein bester Freund, der Abbé Yvon, Marcel Ravin, seines Zeichens Komponist und Schauspieler, ein Kunstmaler, einige Bekannte aus dem Kreis der Enzyklopädisten, ein Kaufmannssprössling und zwei oder drei Nichtsnutze, die von der Tafel feiner Herren lebten. Sie schlugen sich durch, indem sie Verse schrieben, Artikel für mysteriöse Bücher verfassten, Briefe für verliebte Stutzer, die irgendeinem adligen Dummkopf Hörner aufsetzen wollten. Mit diesen Burschen hatte er gezecht und gelacht, sich Witze erzählt und diskutiert. Über Politik, die miese Finanzlage in der eigenen und in der Staatsbörse, und natürlich hatten sie sich auch über die Religion ausgelassen. De Prades war der Held des Tages gewesen, denn mit dem zweiten Band der Enzyklopädie war auch sein Artikel „Certitude” erschienen, der ihm bei den Freunden viel Ansehen eingebracht hatte.
Certitude, Gewissheit, ja, das war es, wonach sie sich alle sehnten. Nicht mehr diese Unsicherheit, dieses vergebliche Suchen, dieses Tasten zwischen all den offiziellen Lügen und Behauptungen. Den eigenen Erfahrungen musste man vertrauen, dem, was man mit eigenen Augen sehen, mit eigenen Ohren hören konnte. Gewissheit, darauf wollten sie alle mit De Prades anstoßen, und nachdem man des Philosophierens müde geworden war, leerten, füllten und leerten sich die Becher nur um so schneller.
Der Abbé wusste nicht mehr, wann sich Jeannette an seinen Tisch gesetzt hatte, er erinnerte sich nur noch, dass sie plötzlich da gewesen war und eine lange Geschichte aus ihrem Leben erzählt hatte. Schauspielerin war sie, hatte eine schwere Jugend und eine unglückliche Liebe hinter sich. Nun verlangte es sie nach Geborgenheit oder zumindest Seelentrost. De Prades glaubte ihr kein Wort, doch er fand sie hübsch und sehr zugänglich. Anfangs hatte noch eine andere Frau am Tisch gesessen, eine blonde, füllige, mit Manieren einer Dirne, aber die hatte den Abbé kalt gelassen. Schließlich war sie mit einem seiner Bekannten abgezogen, und Jeannette hatte das Feld behauptet. Bei einem besonders gepfefferten Lied, das die Aufmerksamkeit der Gesellschaft auf sich zog, machten sie sich dann beide aus dem Staub. Jeannette hatte sich nicht geziert und ihn mit in ihre Kemenate genommen. De Prades seinerseits bereute es nicht, die Gebote seines Berufsstandes verletzt zu haben, wer hielt sich schon daran. Beim Gedanken an ihre Umarmungen wurde ihm auch jetzt noch heiß und kalt.
Er schob die Bettdecke zurück, steckte die Beine ins Freie. In diesem Augenblick wurde die Tür aufgerissen, und ein Mann, etwa Mitte Dreißig, stürmte ins Zimmer. Hinter ihm tauchte Jeannette auf, frierend in ihren Morgenrock gehüllt. Sie warf de Prades einen Blick zu, als wollte sie sagen: Dieser Kerl ist vollkommen verrückt.
„Yvon, Ihr?” Der Abbé war so erstaunt, dass er mit den Füßen nicht in die Pantoffeln fand, die ihm seine Gastgeberin freundlicherweise zur Verfügung gestellt hatte. „Was zum Teufel kommt Euch in den Kopf, dass Ihr hier eindringt wie der Ungehobeltste aller Barbaren?”
„Er hat sich mit Gewalt Zutritt verschafft, dieser Grobian”, schimpfte Jeannette empört. „Ich wollte ihn nicht hereinlassen, aber er hat den Fuß in die Tür gestellt und mich einfach zur Seite geschoben. Er wisse, dass Ihr hier seid, und er müsse Euch unbedingt sprechen, Monsieur. Was für ein Benehmen!”
„Es musste sein, Madame”, der Abbé Yvon, der zwar den kurzen Umhang des Geistlichen trug, sonst aber mit seinem Perlen- und Pelzbesatz auf der Jacke, mit seinen Stickereien auf den Ärmeln eher einem der vielen Stutzer in der Stadt glich, machte eine entschuldigende Kopfbewegung. „Ihr dürft mir glauben, dass es im Allgemeinen nicht meine Art ist, ein Tête-à-tête so brutal zu stören, aber ich hatte meinen Freund mit Euch weggehen sehen, und so fand ich mich hierher. Die Sache ist sehr wichtig.”