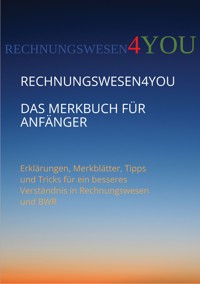
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Fachbuch BWR
- Sprache: Deutsch
Endlich einfach erklärt: Alle Themen aus dem Rechnungswesen oder betriebswirtschaftliches Rechnen (BWR) zur Vorbereitung auf die Mittlere Reife in der Realschule in einem Buch. Diese werden mittels leicht verständlichen Erklärungen, Merkblättern und Hinweisen zu den einzelnen Themen dem Schüler anschaulich nahegebracht. So dass dieser fit wird für die Prüfungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 190
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Rechnungswesen4you
Liebe Schülerin, lieber Schüler,
aus eigener Erfahrung und langer Lehr- und Lerntätigkeit weiß ich, dass dieses Fach eine echte Herausforderung sein kann. Man liebt es oder man hasst es. Es gibt viele, welche die einzelnen Themen teilweise einfach nicht verstehen, weil sie oftmals zu kompliziert erklärt werden. Ich versuche daher, die Themen einfach und direkt in der Sprache der Schüler und Schülerinnen zu erläutern und soweit wie möglich auf Fachbegriffe zu verzichten. Mein Ziel ist es daher, Rechnungswesen so beizubringen, dass es grundsätzlich jeder versteht. Jedoch nicht mit dem Ziel, noch ein schlaues Merkbuch auf den Markt zu bringen, (es gibt schon so einige gute oder weniger gute Bücher zu diesem Thema) sondern um all die vielen, berechtigten und immer wiederkehrenden Fragen der Schülerinnen und Schüler einmal zusammenzufassen und Antworten darauf zu geben. Dabei versuche ich, die Themen und Bereiche deutlich anders (aber eben nicht falsch, auch wenn das vielleicht eine Lehrerin oder ein Lehrer meint) darzustellen. Einfach und direkt zu erklären, so dass es schnell verstanden wird. Und das dies funktioniert, hat sich schon sehr oft bewiesen.
Nachdem auch ich nicht perfekt bin, freue ich mich über eure Nachrichten und konstruktiven Hinweise die zu einer kontinuierlichen Verbesserung dieses Buches führen. Denn eines sollte doch unser aller Ziel sein: Jede und Jeder soll betriebliches Rechnungswesen verstehen und beherrschen und sei es nur eines guten Abschlusses oder der Noten wegen.
In diesem Sinne,
viel Glück und Erfolg beim Lernen wünscht euch
rechnungswesen4you.de
rechnungswesen4you.de
Rechnungswesen4youDas Merkbuch für Anfänger
Erklärungen, Merkblätter, Tipps und Tricks für einfaches Verstehen in Rechnungswesen und BWR für die 8., 9. und 10. Jahrgangsstufe
ISBN Softcover: 978-3-347-58160-9
ISBN Hardcover: 978-3-347-58161-6
ISBN E-Book: 978-3-347-58162-3
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
Haftungshinweis:
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle wird die Haftung für Inhalte externer Seiten und weiterer Inhalte ausgeschlossen.
Bild- und Abbildungsnachweis:
Grafiken: Stand 158. Sitzung: September 2020, Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzung“, BMF
Hinweis bezüglich des AGG: In diesem Buch wird zur einfacheren Anrede die Du Form bzw. die männliche Form und Schreibweise verwendet. Diese ist gleichbedeutend mit der weiblichen Form und soll hier keinerlei Benachteiligung, Differenzierung oder Diskriminierung darstellen. Die Schreibweise gilt daher gleichbedeutend für alle Geschlechter.
Erläuterungen und Tipps zu diesem Übungsbuch
In diesem Bereich befinden sich übersichtlich strukturierte und zusammengefasste Informationen mit allem Wissenswerten zum entsprechenden Thema.
In diesem Bereich sind wichtige Hinweise beschrieben die unbedingt beachten werden sollten.
Vorwort
Dieses außergewöhnliche und praxisnahe Merk- und Übungsbuch dient sowohl zur Unterstützung des Unterrichts wie auch als Lernhilfe zur Wiederholung von versäumtem Unterrichtsstoff. Insbesondere kann dieses Buch verwendet werden für
➢ Schülerinnen und Schülern an Wirtschafts- und Realschulen
➢ Schülerinnen und Schülern der Fachober- und Berufsoberschulen
➢ Schülerinnen und Schülern an Berufs- und Volkhochschulen
Ob Realschüler, Wirtschaftsschüler, Berufsschüler oder Besuch einer weiterführenden Schule wie Berufskolleg, Fachoberschule, Berufsoberschule, … hier finden sich sehr praxisnahe Informationen und Merksätze zum Rechnungswesen welche den Einstieg in das Thema erleichtern. Das Buch eignet sich hervorragend, um sich gezielt auf die Abschlussprüfung der Mittleren Reife vorzubereiten, den Stoff noch einmal gezielt zu wiederholen, offene Fragen zu klären und sich schnell und gezielt in die Thematik einzuarbeiten.
Die Auswahl der Themen und des Stoffs orientieren sich konsequent und direkt am Lehrplan der Schulen für das Fach BWR/Rechnungswesen in Bayern.
Am Ende eines jeden Kapitels werden mögliche Verständigungs- bzw. Theoriefragen genannt. Hierfür sind aktuell keine Lösungen enthalten und vorgesehen. Die Antworten ergeben sich aus dem jeweiligen Kapitel.
Auf themenspezifischen Übungen und Wiederholungsaufgaben wird bewusst verzichtet, da diese in den meisten Bücher ausführlich vorhanden sind.
INHALTSVERZEICHNIS
I.Grundsätze der Buchführung
II.Rechnungswesen einfach erklärt
Die Bilanz - Eröffnung und Abschluss
1. Die Bilanz
2. Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
3. Buchungen in der Bilanz und der GuV
3.1. Eröffnungsbuchungen in der Bilanz
3.2. Eröffnungsbuchungen in der GuV
3.3. Abschlussbuchungen bei der Bilanz
3.4. Abschlussbuchungen bei der GuV
4. Kontenrahmen und Kontenplan
5. Wiederholung und Zusammenfassung
Umsatzsteuer und Vorsteuer
1. Verwendung der Steuern
1.1. Vorsteuer
1.2. Umsatzsteuer
1.3. Verrechnung der Vorsteuer mit der Umsatzsteuer
1.4. Mehrwertsteuer
1.5. Die Zahllast
1.6. Steuerpflichtige und Steuerfreie Umsätze
1.7. Berechnung der Steuer
Einkauf und Beschaffung von Stoffen
1. Begriffe und Definitionen
2. Einkaufskalkulation
3. Buchungen im Einkauf
4. Sofortrabatte beim Einkauf
5. Bezugskosten beim Einkauf
6. Rücksendungen im Einkauf
7. Gutschriften im Einkauf
8. Nachlässe beim Einkauf
8.1. Übersicht der Nachlassarten
8.2. Nachträglich gewährter Nachlass bei Mängeln
8.3. Bonus beim Einkauf
8.4. Skontobuchung beim Einkauf
9. Zusammenfassung aller Buchungen im Einkauf
Verkauf von Erzeugnissen und Handelsware
1. Begriffe und Definitionen
2. Verkaufskalkulation
3. Buchungen im Verkauf
4. Sofortrabatte beim Verkauf
5. Bezugskosten beim Verkauf
6. Rücksendungen im Verkauf
7. Gutschriften im Verkauf
8. Nachlässe beim Verkauf
8.1. Nachträglicher Preisnachlass beim Verkauf
8.2. Bonus beim Verkauf
8.3. Skonto beim Verkauf
8.4. Skontobuchung beim Verkauf
9. Kalkulationshilfen beim Verkauf
9.1. Kalkulationsaufschlag
9.2. Kalkulationsfaktor
9.3. Zusammenfassung Verkauf
Privatbuchungen
1. Begriffe und Definitionen
2. Berechnung und Buchung von Privatbuchungen
2.1. Privatentnahmen
2.2. Privateinlagen
Abschluss von T-Konten
1. Begriffe und Definitionen
2. Vorgehensweise beim Abschluss von T-Konten
3. Buchungssätze bei Abschlussbuchungen
3.1. Abschluss von Konten
3.2. Abschlussbuchung bei Bestandskonten
3.3. Abschlussbuchung bei Erfolgskonten
3.4. Abschlussbuchung bei Unterkonten
3.5. Reihenfolge beim Abschluss von T-Konten
Bestandsveränderungen
1. Lagerbestände und Lagerkosten
2. Minderbestand bei Stoffen und Waren
3. Mehrbestand bei Stoffen und Waren
4. Bestandsveränderungen bei unfertigen und fertigen Erzeugnissen
4.1. Minderbestand bei unfertigen und fertigen Erzeugnissen
4.2. Mehrbestand bei unfertigen und fertigen Erzeugnissen
Unternehmenssteuern
1. Die Steuerarten
2. Aktivierungspflichtige Steuern
3. Betriebliche Steuern
4. Private Steuern
5. Steuern als durchlaufender Posten
Sonstige Aufwendungen und Erträge
1. Begriffe und Definitionen
2. Buchungen bei den Aufwendungen und Erträgen
Finanzierung und Anlagen
1. Begriffe und Definitionen
2. Darlehensarten
2.1. Langfristige Darlehen
2.2. Kurzfristige Darlehen
3. Berechnungen im Kredit- und Zinsbereich
2.1. Berechnung des Zinssatzes
2.2. Berechnungen des relativen Zinssatzes
2.3. Berechnungen des effektiven Zinssatzes
2.4. Berechnung und Buchung bei der Finanzierung und Kapitalanlage
2.5. Buchungen im Kreditbereich
2.6. Buchungen im Zinsbereich
Lieferantenkredit
1. Begriffe und Definitionen
2. Was ist der Lieferantenkredit?
2.1. Aufbau des Lieferantenkredits
2.2. Berechnung des Lieferantenkredits
2.3. Buchung des Lieferantenkredits
Wertpapiere und Aktien
1. Begriffe und Definitionen
2. Berechnungen und Buchungen bei Aktien
2.1. Kauf von Aktien
2.2. Verkauf von Aktien
2.3. Effektive Verzinsung von Aktien
Personalbuchungen
1. Begriffe und Definitionen
2. Zusammenhänge und Erläuterungen
3. Wichtige Hinweise zu Personalbuchungen
4. Erstellung der Personalabrechnung
5. Buchungen im Personalbereich
5.1. Buchung von Lohn-/Gehaltszahlungen
5.2. Weitere Buchungen im Personalbereich
6. Personalzusatzkosten
Kauf von Anlagevermögen
1. Begriffe und Definitionen
2. Arten von Investitionen
3. Berechnung von Anschaffungsnebenkosten
4. Behandlung von Anschaffungskostenminderungen
5. Berechnung und Buchung von Anschaffungskosten
5.1. Berechnung des Anlagevermögens
5.2. Berechnung des Anlagevermögens mit Anschaffungsnebenkosten ..,
5.3. Buchung beim Kauf von Anlagevermögen
5.4. Kauf von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG)
5.5. Erfassung des Instandhaltungsaufwands
Abschreibung von Anlagevermögen
1. Begriffe und Definitionen
2. Berechnung der Abschreibung
3. Buchung der Abschreibung
4. Zeitanteilige Abschreibung
5. Darstellung eines Abschreibungsplans
6. Buchungen zur Abschreibung
6.1. Abschreibung von Sachanlagen
6.2. Abschreibung Sammelposten
6.3. Buchung von Kleingütern
6.4. Abschluss der Aufwandskonten bei der Abschreibung
Verkauf von Anlagevermögen
1. Begriffe und Definitionen
2. Buchung beim Verkauf von Anlagevermögen
2.1. Verkaufsbuchung des Anlagevermögens
2.2. Berechnung des Buchgewinns oder Buchverlusts
2.3. Buchung beim Verkauf mit Buchgewinn
2.4. Buchung beim Verkauf mit Buchverlust
2.5. Buchung beim Verkauf zum Buchwert
2.6. Buchung bei der Inzahlunggabe von Anlagevermögen
Abschreibung auf Forderungen
1. Begriffe und Definitionen
2. Arten von Forderungen
3. Buchungen bei der Abschreibung von Forderungen
3.1. Umbuchung von Forderungen
3.2. Abschreibung von einwandfreien oder zweifelhaften Forderungen …
3.3. Abschreibung von Forderungen mit teilweisem Geldeingang
3.4. Rechenschema zur Berechnung des Forderungsausfalls
3.5. Berechnung der Insolvenzquote
3.6. Zahlungseingang auf eine vollständig abgeschriebene Forderung
Einzelwertberichtigungen von Forderungen
1. Begriffe und Definitionen
2. Einzelwertberichtigung im Überblick
2.1. Bildung einer Einzelwertberichtigung
2.2. Berechnung einer EWB
2.3. Bewertung einer EWB
2.4. Buchung einer EWB
Bewertung vonPauschalen WErtberichtigungen für Forderungen – PWB
1. Begriffe und Definitionen
2. PWB im Überblick
2.1. Bildung einer PWB
2.2. Berechnung einer PWB
2.3. Bewertung einer PWB
2.4. Buchung einer PWB
Factoring und Delkredere
1. Begriffe und Definition
2. Chancen und Risiken beim Factoring
3. Delkredere – Definition und Erläuterung
Periodengerechte Erfolgsermittlung
1. Begriffe und Definitionen
2. Hintergrund der Erfolgsabgrenzung
3. Abgrenzungsbuchung im VORAUS
4. Beispielbuchungen zur periodengerechten Abgrenzung
Rückstellungen
1. Begriffe und Definitionen
2. Buchung von Rückstellungen
2.1. Bildung einer Rückstellung
2.2. Berechnung einer Rückstellung
2.3. Auflösung von Rückstellungen – Rückstellung zu hoch
2.4. Auflösung von Rückstellungen – Rückstellung zu niedrig
2.5. Auflösung von Rückstellungen – Rückstellung war genau richtig
2.6. Vollständige Auflösung einer Rückstellung
Kalkulation von Handelswaren
Berechnung und Beurteilung von Bilanzkennzahlen
1. Begriffe und Definitionen
2. Kennzeichen der Bilanz
2.1. Finanzierung (Eigenkapitalanteil)
2.2. Liquidität (Einzugsliquidität)
2.3. Eigenkapitalrentabilität
2.4. Umsatzrentabilität
III.Kosten- und Leistungsrechnung
Die Arten der Kostenrechnung
1. Begriffe und Definitionen
2. Die Vollkostenrechnung bei Einzelfertigung
3. Die Kostenartenrechnung
4. Die Kostenstellenrechnung
5. Der Betriebsabrechnungsbogen (BAB)
5.1. Hauptaufgaben des Betriebsabrechnungsbogens (BAB)
5.2. Ermittlung der Gemeinkostenzuschlagsätze
5.3. Verwendung der Bestandsveränderungen
6. Die Kostenträgerrechnung
6.1. Die Kostenträgerzeitrechnung – Gesamtkalkulation
6.2. Die Kostenträgerstückrechnung – Stückkalkulation
6.3. Die Kostenkontrollrechnung
Deckungsbeitragsrechnung
1. Begriffe und Definitionen
2. Deckungsbeitragsschema im Ein-Produkt-Unternehmen
3. Deckungsbeitragsschema im Mehr-Produkt-Unternehmen
4. Gewinnschwellenmenge – Break-Even-Point (BEP)
5. Gewinnschwellenumsatz
6. Preisuntergrenze
7. Kritischer Beschäftigungsgrad
8. Zusatzauftrag
9. Kostenfunktion
10. Grafische Darstellung
Der Buchungskreislauf
1. Eröffnungsbuchungen
2. Laufende Buchungen
3. Vorabschlussbuchungen
4. Abschlussbuchungen
10 goldene Regeln fürs Rechnungswesen
Theoriefragen fürs Rechnungswesen
Fachbegriffe und Stichwörter
Formeln und Schemata
1. Berechnung der Prozentwerte bei der Steuer
2. Zinsrechnung
3. Aktien und Wertpapieren
3.1. Kauf von Wertpapieren
3.2. Verkauf von Wertpapieren
3.3. Effektive Verzinsung von Wertpapieren
4. Abschreibung von Anlagegütern
5. Abschreibung auf Forderungen
5.1. Einzelwertberichtigungen EWB
5.2. Pauschalwertberichtigungen PWB
6. Unternehmensanalyse
7. Kalkulationen
7.1. Einkaufskalkulation
7.2. Angebotskalkulation
7.3. Kalkulationsaufschlag
7.4. Kalkulationsfaktor
7.5. Lieferantenkredit
I. GRUNDSÄTZE DER BUCHFÜHRUNG
Die Vorgaben zur Buchführung sind in den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB) gesetzlich festgeschrieben. Sie muss wahrheitsgemäß, klar und stets nachvollziehbar sein. In Unternehmen mit Kostenstellen müssen diese vollständig, übersichtlich und transparent aufgelistet werden. Die Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung umfassen drei Bereiche:
Belegpflicht: Keine Buchung ohne Beleg! Eine Buchung darf nur mit Beleg erfolgen.
Organisationsgrundsätze: Alle Belege sind vollständig, unmittelbar und systematisch in fortlaufender Reihenfolge zu dokumentieren und ordentlich abzulegen.
Buchungsgrundsätze: Die Buchungen müssen klar, nachprüfbar, transparent und vollständig sein. Die beigefügten Belege müssen stets gut lesbar sein.
Aufbewahrungspflicht: Die Rechnungen und alle damit in Verbindung stehenden Belege wie z.B. Lieferscheine unterliegen der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren gem. dem HGB.
Aufgaben der Buchhaltung
Die Hauptaufgabe der Buchhaltung besteht nach § 239 Abs. 2 HGB darin, "alle Geschäftsvorfälle laufend, lückenlos und sachlich geordnet zu erfassen und zu buchen." Die Buchungen bilden die Grundlage für die Bilanzierung und den Jahresabschluss. Der Jahresabschluss ist der rechnerische Abschluss eines Geschäftsjahres und stellt die finanzielle Lage eines Unternehmens dar. Er besteht aus Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung. Die Bilanzkennzahlen ergeben sich aus den aktiven und passiven Bestandskonten, die Gewinn- und Verlustrechnung aus den Aufwands- und Ertragskonten.
Pflicht zur Buchhaltung
Grundsätzlich muss jeder Unternehmer, Kleinunternehmer und Freiberufler eine Gewinnermittlung durchführen. Man unterscheidet hierbei jedoch zwei unterschiedliche Verfahren:
• Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR)
• doppelte Buchführung
Die Einnahmen-Überschussrechnung (EÜR) ist eine einfachere Form der Gewinnermittlung. Sie ist Freiberuflern, Gewerbetreibenden mit geringem Einkommen und landwirtschaftlichen Betrieben vorbehalten. Das Bundesfinanzministerium hat 2005 ein Formular eingeführt, das den Aufbau der Einnahmen-Überschussrechnung definiert. Diese Form der Buchhaltung ist wesentlich einfacher als die doppelte Buchführung.
Die doppelte Buchführung (auch Doppik genannt) teilt sich in die zwei Kontenseiten Soll und Haben. Sie muss von allen besserverdienenden Gewerbetreibenden zur Gewinnermittlung durchgeführt werden. Hier werden alle Geschäftsvorfälle sowie die zugehörigen Belege erfasst und auf verschiedenen Konten verbucht. Die einzelnen Konten sind wiederum unterschiedlichen Büchern untergeordnet. Bei der doppelten Buchführung unterscheidet man das Hauptbuch, das Grundbuch (auch Journal genannt), sowie ein oder mehrere Nebenbücher. Für eine fehlerfreie und ordnungsgemäße Buchführung, muss man sich an die GoB, die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung halten.
Buchhaltung für Freiberufler
Freiberufler sind zwar nicht zu einer doppelten Buchführung verpflichtet, dennoch sollten sie Betriebseinnahmen und -ausgaben transparent auflisten. Die Belege werden gleichermaßen gesammelt und zum Beispiel in einer übersichtlichen Excel-Liste nach Erlös- und Kostenarten sortiert. Einnahmen und Ausgaben werden in der Einnahmen-Überschussrechnung zusammengestellt. Wer es noch einfacher mag, kann eine Buchhaltungssoftware dafür benutzen. Mit einem entsprechenden Programm können die Belege noch problemlos sortiert, gebucht und verwaltet werden.
Buchhaltung für Kleinunternehmer
Ein Kleinunternehmer ist eine selbstständig, gewerblich oder freiberuflich tätige Person, die weniger als 17.500 Euro jährlich verdient. Auch eine Person, die im laufenden Kalenderjahr voraussichtlich weniger als 50.000 Euro verdient und die Grenze von 17.500 Euro im Vorjahr nicht überschreitet, kann als Kleinunternehmer gelten. Kleinunternehmer müssen keine Umsatzsteuer an das Finanzamt zahlen und weisen diese demnach auch nicht auf Ihrer Rechnung aus. Genau wie Freiberufler sind auch Kleinunternehmer nicht zu einer doppelten Buchhaltung verpflichtet. Trotzdem sollten Belege und Rechnungen stets sorgfältig aufbewahrt werden. Sie helfen bei der Erstellung der Einnahmen-Überschussrechnung für das Finanzamt.
Buchhaltung für Gewerbetreibende
Alle Gewerbetreibenden, die eine bestimmte Einkommensgrenze überschreiten sind zur Buchhaltung verpflichtet. Sie müssen eine doppelte Buchführung erstellen. Darüber hinaus sind alle Gesellschaften mit folgenden Rechtsformen ebenfalls zur Buchführung verpflichtet: Kommanditgesellschaften (KG), Offene Handelsgesellschaften (OHG), Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH). Die doppelte Buchführung ist wesentlich komplexer als die Gewinnermittlung mittels Einnahmen-Überschussrechnung. In den meisten Fällen wird sie von einem Steuerberater oder einem Buchhalter erledigt. Hilfreich kann hier auch eine Buchhaltungssoftware sein, die alle Bücher und Konten detailliert auflistet und das Buchen erleichtert. Wer sich nicht sicher ist, ob er buchführungspflichtig ist, sollte beim zuständigen Finanzamt nachfragen oder sich steuerfachlich beraten lassen.
II. RECHNUNGSWESEN EINFACH ERKLÄRT
DIE BILANZ - ERÖFFNUNG UND ABSCHLUSS
1. Die Bilanz
Wie hängt das eigentlich alles zusammen? Was muss man beachten und wie funktioniert das eigentlich mit dem Buchen? Die Bilanz und alles Wichtige dazu – kurz erklärt in 15 Minuten.
Wir gründen eine Firma, ein Unternehmen. Was benötigen wir zu allererst? Richtig, Geld! Davor sollten wir aber noch die „Idee“ haben… Also welche Art von Firma möchten wir gründen. Stell Dir vor, das ganze Geld steckt in einem großen Jutesack, der neben dir im Raum steht. Der Raum ist komplett leer und kahl – ohne Möbel und Ausstattung. Nur du und der Geldsack mit Geld darin.
Das ist dein eigenes Geld, dein Kapital mit dem du das Unternehmen gründest.
Nimm nun ein Blatt Papier und zeichne ein großes T darauf ein. Das T stellt die Bilanz dar, deren beide Seiten stets ausgeglichen sein müssen. Die rechte Seite der Bilanz ist die Kapitalseite und wird als Passivseite bezeichnet. Die linke Seite der Bilanz ist die Vermögensseite und wird als Aktivseite der Bilanz bezeichnet.
Nun schreibe unter die rechte Linie des T's das Wort Kapital und oberhalb das Wort Passiv.
Wenn das eigene Geld nicht mehr ausreicht, muss man sich fremdes Geld beschaffen. Dieses kann man sich leihen oder durch einen Kredit beschaffen. Dieses Geld ist fremdes Geld und wird daher als Fremdkapital bezeichnet. Es kann gemischt mit dem Eigenkapital für den Kauf von Vermögensgegenständen verwendet werden.
Um dein Unternehmen betreiben zu können, benötigst Du Mittel, wie z.B. einen Schreibtisch, einen Computer, Telefon usw. Mit diesem Geld (Kapital) kannst Du dir all die notwendigen Dinge kaufen, die Du für das Unternehmen brauchst.
Du kaufst daher Vermögensgegenstände, die Dein Vermögen darstellen.
Schreibe daher das Wort Vermögen auf die linke Seite (Aktiv-Seite) der Bilanz unter die linke Linie des Ts.
Der Erwerb von verschiedenen Gegenständen mit Geld nennt man Investition. Du investierst also dein Kapital (Geld) in dein Vermögen.
Das Vermögen unterteilen wir in zwei Kategorien:
Als Anlagevermögen werden Gegenstände bezeichnet, die lange im Unternehmen sind (mehr als ein Jahr) und damit dem Geschäftsbetrieb dauerhaft zur Verfügung stehen.
Als Umlaufvermögen werden Gegenstände bezeichnet, die nur kurzzeitig im Unternehmen sind (weniger als ein Jahr) und im Rahmen des Betriebsprozesses zum schnellen Verkauf, Verbrauch, zur Verarbeitung oder zur Rückzahlung bestimmt sind. Wenn dann alles eingetragen ist, sieht die Bilanz wie folgt aus:
Die Bilanz an sich ist grundsätzlich nur eine Bestandsaufnahme dessen, was wir haben (oder auch nicht haben), nämlich unseres Vermögens und unserer Schulden (auch Verbindlichkeiten genannt). Sie zeigt einen Bestand zu einem genau festgelegten Zeitpunkt an.
Eine Bilanz wird einmal im Jahr als Schlussbilanz zum 31.12. erstellt. Trotzdem gibt es zwei Bilanzen – eine Anfangsbilanz, auch Eröffnungsbilanz genannt und eine Schlussbilanz, auch Endbilanz genannt. Die Schlussbilanz des einen Jahres ist gleichzeitig die Eröffnungsbilanz des kommenden Jahres. Das bedeutet, die Schlussbilanz um 31.12. entspricht exakt der Eröffnungsbilanz am 01.01. des Folgejahres. Grund: Es gibt in der Zeit keine Änderungen.
In der Bilanz stehen verschiedene Positionen unseres Vermögens wie z.B. Grundstücke, Fuhrpark, Maschinen oder Verbindlichkeiten wie z.B. Bankkredite oder Verbindlichkeiten an Lieferanten. Diese Positionen nennt man Konten. Die Konten in der Bilanz werden als Bestandskonten bezeichnet. Warum man diese so nennt? Weil sie einen Bestand, einen Wert am Jahresanfang (Anfangsbestand) und am Jahresende (Schlussbestand) ausweisen. An ihnen erkennt man, was ein Unternehmen noch besitzt, welche Werte es noch aufweist, aber auch welche Schulden es hat.
In der Bilanz erkennt man jedoch nicht den Gewinn oder Verlust! Dieser wird in der GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) ermittelt.
2. Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ist eine Gegenüberstellung von dem was wir bezahlen müssen (unseren Aufwendungen) und dem was wir erhalten (unseren Erträgen) innerhalb eines festgelegten Zeitraums. Sie dient zur Ermittlung des Unternehmungsergebnisses, sprich dem Gewinn oder Verlust des Unternehmens und Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses von Kaufleuten (§ 242 III HGB).
Die GuV teilt sich wie die Bilanz in zwei Bereiche bzw. zwei Seiten auf. Die linke Seite wird als SollSeite und die rechte Seite als Haben-Seite bezeichnet. Es werden immer nur die Begriffe Soll und Haben verwendet. Die Bezeichnung „links und rechts“ darf nicht verwendet werden.
Die GuV besteht aus Aufwendungen (Soll-Seite) und Erträgen (Haben-Seite). Die GuV wird am Ende des Jahres über das Konto Eigenkapital 3000 EK abgeschlossen. Dabei wird der Gewinn (steht in der GuV im SOLL) auf die HABEN-Seite im Eigenkapital übernommen. Der Verlust (steht in der GuV im HABEN) wird im Eigenkapital auf der SOLL-Seite eingetragen.
Was versteht man unter Aufwendungen?
Man versteht darunter Ausgaben einer Fima innerhalb eines bestimmten Zeitraums (z.B. eines Jahres) für die verbrauchten Güter, Dienstleistungen und die öffentlichen Abgaben. Diese werden dann in der GuV auf der SOLL-Seite den Erträgen gegenübergestellt.
Was versteht man unter Erträge?
Unter Erträge versteht man alle Einnahmen aus dem Verkauf von Produkten und Dienstleistungen sowie Bestandserhöhungen. Sie sind die Summe der betriebswirtschaftlichen Leistungen eines Unternehmens und werden auf der HABEN-Seite erfasst.
In der GuV werden die Aufwendungen im SOLL den Erträgen im HABEN gegenübergestellt.
Sind die Aufwendungen größer als die Erträge => VerlustSind die Aufwendungen kleiner als die Erträge => Gewinn
Die Konten in der GuV werden auch Erfolgskonten genannt. Warum? Weil mit ihnen der Erfolg, also der Gewinn oder der Verlust des Unternehmens ermittelt und gemessen wird.
Ermittlung des Gewinns der GuV
Ermittlung des Verlusts in der GuV
3. Buchungen in der Bilanz und der GuV
3.1. Eröffnungsbuchungen in der Bilanz
Eröffnung von Aktivkonten
Eröffnung von Passivkonten
3.2. Eröffnungsbuchungen in der GuV
In der GuV gibt es keine Eröffnungsbuchungen. Es wird sofort und direkt auf das jeweilige Aufwands- oder Ertragskonto gebucht ohne das es eine extra Kontoeröffnung gibt.
3.3. Abschlussbuchungen bei der Bilanz
Abschluss von Aktivkonten
Abschluss von Passivkonten
3.4. Abschlussbuchungen bei der GuV
Abschluss von Aufwandskonten
Abschluss von Ertragskonten
4. Kontenrahmen und Kontenplan
Der Kontenrahmen listet alle für die Buchführung relevanten Konten für einen Wirtschaftszweig auf. So gibt es zum Beispiel einen Standardkontenrahmen für die Land- und Forstwirtschaft, einen Einzelhandelskontenrahmen, einen Standardkontenrahmen für Zahnärzte und so weiter. Die Kontenrahmen dienen für den Unternehmer als Richtlinie für die Erstellung eines konkreten, individuellen Kontenplans. Die hier erstellten Aufgaben und Übungen sind ausschließlich auf den IKR (Industriekontenrahmen für Wirtschafts- und Realschulen) abgestimmt.
Der Kontenplan ist das Verzeichnis aller Konten die ein Unternehmen bei der doppelten Buchführung verwendet. Er orientiert sich meist an einem Standardkontenrahmen, ist aber individuell auf die Besonderheiten des betreffenden Unternehmens zugeschnitten.
5. Wiederholung und Zusammenfassung
In der Buchführung unterscheidet man grundsätzlich nach Bestandskonten und Erfolgskonten. Die Bestandskonten werden in der Bilanz verbucht und über die Bilanz (SBK) abgeschlossen. Die Bestandskonten sind die Aktivkonten (Konten mit Vermögenswerten), Kontenklassen 0,1,2 und die Passivkonten (Konten mit dem Eigenkapital und unseren Schulden), Kontenklassen 3,4.
⇨ Bei den Aktivkonten steht der Anfangsbestand immer im SOLL. Der Schlussbestand steht immer im HABEN.
⇨ Bei den Passivkonten steht der Anfangsbestand immer im HABEN. Der Schlussbestand steht immer im SOLL.
Die Erfolgskonten werden über die GuV verbucht und abgeschlossen. Hier gibt es die Aufwandskonten, Kontenklassen 6 und 7 und die Ertragskonten, Kontenklasse 5.
In der GuV gibt es keine Eröffnungsbuchungen sondern nur Abschlussbuchungen.
⇨ Beim Abschluss stehen die Aufwandskonten in der GuV immer im SOLL.
⇨ Aufwandkonten vermindern das Eigenkapital (es wird kleiner).
⇨ Beim Abschluss stehen die Ertragskonten in der GuV immer im HABEN.
⇨ Ertragskonten erhöhen das Eigenkapital (es wird größer).
Darüber hinaus gibt es noch Konten, die weder in die GuV noch in die Bilanz kommen. Diese werden Unterkonten genannt und stets über das dazugehörige Hauptkonto (Mutterkonto) abgeschlossen. Die Unterkonten kommen NICHT in die Bilanz und auch nicht in die GUV.
Beispiele für Unterkonten:
3001, 5001, 6001, 6002, 6011, 6012, 6021, 6022, 6031, 6031, 6081, 6082
Besonderheiten beim Abschluss:
Das Konto 2600 VORST wird stets über das Konto 4800 UST abgeschlossen. Die dazugehörige Buchung lautet meist:
UMSATZSTEUER UND VORSTEUER
1. Verwendung der Steuern
Es gibt die Vorsteuer, Umsatzsteuer und die Mehrwertsteuer. Drei verschiedene Steuern, oder?
Nein! Es ist ein und dieselbe Steuer die nur unterschiedlich bezeichnet wird. Je nachdem wer bezahlt und wann bezahlt wird, hat die Steuer eine andere Bezeichnung.
Dabei wird unterschieden zwischen Unternehmen und Privatleuten. Die Umsatzsteuer und Vorsteuer betrifft nur die Unternehmen, die Mehrwertsteuer betrifft die Privatleute, also alle Menschen wie du und ich. Die Unternehmen bezahlen diese Steuer gar nicht. Sie läuft bei ihnen nur durch und wird daher als „durchlaufender Posten“ bezeichnet. Wie das funktioniert?
1.1. Vorsteuer
Die Vorsteuer fällt jeweils beim Kauf von Erzeugnissen oder Waren für den Käufer an. Am nachfolgenden Beispiel wird die Thematik dargestellt:
Wir als Unternehmen kaufen etwas. Der Verkäufer berechnet uns (aus seiner Sicht) Umsatzsteuer. Wir als Unternehmen bezahlen aus unserer Sicht aber die Vorsteuer. Das heißt, die Umsatzsteuer, die uns der Verkäufer berechnet, ist in unseren Augen die Vorsteuer. Wir bezeichnen diese Steuer beim Kauf dann einfach anders.
Die von uns bezahlte Vorsteuer bekommen wir vom Finanzamt wieder zurückerstattet.
Danach verkaufen wir die Ware wieder an jemanden anders. Jetzt sind wir der Verkäufer und berechnen unserem Kunden Umsatzsteuer. Wir erhalten die Umsatzsteuer vom Kunden. Diese dürfen wir aber nicht behalten, sondern müssen sie wieder an das Finanzamt abgeben. Damit wir nicht dauernd zum Finanzamt hin- und zurücklaufen, wird die zu zahlende Steuer (Umsatzsteuer) mit der an uns zu erstattenden Steuer (Vorsteuer) verrechnet.





























