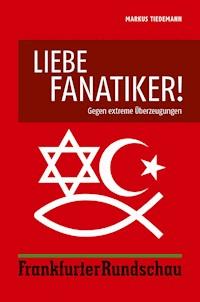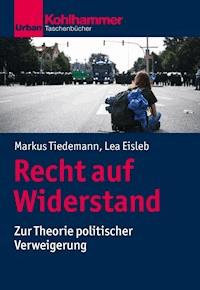
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Politische Akteure von rechts und links berufen sich häufig auf das Recht auf Widerstand. Allerdings ist dies keinesfalls selbstverständlich. Dagegen spricht etwa die Rechtstreue, ohne die ein Zusammenleben unmöglich erscheint. Ist es nicht paradox, ein Recht auf die Entbindung vom Recht zu fordern? Existiert eine rote Linie, bei deren Überschreitung legale Vorschriften die Legitimität verlieren? Das Buch thematisiert zentrale Aspekte des philosophischen Diskurses von Widerstand und führt dabei kategoriale Unterscheidungen, historische Entwicklungen und aktuelle Beispiele zusammen. Das Buch setzt sich zum Ziel, den Blick dafür zu schärfen, wann Rechtstreue als geboten ist bzw. Widerstand als legitim angesehen werden sollte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 224
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor und die Autorin
Markus Tiedemann ist seit 2015 Professor für Didaktik der Philosophie und für Ethik an der Technischen Universität Dresden. Zuvor war er Professor an der Gutenberg Universität in Mainz (2009–2010) und der Freien Universität Berlin (2010–2015). Zu seinen Arbeits- und Interessensschwerpunkten zählen Philosophiedidaktik, ethische Orientierung in der Moderne, ethische Fragen der Migration, Philosophieren mit Kindern, empirische Bildungsforschung und Extremismus. Tiedemann ist Vorsitzender des »Forums für Didaktik der Philosophie und Ethik« innerhalb der Deutschen Gesellschaft für Philosophie. Er ist Mitherausgeber der »Zeitschrift für Didaktik der Philosophie und Ethik« und Herausgeber der Jahrbücher für Didaktik der Philosophie und Ethik.
Lea Eisleb hat Philosophie an der Technischen Universität Dresden studiert und absolviert derzeit ein Lehramtsstudium an der Humboldt-Universität zu Berlin.
Markus Tiedemann/Lea Eisleb
Recht auf Widerstand
Zur Theorie politischer Verweigerung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Titelbild: picture alliance/ZUMA Press, Fotograf: Jannis Grosse
1. Auflage 2018
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-034355-9
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-034356-6
epub: ISBN 978-3-17-034357-3
mobi: ISBN 978-3-17-034358-0
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
1 Widerstand als Problem
2 Phänomene, Begriffe und Unterscheidungen
2.1 Der weite und der enge Widerstandsbegriff
2.2 Phänomene: Verbrechen, Terrorismus, Krieg, Protest und ziviler Ungehorsam
2.3 Legalität, Legitimität und bescheidener Universalismus
2.4 Autorität und Gehorsam
3 Das politische Paradigma der Neuzeit
4 Grundpositionen der Rechtsphilosophie
4.1 Das a priori des Rechts und das Primat der Moral. Kants Rechtslehre und ihre Interpretationen
4.2 Rechtspositivismus und unerträgliches Unrecht. Die Radbruchformel und ihre Interpretationen
5 Auf der Suche nach der roten Linie
5.1 Politische Staatsautorität
5.2 Menschenrechte
5.3 Recht und Pflicht zur Rechtfertigung. Die Toleranzkonzeption von Rainer Forst
6 Weiterführende Fragen
6.1 Pflicht zum Widerstand
6.2 Ziel und Methode
7 Konsequenzen: Die Beurteilung unterschiedlicher Widerstandsphänomene
7.1 Kampf gegen den Nationalsozialismus (Motive und Methode)
7.2 Pegida, AfD, der Women’s March on Washington und die G 20-Proteste
7.3 Moralische Entscheidungen in Einzelschicksalen
7.4 Islamischer Staat und Nationalsozialistischer Untergrund
7.5 Beispiel Türkei
8 Literaturverzeichnis
8.1 Literatur
8.2 Gesetzestexte
8.3 Internetquellen
Einleitung
Der aktuelle Sprachgebrauch und das politische Leben sind durch eine inflationäre und kontroverse Verwendung des Begriffes »Widerstand« geprägt. Einzige Gemeinsamkeit der bezeichneten Kontexte ist eine wie auch immer geartete Relativierung der Rechtstreue. Dabei werden sehr unterschiedliche Phänomene als Widerstand bezeichnet, verurteilt oder heroisiert. Historisch lassen sich zahlreiche Beispiele benennen, die positive Assoziationen wecken. Hierzu gehören die gewaltlosen Widerstandsformen eines Mahatma Gandhi oder eines Martin Luther King ebenso wie der bewaffnete Kampf der polnischen Armia Krajowa oder der französischen Résistance während des Zweiten Weltkrieges. Allerdings ist die moralische Bewertung nicht in jedem Fall so eindeutig. Auch rechtsextreme Untergrundorganisationen wie der NSU oder islamistische Terroristen verstehen sich als Widerstandskämpfer. Hinzu kommen irritierende Selbstzuschreibungen, verwirrende Mischformen und dramatische Einzelfallentscheidungen. Teile der AfD und der Pegida-Bewegung stellen sich in die Tradition der Männer und Frauen des 20. Juli. US-Amerikanerinnen rufen zu resistance und einem Women’s March on Washington auf. Während des G 20 Gipfels im Juli 2017 in Hamburg demonstrierten Tausende friedlich und kreativ gegen das herrschende Weltwirtschaftssystem. Gleichzeitig glaubten Hunderte ihren Widerstand in Form schwerer Straftaten zum Ausdruck bringen zu müssen. Auch die Entscheidungen von tragischen Einzelpersonen wie die des Whistleblowers Edward Snowden oder des Polizeipräsidenten Wolfgang Daschner haben die Frage nach den Grenzen der Rechtsreue aufgeworfen. Selbiges gilt für den dramatischen Abbau von Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit in Ländern wie Türkei, Polen oder Ungarn. Im Sommer 2017 demonstrierten zehntausende Polen gegen eine Reform der Regierung, welche die Unabhängigkeit der Justiz einschränken sollte. Bei einer dieser Demonstrationen rief Lech Wałęsa, der Anführer der Solidarność-Bewegung von 1989, seine Landsleute zum Widerstand auf. Die Europäische Union steht vor der Herausforderung, auf die Verstöße gegen ihren Grundwertekanon zu reagieren. Ähnlich verhält es sich in der Beziehung zur Türkei. Der dortige Verlust an Rechtsstaatlichkeit wurde durch den gewaltsamen Putschversuch des Jahres 2016 beschleunigt. Die Mehrheit der europäischen Länder verurteilte den Umsturzversuch, gewährt aber Menschen aus der Türkei Asyl, weil deren Protest gegen oder Furcht vor dem Regime in Ankara als begründet angesehen werden.
Die Frage nach Möglichkeiten und Grenzen legitimen Widerstandes berührt also sowohl das Verhältnis von Individuum und Staat als auch internationale Beziehungen. Trotz seiner Bedeutung fällt es schwer das Phänomen des Widerstandes erschöpfend zu erfassen. Ursächlich sind die Komplexität der Erscheinungen, die unterschiedlichen systematischen und historischen Zuordnungen und die Dynamik des gesellschaftlichen und politischen Wandels. Bereits Foucault wies darauf hin, dass es den singulären Widerstand gar nicht gäbe. Vielmehr existierten
»einzelne Widerstände: mögliche, notwendige, unwahrscheinliche, spontane, wilde, einsame, abgestimmte, kriecherische, gewalttätige, unversöhnliche, kompromissbereite, interessierte oder opferbereite Widerstände« (Foucault 1987: 114).
Während sich nach Klaus Roth die »gesamte Weltgeschichte« als »permanenten Widerstandskampf« verstehen lässt (vgl. Roth 2006: 7), betont Costas Douzinas, Philosophie »cannot respond to the political and social upheaval because the epoch of resistance is still too new for theory to catch up« (vgl. Douzinas 2017: 28).
Aus diesen Gründen schließt sich diese Abhandlung der Einschätzung von Howard Caygill an, wonach jede philosophische Betrachtung des Widerstandes selbst der Versuchung widerstehen muss, »off reducing the practices of resistance to a singel concept« (Caygill 2013: 6). Es geht also nicht darum, dem Phänomen des Widerstandes in Gänze historisch oder systematisch gerecht zu werden. Vielmehr sollen Definitionen und Unterscheidungen zur Diskussion gestellt werden, um auf diese Weise begründete und kategoriengeleitete Debatten zu ermöglichen. Nach einer allgemeinen Problematisierung wird zwischen einer weiten und einer engen Verwendung des Widerstandsbegriffes differenziert. Vorgeschlagen wird eine Arbeitsdefinition. Demnach bezeichnet der enge Widerstandsbegriff »bewusste, illegale Handlungen oder Unterlassungen von Untertanen, mit dem Ziel der Veränderung oder Zerstörung der positiven Rechtsordnung ohne Akzeptanz von Strafe«. Der weite Widerstandsbegriff hingegen umfasst zahlreiche Phänomene wie Verbrechen, Terror, Krieg, Protest oder zivilem Ungehorsam für die ebenfalls kategoriale Unterscheidungen angeboten werden.
Anschließend wird zwischen Legalität (erlaubt nach positivem Recht) und Legitimität (rechtlich und moralisch anerkannte Verfahren) sowie einem deskriptiven (beschreibenden) und einem normativen (wertebasierten) Verständnis von Legitimität unterschieden. Als Kriterium für normative Legitimität dient hierbei ein selbstkritischer, vierstufiger Universalismus.
Die ethische und rechtsphilosophische Argumentation bezieht sich auf das Paradigma der Moderne, weshalb diesem ein eigenes Kapitel gewidmet wird. Das Spektrum rechtsphilosophischer Positionen reicht von einem prinzipiellen Widerstandsverbot bis hin zu einem durch die Verfassung geschützten Widerstandsrecht. Ein Spannungsfeld, das sich unter Rückgriff auf die Theorien und kontroversen Interpretationen von Immanuel Kant und Gustav Radbruch verdeutlichen lässt.
Eine zentrale Herausforderung besteht darin, eine rote Line zu definieren, bei deren Überschreitung das Widerstandsrecht ein Primat gegenüber der Rechtssicherheit erhält. Weder Kant noch Radbruch haben hierfür eine eindeutige Definition vorgelegt, weshalb um ihre Auslegung eine intensive Kontroverse entbrannt ist. Die vorliegende Abhandlung diskutiert verschiedene Optionen, um diese Lücke zu schließen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf einem Begriff politischer Autorität, dem Status der Menschenrechte als universelle Norm und der Toleranzkonzeption von Rainer Forst. Forst benennt als entscheidendes Kriterium das Recht auf und die Pflicht zur reziproken (wechselseitigen) allgemeinen Rechtfertigung.
Im letzten Teil kehrt die Abhandlung zu den anfänglich genannten Beispielen zurück. Hierbei soll verdeutlicht werden, wie unterschiedliche theoretische Konzeptionen als Beurteilungsgrundlage für konkrete Widerstandsphänomene genutzt werden können.
1 Widerstand als Problem
»Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht«.
Dieses viel verwendete Zitat1 verdeutlicht die Problematik des Widerstandsrechts zwischen den Polen der Rechtssicherheit und der Gerechtigkeit. In rechtsstaatlich organisierten Gesellschaften stellt der Wert der Rechtssicherheit, als Garantie der Verbindlichkeit von Gesetzen, die Basis für die Relevanz einer Verfassung dar. Anders als in rechtlosen Zuständen sind die Individuen durch die Errungenschaft eines Rechtssystems vor Willkür und Selbstjustiz geschützt und besitzen eine verlässliche Instanz, die angerufen werden kann, falls sie sich in ihren Rechten verletzt sehen. Die Verbindlichkeit des Rechts garantiert jedoch noch keinen gerechten Zustand. Selbst wenn ein rechtsfreier Raum als schlechteste aller Optionen angesehen wird, ist nicht jedes positive Recht von vorneherein wünschenswert. Gerechtigkeit, verstanden als Prinzip der Verteilung von Gütern, Rechten und Pflichten, misst sich an der Akzeptanz der Betroffenen (Knoll, 2013: 125). Dabei geht es um eine generelle Zustimmung zu den Grundsätzen der Verteilung, nicht um eine individuelle Zufriedenheit mit jedem Einzelfall. Ursache hierfür sind die höchst unterschiedlichen Auffassungen partikularer Gerechtigkeit, ebenso wie die individuell und kulturell geprägten Konzeptionen des »guten Lebens«. Während einige die aktuelle Höhe des Spitzensteuersatzes als gerecht ansehen, halten andere diesen für zu niedrig angesetzt, so dass eine gerechte Umverteilung der Einkommen nicht konsequent durchgeführt werden könne. Diese kleineren Abweichungen bestehender Gesetze von der persönlichen Gerechtigkeitsvorstellung reichen in der Regel nicht aus, um das ganze Rechtssystem für illegitim zu erklären und aktiven Widerstand außerhalb des positiven Rechts zu leisten. Stattdessen müssen in einem gesamtgesellschaftlichen System kleine Abweichungen und verschiedene partikulare Gerechtigkeitsvorstellungen akzeptiert werden, um die Gesamtheit eines funktionierenden Rechtssystems erhalten zu können. Ein Minimal-Konsens zur Verfahrensgerechtigkeit ist dabei unverzichtbar. Die Bürger können unterschiedliche inhaltliche Gerechtigkeitsideale präferieren, müssen sich allerdings einem gemeinschaftlich akzeptierten Verfahren unterwerfen, um Rechtssicherheit zu erlangen. Andernfalls würde eine Rechtsnorm, ein Gesetz, ein Richterspruch keine verlässliche Instanz darstellen, sondern nur dann Anerkennung finden, wenn er den jeweiligen Wünschen des Individuums entspräche.
Was aber, wenn staatliche Rechtsinhalte und Rechtsverfahren in einen kontradiktorischen Widerspruch zu persönlichen Moralvorstellungen und Gerechtigkeitsprinzipien geraten? Die jüngere deutsche Geschichte hat dieses Dilemma dramatisch verdeutlicht. Rassistische Diskriminierung, Diktatur und Völkermord standen im krassen Gegensatz zur vorangegangenen Rechtsordnung der Weimarer Republik, zum Völkerrecht, zu moralischen Traditionen und zu allen ethischen Konzeptionen universeller Sittlichkeit. Offenkundiges Unrecht war zu herrschendem Recht erklärt worden.
Die Existenz eines Widerstandsrechts scheint in derart gravierenden Situationen selbstevident zu sein. Ohne diese Ultima Ratio wäre einer Willkürherrschaft eines Unrechtsstaates nichts entgegenzusetzen. Die bloße Tatsache Bürger eines Staates zu sein, wäre keine politische Errungenschaft, sondern normativ wertlos, da eine Orientierung des real existierenden Souveräns an moralischen Prinzipien, z. B. der Gerechtigkeit, gänzlich unverbindlich bliebe. Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, eine »Rote Linie« zu definieren, bei deren Übertretung die Gehorsamspflicht der Untertanen endet und Widerstand gegen das staatliche Gewaltmonopol legitimiert ist. Hierbei geraten Vorstellungen des Rechtspositivismus und des Naturrechts aneinander. Es liegt auf der Hand, »dass die Rechtmäßigkeit einer Widerstandshandlung nicht von jenem System überprüft werden kann, gegen das die Handlung gerichtet ist« (Nescher 2013: 15). Widerstand gegen eine Rechtsordnung ist per Definition unrechtmäßig und kann nur durch über-positive Natur- oder Vernunftrechte legitimiert werden.
Gleichwohl ist eine genaue Bestimmung des Widerstands unerlässlich, da sonst die Willkür des Staates nur durch die Willkür der Untertanen ersetzt werden würde, was Recht und Verfassung jede Grundlage entzieht.
Zwei Versuche minimale Kategorien festzulegen, wann Widerstand legitim wäre, um die Bürger einer Gesellschaft vor der Entstehung von Unrechtsstaaten zu schützen, finden sich in der deutschen und der US-amerikanischen Verfassung. In Artikel 20 (4) der deutschen Verfassung heißt es: »Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.« Im Gegensatz zu den Notstandsgesetzen, die den Staat in Krisensituationen stärken sollen, ermächtigt dieser Artikel ausdrücklich die Bürger. Mit dem Ziel, Angriffe auf die Verfassung und die Grundrechte abzuwehren, darf demnach die Bürgerpflicht zum Rechtsgehorsam unterbrochen werden. Als historisches Beispiel dürften die Mütter und Väter des Grundgesetzes die Machtergreifung der Nationalsozialisten vor Augen gehabt haben. Gleichwohl wird betont, dass Widerstand nur in einem absoluten Ausnahmefall gerechtfertigt ist, wenn alle friedlichen und zivilen Mittel des Protestes versagt haben (vgl. Schmid 2013). Auch im amerikanischen Recht ist ein solcher Artikel zum legitimen Widerstand der Bürger enthalten. Bereits 1776 wurde in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung festgeschrieben, dass die Verletzung der unveräußerlichen Menschenrechte auf Freiheit, Eigentum und dem Streben nach Glück das Recht begründe, »eine solche Regierung zu beseitigen und sich um neue Bürgen für ihre zukünftige Sicherheit umzutun« (vgl. Amerikanische Unabhängigkeitserklärung).
Dass in Verfassungstexten, die ihre Verbindlichkeit aus der Forderung nach Rechtstreue generieren, Möglichkeiten legitimen Widerstandes definiert werden, verdeutlicht die Ambivalenz des Phänomens. Während Widerstand gegen die Diktatur des Nationalsozialismus im Nachhinein breite gesellschaftliche und politische Zustimmung erfährt und Museen und Stiftungen2 positiv an diese erinnern, sind aktuelle Erscheinungsformen äußerst umstritten. Beispielsweise stellen sich die Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes (Pegida), die Neue Rechte und die rechtspopulistische Partei der Alternative für Deutschland (AfD) in die Tradition bestimmter Widerstandskämpfer, um analog zu vergangenen Widerstandsstrategien die Notwendigkeit eines Aufbegehrens gegen die aktuelle politische Situation in Deutschland zu rechtfertigen. Der BILD-Journalist Nicolaus Fest begründete seinen AfD-Beitritt damit, dass er sich dem »antitotalitären Erbe« (Probst 2016: 2) seines Großvaters Johannes Fest, einem Widerstandskämpfer in der NS-Zeit, verpflichtet fühle. Auch das Stauffenberg-Attentat vom 20. Juli 1944 wird als Analogie zu Forderungen und aktuellen politischen Positionen dieser Gruppen instrumentalisiert. So bewertet etwa die Zeitung Junge Freiheit, die als Sprachrohr der Neuen Rechten bezeichnet werden kann, das Attentat als »Aufstand des Deutschtums gegen Hitler« und als »Widerstand des Nationalen gegen den Totalitarismus von Fortschritt und Technisierung, der sich bis heute unter dem globalen Deckmantel ausbreitet« (ebd.: 3). Die AfD schließt an diese Aussagen der Jungen Freiheit an. Der AfD-Landesvorsitzende Sachsen-Anhalts, André Poggenburg, sieht seine Partei als Vertreter dieses von Staufenberg gezeigten »ehrlichen, wahren Patriotismus« (ebd.: 4). und erklärt:
»Nur mit einer solch patriotischen Einstellung und Vaterlandsliebe ist man willens und in der Lage, Tyrannei, Diktatur und anderen Gefahren wider seinem Land entschlossen entgegen zu treten« (ebd.).
Auch auf Demonstrationen der rechtspopulistischen Organisation Pegida findet entsprechende Widerstandssymbolik Verwendung. So wird beispielsweise die Wirmer-Flagge, die als Alternative zur Reichsflagge entworfen und nach einem gelungenen Attentat gegen Hitler als neue Nationalflagge vorgesehen war, als Sinnbild für das Aufbegehren gegen Unrechtsregime auf zahlreichen Demonstrationen geschwenkt.
Die Neue Rechte bezeichnete die Regierung unter Kanzlerin Angela Merkel mehrmals als »Kanzler-Diktatur« mit »Systemparteien« (ebd.: 5), deren Politik zu einer ausländischen Fremdherrschaft führe (vgl. ebd.: 2). Sie legt einen starken Akzent auf die nationale und geographische Identität der heimischen Kultur, die gegenüber äußeren Einflüssen geschützt werden müsste (vgl. Wichmann 2016:1). Der Vorwurf an den staatliche Souverän lautet, dass die bewahrenswerte deutsche Kultur der Zerstörung durch Multikulturalismus, Immigration, Islam, Globalisierung und moralischen Universalismus preisgegeben wurde. Ein Prozess, der durch die grenzenlose Toleranz der aktuellen Staatsführung sogar noch begünstigt werde (vgl. Wichmann 2016: 3).
Auch wenn sich die Neue Rechte, die AfD und Pegida in der realen Ausgestaltung ihrer Aktionen bisher in den Grenzen des positiven Rechts bewegen, ist ihre Verneinung der staatlichen Herrschaftslegitimation hoch brisant. Am 22. Juli 2011 tötete der Norweger Anders Breivik (seit einer Namensänderung 2017 Fjotolf Hansen) 77 Landsleute. Als Motiv gab er an, einen Kreuzzug gegen den »Kulturmarxismus« sowie den »Massenimport von Moslems« zu führen (vgl. Seierstad 2013: 18). Eine vergleichbare Widerstandsmentalität hat in Deutschland durch den sogenannten Nationalsozialistischen Untergrund (NSU) einen traurigen Höhepunkt erfahren. Tatsächlich berichtet der Berliner Kurier davon, dass Breivik einen Brief mit Solidaritätsbekundungen an Beate Zschäpe geschickt habe (vgl. Berliner Kurier). »Wer nicht bereit ist sich aktiv am Kampf und der Bewegung zu beteiligen, der unterstützt passiv alles was sich gegen unser Volk und unser Land und unsere Bewegung richtet!!!« (Mundlos 1998:161) schrieb Uwe Mundlos 1998. Skurriler Weise ist in dem sichergestellten Bekennervideo der Gruppe auch das Logo der Roten Armee Fraktion, RAF, zu sehen. Die Ideologien beider Bewegungen könnten kaum unterschiedlicher sein. Eines haben sie aber gemeinsam: Persönliche Vorstellungen des Guten wurden über das geltende Recht gestellt und zur Legitimation schwersten Gewalttaten genutzt.
In diesem Punkt besteht auch eine Parallele zum islamistischen Terrorismus. Auf europäischen Boden wurde ein Großteil der religiös motivierten Terroranschläge von Staatsbürgern des jeweiligen Landes begangen. Es handelt sich also sowohl um Angriffe auf eine verhasste Lebensform als auch auf die vorherrschende Rechtsordnung. Gerechtfertigt wird dies mit Werten oder Instanzen, die über dem positiven Recht stehen. Letzteres hätten auch die Geschwister Scholl für sich in Anspruch genommen, obwohl jeder weitere Vergleich absurd erscheint.
Insbesondere dann, wenn gruppendynamische Prozesse zu beobachten sind, wird es immer schwerer zu beurteilen, ob Gewalttäter eine politische Idee verfolgen oder nur ihrem Aggressionstrieb freien Lauf lassen. Als am 8. und 9. Juli 2017 ganze Straßenzüge Hamburgs von selbsternannten »Anti-G 20 Aktivisten« verwüstet wurden, schienen die Aktionen für Außenstehende gänzlich sinnfrei zu sein. Die Gründe dafür, dem faktischen Recht die Geltung abzusprechen, sind oftmals ambivalent, inkohärent, oder sogar kontradiktorisch. Selbiges gilt für die öffentliche Wahrnehmung. Auch Umweltorganisationen wie Greenpeace oder Sea Shepherd verstoßen immer wieder gegen geltendes Recht und machten sich wiederholt der Sachbeschädigung schuldig. Gleichwohl werden ihre Aktionen in öffentlichen Medien deutlich positiver beurteilt.
Auch wesentlich weniger militante Widerstandsformen geben zu denken. In den USA verstand sich der Women’s March on Washington am 21. Januar 2017 als »resistance« gegen die Präsidentschaft von Donald Trump (vgl. Salon 2017, vgl. Cobb 2017). Doch welche Handlungs- und Ausdrucksformen darf der »Widerstand« gegen einen frei gewählten Präsidenten in einem Rechtsstaat annehmen? Längst nicht jede Bürgerin, die zum Widerstand gegen den 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika aufrief, wäre bereit Aktionen gegen vorangegangene Administrationen zu akzeptieren. So sind etwa die Enthüllungen des Whistleblowers Edward Snowden höchst umstritten. In Deutschland löste der Fall des Frankfurter Polizeipräsidenten Wolfgang Daschner und dessen Verstoß gegen das Folterverbot heftige Diskussionen aus. Handelte es sich um heroischen Widerstand, zivilen Ungehorsam oder um ein Verbrechen?
Auch die Beziehungen zwischen Staaten können durch unterschiedliche Auffassungen von Widerstandsformen schwer belastet werden. Ein hochsensibles Beispiel ist die Bewertung von Rechtsstaatlichkeit und Widerstandsrecht in der Türkei. Namenhafte NGOs wie Amnesty International werfen der Türkei unter Staatschef Recep Tayyip Erdoğan massive Verstöße gegen Menschen- und Bürgerrechte vor. So wurden nach dem Putschversuch im Juli 2016 bis Ende 2016 zahlreiche Medienunternehmen und NGOs geschlossen, fast 90 000 Staatsbedienstete (vor allem Lehrer-, Polizei- und Militäroffiziere, Ärzte und Richter) entlassen, und mehr als 40 000 Menschen (darunter viele Journalisten, Aktivisten und Parlamentarier) in Untersuchungshaft genommen. Laut Amnesty International existieren Belege für die Folterungen einiger Inhaftierter (vgl. Amnesty International 2017 (a)). Von den Entlassungen sind auch viele Wissenschaftler betroffen. Amnesty International schreibt im Jahresbericht 2016/17 zur Türkei: »By the end of the year, 490 of the academics were under administrative investigation and 142 had been dismissed« (Amnesty International 2017 (a): 368). Zahlreiche europäische Staaten haben sich bereits entschlossen, Menschen, die aus der Türkei fliehen, Asyl zu gewähren. Dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge zufolge gingen in Deutschland im Jahr 2016 5742 Asylanträge türkischer Bürger ein. Im Jahr 2015, vor dem Putsch, waren es nur 1767 (vgl. Pro Asyl Antragstatistiken 2015/16). In den ersten fünf Monaten des Jahres 2017 haben 2516 türkische Staatsangehörige einen Asylantrag in Deutschland gestellt, das entspracht 2,9 Prozent aller Antragsstellungen in Deutschland (vgl. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge).
Gleichzeitig entsteht juristischer und rechtsphilosophischer Klärungsbedarf: Bezieht sich das Asylrecht nur auf Menschen, die schuldlos Opfer von Willkür und Unterdrückung werden, oder auch auf jene, die tatsächlich aktiven Widerstand geleistet haben? War der Putschversuch vom 15./16. Juli 2016 ein Akt legitimen Widerstands oder ein Verbrechen? Wie ist die Situation nach dem Putschversuch und dem Verfassungsreferendum vom 16. April 2017 zu bewerten? Besteht unter den aktuellen Bedingungen ein Anspruch auf Widerstand und ein Anrecht auf Asyl?
Gerade in globalisierten Zeiten des Zusammenpralls moralischer, religiöser und ethischer Vorstellungen muss die Frage nach einer Balance zwischen Rechtssicherheit auf der einen, und Gerechtigkeit auf der anderen Seite, neu gestellt werden. Die Definition dieser Balance ist Voraussetzung dafür, dass festgelegt werden kann, was als gerechtes Gesetz für alle Bürger verbindlich gelten darf, und gegen welche Forderungen Widerstand legitim ist.
Die Schwierigkeit liegt darin, den Punkt genau zu kennzeichnen, ab dem Herrschaft nicht mehr hinreichend gerechtfertigt ist. Ab welchem Punkt sind Gesetze und Forderungen des staatlichen Souveräns in einem unerträglichen Maße ungerecht? Ab welchem Punkt ist Widerstand gegen das bestehende Staats- und Rechtssystem, zu Lasten der Rechtssicherheit, legitim, um die natürlichen Rechte der Menschen zu schützen?
Es besteht also ein massiver Klärungsbedarf hinsichtlich der Frage, welche Werte über das positive Recht erhoben werden dürfen und welche Kriterien gegeben sein müssen, damit eine Rechtsordnung aktiv missachtet oder gar bekämpft werden darf (vgl. Hoerster 2006: 65–78, ders. 1989 und Habermas 1992).
1 Wird Berthold Brecht zugeschrieben, vgl. beispielsweise Koydl 2014: 2.
2 Beispiele sind die »Gedenkstätte des deutschen Widerstands« in Berlin, und die »Stiftung des 20. Juli 1944«, die seit 1947 die Angehörigen von Widerstandskämpfern unterstützt, vgl. http://www.gdw-berlin.de/home/, 05.04.2017, und http://www.stiftung-20-juli-1944.de/stiftung-20-juli-1944-2/, 05.04.2017.
2 Phänomene, Begriffe und Unterscheidungen
2.1 Der weite und der enge Widerstandsbegriff
Bevor der Streit um die Legitimität des Widerstandes geführt werden kann, ist es erforderlich, den Begriff »Widerstand« genauer zu bestimmen und unterschiedliche Erscheinungsformen voneinander abzugrenzen. Grundsätzlich lassen sich eine weite und eine enge Verwendung des Widerstandsbegriffes unterscheiden. Der weite Widerstandsbegriff umfasst nahezu jede Handlung oder Unterlassung, die einen Mangel an Akzeptanz gegenüber einer Rechtsordnung oder einem Herrschaftsanspruch zum Ausdruck bringt. Christopher Daase definiert Widerstand als »soziales Handeln, das gegen eine als illegitim wahrgenommene Herrschaftsordnung oder Machtausübung gerichtet ist« (Daase 2014: 3). Subjekt, Objekt und Motiv des Widerstandes erfahren in dieser weiten Begriffsverwendung keine genauere Klassifikation. Dagegen fokussiert eine enge Verwendung des Widerstandbegriffes auf ein besonderes, rechtsphilosophisches Problem. Es handelt sich um das Spannungsverhältnis von Rechtssicherheit und Gerechtigkeit, Gesellschaftsvertrag und Naturrecht, positivem Recht und Moral. Widerstand im engen Sinn der Wortverwendung bezeichnet »die bewusste, illegale Handlungen oder Unterlassungen von Untertanen, mit dem Ziel der Veränderung oder Zerstörung der positiven Rechtsordnung ohne Akzeptanz von Strafe« (Daase 2004: 3). Im Folgenden sollen die Subjekte, Objekte und Formen dieses Widerstandsverständnisses genauer bestimmt werden. Auf diese Weise lassen sich die Unterschiede des weiten und engen Widerstandsbegriffs herausarbeiten. Selbiges gilt für verschiedene Phänomene, die von einem Begriffsverständnis inkludiert werden, vom anderen nicht.
Widerstand als bewusstes Handeln
Beginnen wir damit, Widerstand auf bewusstes Handeln festzulegen. Widerstand ist ein bewusster Akt. Unbeabsichtigte Handlungen – und sei ihr Effekt noch so politisch, provokativ oder illegal – sind keine Manifestationen von Widerstand. Wer unwissentlich vorherrschende Kleiderordnungen missachtet oder aus Unkenntnis in einem jüdisch-orthodoxen Kibbuz während des Schabbat seinen Rasen mäht, leistet keinen Widerstand. Widerstandssubjekte sind bewusst handelnde Personen.
Subjekte eines engen Verständnisses von Widerstand sind politische Akteure, während ein weiter Widerstandsbegriff auch all jene umfasst, die einem Anspruch oder einem Einfluss entgegenwirken. Die Auseinandersetzung kann dabei auf den Raum des Privaten beschränkt bleiben und bedarf keiner juristischen oder politischen Dimension. Wer im engen Sinne des Wortes Widerstand betreibt, verfolgt hingegen bewusst ein politisches Ziel, das nicht der herrschenden Rechtsauffassung entspricht. Klassischer Weise handelt es sich dabei um Untertanen. Die Bezeichnung Untertan steht dabei nicht für ein spezielles politisches System, sondern für den generellen Anspruch des Souveräns auf Unterwerfung. Dabei können Untertan und Souverän – wie im Fall der Demokratie – durchaus formal identisch sein. Klassisches Subjekt des engen Widerstandsbegriffes ist also ein politisch handelnder Akteur, der bewusst gegen den Unterwerfungsanspruch eines Souveräns agiert. Da die Bezeichnungen Souverän bzw. Untertan sowohl Fremd- als auch Selbstzuschreibungen sein können, ist diese Beziehung nicht immer eindeutig. Gleichwohl wird hier eine weitere Abgrenzung von einem weiten Widerstandsbegriff deutlich. Neben Personen können auch Kollektive als Widerstandssubjekte auftreten. Staaten gehören zu den größten, uns bekannten Kollektiven und natürlich können sie einander Widerstand leisten. Allerdings sind die entsprechenden Beispiele schwer zu fassen, da als Objekt des Widerstandes nun keine staatliche Rechtsordnung, sondern internationales Recht bzw. bilaterale Beziehungen oder Verträge angesehen werden müssen. Als Frankreich und Deutschland es im Jahre 2003 ablehnten, sich am Einmarsch in den Irak zu beteiligen, ließe sich dies als Akt des Widerstandes gegen einen als illegitim empfundenen Bündnisanspruch der Bush-Administration auslegen. Gleichwohl sind in diesem Beispiel zwar Ansprüche auf Gefolgschaft, nicht aber auf generelle Unterwerfung zu identifizieren. Frankreich und Deutschland sind keine Untertanen der USA. Es kann also nur darum gestritten werden, ob eine Verletzung von Vertrags- bzw. Bündnispflichten vorlag. Ein enger Widerstandbegriff könnte bestenfalls greifen, wenn ein Staat in Konflikt mit einer multinationalen Instanz gerät, der freiwillig Souveränitätsrechte übertragen wurden. Beispielsweise sind Polen, Tschechien und Ungarn Mitglieder der Europäischen Union. Sie haben freiwillig und in voller Kenntnis des Regelsystems eine Mitgliedschaft angestrebt und bereits zahlreiche Vorteile in Anspruch genommen. Gleichzeitig weigern sich diese Staaten aber an der mehrheitlich beschlossenen Verteilung von Flüchtlingen zu partizipieren.
Objekte des Widerstandes
Objekte des politischen Widerstandes sind menschliche Machtstrukturen. Die Alltagssprache hat sogar Formulierungen mit nicht menschlichen Widerstandsobjekten hervorgebracht. Dies ist der Fall, wenn wir davon sprechen, dass jemand oder etwas Widerstand gegen Naturgewalten leistet, etwa, wenn ein Deich der Sturmflut widersteht, oder ein Wanderer dem Sturm trotzt. Allerdings geht bei dieser Begriffsverwendung die Dimension der menschlichen Interaktion verloren. In der Rechtsphilosophie ist es daher sinnvoll, die Objekte des Widerstandes auf menschliche Machtstrukturen zu beschränken. Ein weites Verständnis von Widerstand umfasst dabei jeden als inakzeptabel betrachteten Anspruch bzw. jedes für illegitim empfundene Regelsysteme. Dies gilt für den Vorstand eines Sportvereins ebenso wie für eine berufliche Hierarchie, ein Finanzsystem oder die Erziehungshoheit der Eltern. Es handelt sich um persönliche Ansprüche oder um kollektive Regelsysteme. Demnach kann auch der empörte Austritt aus einem Verein oder einer Kirchengemeinschaft als Widerstand begriffen werden. Selbiges gilt für die Verweigerung gegenüber den Anweisungen eines Arbeitgebers. Auch physische Selbstverteidigung wäre in der weiten Begriffsverwendung eine Art von Widerstand. Der enge Widerstandsbegriff konzentriert sich hingegen auf den Staat und dessen Rechtsorgane. Die zuletzt genannten Beispiele wären demnach kein Widerstand, sondern Verweigerung und Stellvertretergewalt in Übereinstimmung mit dem Staat. Der Austritt aus einer nicht staatlich verordneten Organisation oder die Verweigerung einer beruflichen Anweisung beschreiben Konflikte, welche die staatliche Rechtsordnung an sich nicht in Frage stellen. Vielmehr ist der Staat jenes Medium durch das diese Konflikte rechtmäßig zu klären sind. Solange die entsprechenden Gerichtsurteile akzeptiert werden, besteht keine Konfrontation mit dem Rechtssystem an sich. Akte von Selbstverteidigung machen den Sachverhalt besonders deutlich. Selbstverteidigung ist ein legitimer physischer Akt um »einen direkten, unrechtmäßigen Angriff von der eigenen oder anderen Personen abzuwehren « (StGB: § 32, 2). Selbstverteidigung bedeutet Widerstand gegen einen Aggressor unter Einsatz jener Gewalt, die eigentlich dem Monopol des Staates obliegt. Dennoch besteht kein Konflikt mit der öffentlichen Ordnung. Wie der oben zitierte Paragraph belegt, handelt es sich vielmehr um ein geschütztes Stellvertreterrecht, das solange ausgeübt werden darf, bis die offizielle Staatsgewalt eingetroffen ist.
Dagegen ist das Objekt des engen Widerstandverständnisses immer auch der Staat selbst. Die Brisanz dieser Handlungen und Unterlassungen wird durch einen eigenen Straftatbestand unterstrichen: Widerstand gegen die Staatsgewalt (StGB §§ 110–122).
Formen des Widerstandes
Weiterhin gilt es zwischen den Formen des Widerstandes zu differenzieren. Prägende Adjektive sind aktiv, passiv, gewaltfrei, gewaltsam, militant und zivil. Leider sind diese Bezeichnungen weder trennscharf noch synonym. Aktiver Widerstand mag als direkte selbstverantwortliche Handlung definiert werden, während passiver Widerstand Unterlassungen bezeichnet. Allerdings werfen Handlungs- und Entscheidungstheorie die Frage auf, ob die Entscheidung zur Unterlassung