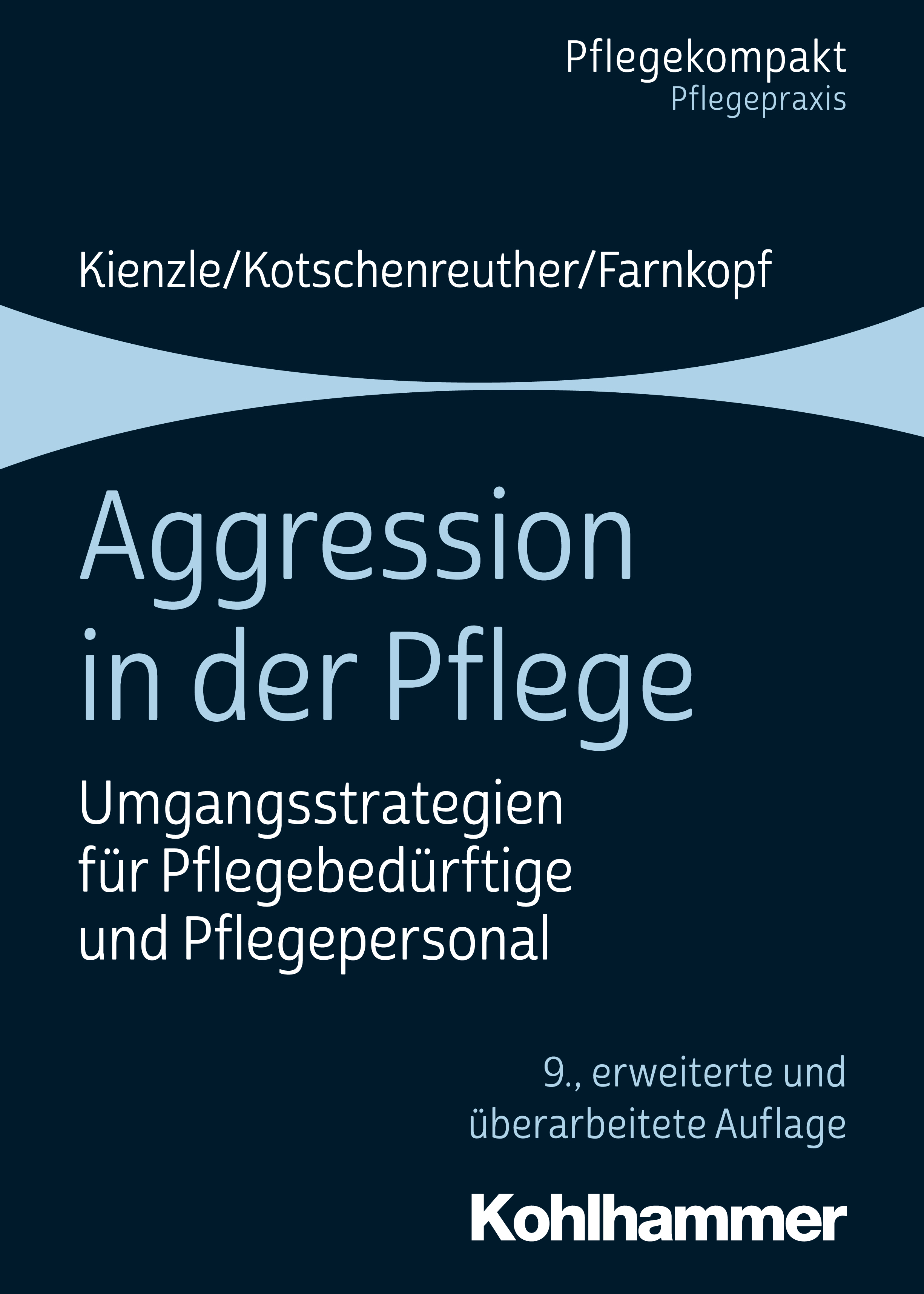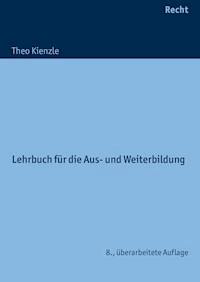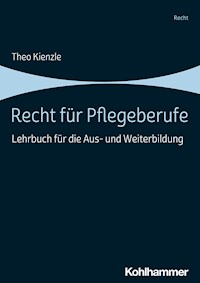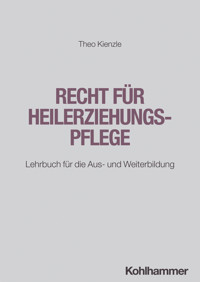
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Kohlhammer Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
HeilerziehungspflegerInnen leisten einen wichtigen Beitrag zur Betreuung von Menschen mit Beeinträchtigungen, unter anderem bei der praktischen Umsetzung der "Eingliederungshilfe". Die Heilerziehungspflege ist ein eigenständiger, von der generalistischen Pflegeausbildung unabhängiger Ausbildungsberuf, daher bedarf es einer eigenständigen Betrachtung und Thematisierung der wichtigsten Rechtsthemen dieses Berufsfeldes. Das Werk liefert einen Überblick über alle Rechtsthemen, die für die Betreuung von Menschen mit Behinderungen und in psychiatrischen Einrichtungen relevant sind. Fallbeispiele veranschaulichen die jeweiligen Rechtsgrundlagen. Besondere Berücksichtigung finden Neuerungen in den Bereichen des Haftungsrechts, des Sozialversicherungsrechts, dort in der Pflegeversicherung, und des Rechts der Teilhabe.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 466
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Autor
Theo Kienzle, Jurist (Spezialgebiete: Sozial-, Medizin-, Betreuungs- und Arbeitsrecht), Dozent an Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen des Gesundheitswesens.
Theo Kienzle
Recht für Heilerziehungspflege
Lehrbuch für die Aus- und Weiterbildung
Verlag W. Kohlhammer
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechts ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen und sonstigen Kennzeichen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese von jedermann frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche gekennzeichnet sind.
Es konnten nicht alle Rechtsinhaber von Abbildungen ermittelt werden. Sollte dem Verlag gegenüber der Nachweis der Rechtsinhaberschaft geführt werden, wird das branchenübliche Honorar nachträglich gezahlt.
Dieses Werk enthält Hinweise/Links zu externen Websites Dritter, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Zum Zeitpunkt der Verlinkung wurden die externen Websites auf mögliche Rechtsverstöße überprüft und dabei keine Rechtsverletzung festgestellt. Ohne konkrete Hinweise auf eine solche Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich unverzüglich entfernt.
1. Auflage 2025
Alle Rechte vorbehalten
© W. Kohlhammer GmbH, Stuttgart
Gesamtherstellung: W. Kohlhammer GmbH, Heßbrühlstr. 69, 70565 Stuttgart
Print:
ISBN 978-3-17-044312-9
E-Book-Formate:
pdf: ISBN 978-3-17-044313-6
epub: ISBN 978-3-17-044314-3
Für den Inhalt abgedruckter oder verlinkter Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. Die W. Kohlhammer GmbH hat keinen Einfluss auf die verknüpften Seiten und übernimmt hierfür keinerlei Haftung.
Vorwort
Mit diesem Fachbuch sollen zwei Ziele verfolgt werden, nämlich sowohl die erforderlichen Inhalte für die Ausbildung zu vermitteln als auch ein Nachschlagewerk für die berufliche Praxis im Bereich der Pflege und Betreuung alter und behinderter Menschen zu erstellen. Die tägliche Arbeit mit behinderten oder alten Menschen ist geprägt von einer Vielzahl von rechtlichen Vorgaben. Die wichtigen rechtlichen Bestimmungen im Bereich der Pflege und Betreuung dieser Personengruppen werden deshalb in diesem Fachbuch dargestellt.
Nur mit der Kenntnis des rechtlichen Hintergrunds und der daraus resultierenden Verantwortung ist es möglich, sich vor den »rechtlichen Gefahren«, die den Mitarbeitenden selbst drohen, zu schützen und gleichzeitig zu wissen, welche Rechte der anvertrauten Menschen es zu schützen gilt und welche Vorgaben gegenüber Arbeitgeber, Behörden etc. zu beachten sind.
Der Verfasser dankt denjenigen, die durch ihre Anregungen dazu beigetragen haben, dass dieses Buch den Anforderungen der Praxis gerecht wird.
Zur Vertiefung sind die Fundstellen, d. h. Urteile in Zeitschriften, Verfasser von Zeitschriftenaufsätzen, in Fußnoten angegeben.
Heidelberg, im Februar 2025
Theo Kienzle
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Abkürzungsverzeichnis
Teil I
Gemeinschaftskunde
1
Prinzipien der deutschen Demokratie
1.1
Demokratie
1.2
Rechtsstaat
1.2.1
Gesetzgebung
1.2.2
Sonstige Staatsorgane
1.2.3
Rechte des Bundes, der Länder, der Städte und Gemeinden
1.3
Sozialstaat
1.4
Politische Einflussnahme
1.5
Grundrechte
2
Öffentliche Verwaltung
Teil II
Rechtsgrundlagen
Teil III
Zivilrecht
3
Zivilrechtliche Handlungsfähigkeit
3.1
Rechtsfähigkeit
3.2
Handlungsfähigkeit
3.2.1
Geschäftsfähigkeit
3.2.2
Deliktsfähigkeit
3.3
Rechtliche Betreuung
3.3.1
Voraussetzungen der Betreuung
3.3.2
Betreuungsverfahren
3.3.3
Umfang der Betreuung
3.3.4
Betreuer
3.3.5
Aufgabenbereiche des Betreuers
3.3.6
Pflichten des Betreuers
3.3.7
Medizinische Maßnahmen
3.3.8
Vorsorgevollmacht – Betreuungsverfügung
3.4
Freiheitsbeschränkungen
3.4.1
Grundlagen
3.4.2
Einwilligung
3.4.3
Notstand
3.4.4
Richterlicher Beschluss
4
Haftung im Zivilrecht
4.1
Übersicht
4.2
Grundlagen der Haftung für Heilerziehungspfleger
4.2.1
Verletzung der Rechtsgüter
4.2.2
Rechtfertigungsgründe
4.2.3
Verschulden
4.2.4
Deliktsfähigkeit
4.2.5
Rechtsfolgen
4.2.6
Verjährung
4.2.7
Haftungsfreistellung der Pflegekräfte
4.2.8
Beweislast
4.2.9
Dokumentation
4.3
Besondere Haftungsbereiche im Bereich der Heilerziehungspflege
4.3.1
Medizinische Maßnahmen
4.3.2
Schutz der Privatsphäre
4.3.3
Aufsichtspflicht
4.3.4
Sexualität behinderter Menschen
4.3.5
Gewalt in der Pflege und Betreuung
5
Vertragsrecht
5.1
Rechtliche Grundlagen
5.2
Vertragsabschluss und Vertragswirkungen
5.3
Leistungsstörungen
5.4
Erlöschen von Forderungen
5.5
Einreden
5.6
Übergang von Forderungen
5.7
Beendigung des Vertrages
5.8
Pflichtverletzungen
5.8.1
Allgemeines
5.8.2
Verletzung vorvertraglicher Pflichten
5.8.3
Gewährleistung
5.9
Vertragsarten
5.9.1
Kaufvertrag
5.9.2
Schenkung
5.9.3
Miete
5.9.4
Dienstvertrag
5.9.5
Heimvertrag
6
Familienrecht
6.1
Sorgerecht
6.2
Unterhalt
6.3
Ehefähigkeit
7
Erbrecht
7.1
Allgemeines
7.2
Gesetzliche Erbfolge
7.2.1
Grundlagen
7.2.2
Erbausschlagung
7.2.3
Erbrecht des Staates
7.2.4
Pflichtteilsanspruch
7.3
Gewillkürte Erbfolge
7.3.1
Testierfähigkeit
7.3.2
Testamentsformen
7.3.3
Widerruf des Testaments
7.3.4
Inhalt des Testaments
7.3.5
Erbvertrag
7.4
Maßnahmen im Todesfall
8
Rechtsweg im Zivilrecht
Teil IV
Strafrecht
9
Straftat
9.1
Tatbestand
9.1.1
Objektiver Tatbestand
9.1.2
Subjektiver Tatbestand
9.2
Rechtswidrigkeit
9.2.1
Notwehr
9.2.2
Notstand
9.2.3
Einwilligung
9.3
Schuld
10
Rechtsfolgen
11
Strafverfahren
12
Jugendstrafrecht
13
Besondere strafrechtliche Probleme
13.1
Sterbehilfe
13.1.1
Aktive Sterbehilfe
13.1.2
Indirekte Sterbehilfe
13.1.3
Passive Sterbehilfe
13.1.4
Behandlungsabbruch
13.1.5
Beihilfe zum Suizid
13.2
Sexuelle Selbstbestimmung behinderter Menschen
13.2.1
Sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen (§ 174 StGB)
13.2.2
Sexueller Missbrauch von Gefangenen, behördlich Verwahrten oder Kranken und Hilfsbedürftigen in Einrichtungen (§ 174 a StGB)
13.2.3
Sexueller Missbrauch von widerstandsunfähigen Personen (§ 179 StGB)
13.2.4
Sexueller Missbrauch von Kindern (§ 176 StGB)
13.2.5
Sexueller Missbrauch von Jugendlichen (§ 182 StGB)
13.2.6
Sexuelle Nötigung bzw. Vergewaltigung (§ 177 StGB)
13.3
Schutz der Privatsphäre
13.3.1
Schweigepflicht
13.3.2
Briefgeheimnis
Teil V
Verwaltungs- und Sozialrecht
14
Einleitung
15
Verwaltungs- und Sozialverfahren
16
Sozialversicherung
16.1
Grundlagen
16.2
Krankenversicherung
16.3
Unfallversicherung
16.4
Rentenversicherung
16.4.1
Rente wegen Alters
16.4.2
Rente wegen Erwerbsminderung
16.4.3
Rente wegen Todes
16.5
Arbeitslosenversicherung
16.6
Sozialversicherung von Menschen mit Behinderung
16.7
Pflegeversicherung
17
Sozialhilfe
17.1
Hilfe zum Lebensunterhalt
17.2
Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung
17.3
Eingliederungshilfe
17.4
Hilfe zur Pflege
17.5
Einsatz des Einkommens und Vermögens
17.6
Sozialhilfeträger
17.7
Kostenersatz
18
Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen
18.1
Grundlagen
18.2
Verfahren
18.3
Leistungen
18.3.1
Allgemeines
18.3.2
Vergünstigungen im öffentlichen Leben
18.4
Teilhabe am Arbeitsleben
18.4.1
Private Arbeitsverhältnisse
18.4.2
Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM)
19
Jugendhilferecht
20
Heimrecht
21
Arzneimittel- und Betäubungsmittelgesetz
21.1
Arzneimittelgesetz
21.2
Betäubungsmittel
Teil VI
Arbeitsrecht
22
Allgemeines
23
Arbeitsvertrag
23.1
Abschluss und Inhalt
23.2
Dauer des Arbeitsverhältnisses
23.3
Arbeitnehmerschutzrechte
23.3.1
Mutterschutzgesetz
23.3.2
Schwerbehindertenrecht
23.3.3
Arbeitszeitrecht
23.3.4
Unfallverhütungsvorschriften
23.3.5
Gewerbeordnung
23.3.6
Arbeitsstättenverordnung
23.3.7
Arbeitsschutzgesetz
23.3.8
Überblick: Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz
23.3.9
Schutz sexuelle Belästigung
23.3.10
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
24
Umfang der Tätigkeit und Direktionsrecht
25
Tarifverträge
26
Betriebliche Mitbestimmung
26.1
Grundlagen
26.2
Rechte der Arbeitnehmervertretungen
26.3
Betriebsvereinbarungen
27
Vergütung und Entgeltfortzahlung
27.1
Grundlagen
27.2
Entgeltfortzahlung
28
Urlaub
29
Beendigung des Arbeitsverhältnisses
29.1
Ordentliche Kündigung
29.2
Außerordentliche Kündigung
29.3
Aufhebungsvertrag
29.4
Befristung
29.5
Kündigungsschutz
29.6
Berufs- oder Erwerbsunfähigkeit
29.7
Arbeits- und Dienstzeugnis
29.8
Verjährungs- und Ausschlussfristen
Teil VII
Anhang
Literatur
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
a. a. O.
am angeführten Ort
AG
Amtsgericht
AMG
Arzneimittelgesetz
AP
Arbeitsrechtliche Praxis, Nachschlagewerk des Bundesarbeitsgerichts
APflege
Zeitschrift: Altenpflege
ArbSchG
Arbeitsschutzgesetz
ArbStättV
Arbeitsstättenverordnung
ArztR
Zeitschrift: Arztrecht
BAG
Bundesarbeitsgericht
BayObLG
Bayerisches oberstes Landesgericht
BayPsychKHG
Bayerisches Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz
BBiG
Berufsbildungsgesetz
BDSG
Bundesdatenschutzgesetz
BPersVG
Bundespersonalvertretungsgesetz
BeschG
Beschäftigtenschutzgesetz
BetrVerfG
Betriebsverfassungsgesetz
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Entscheidungssammlung des Bundesgerichtshofs in Zivilsachen
BKVO
Berufskrankheitenverordnung
BSG
Bundessozialgericht
BSGE
Entscheidungssammlung des Bundessozialgerichts
BSHG
Bundessozialhilfegesetz
BtMG
Betäubungsmittelgesetz
BtMVV
Betäubungsmittel-Verschreibungs-Verordnung
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
BVerfGE
Entscheidungssammlung Bundesverfassungsgericht
BWG
Bundeswahlgesetz
DAVorm
Der Amtsvormund, Rundbrief des Deutschen Instituts für Vormundschaftswesen
DienstV
Dienstvereinbarung
DMW
Zeitschrift: Deutsche Medizinische Wochenschrift
DS
Deutsches Sonntagsblatt
DSGVO
Datenschutzgrundverordnung
Dtsch.
Deutsch(en)
EntgFG
Entgeltfortzahlungsgesetz
EMRK
Europäische Menschenrechtskonvention
Ethik Med
Zeitschrift: Ethik in der Medizin
EzA
Entscheidungssammlung zum Arbeitsrecht
FamFG
Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (Familienverfahrensgesetz)
FEVS
Fürsorgerechtliche Entscheidungen der Verwaltungs- und Sozialgerichte
GewO
Gewerbeordnung
GVG
Gerichtsverfassungsgesetz
HeimMindBauV
Heimmindestbauverordnung
HeimmitwV
Heimmitwirkungsverordnung
HeimPersVO
Heimpersonalverordnung
HinSchG
Hinweisgeberschutzgesetz
JArbSchG
Jugendarbeitsschutzgesetz
JAVollzO
Justizanstaltsvollzugsordnung
LAG
Landesarbeitsgericht
LBerufG
Landesberufsgericht für Ärzte
LG
Landgericht
LJHG-BW
Landesjugendhilfegesetz Baden-Württemberg
LQV
Leistungs- und Qualitätsvereinbarung
LVwVfG BW
Landesverwaltungsverfahrensgesetz Baden-Württemberg
LWV Hessen
Landeswohlfahrtsverband Hessen
MDR
Zeitschrift: Monatsschrift des Rechts
MedR
Zeitschrift: Medizinrecht
MPAMIV
Medizinprodukte-Anwendermelde- und Informationsverordnung
MPDG
Medizinprodukterecht-Durchführungsgesetz
MPBetreibV
Medizinproduktebetreiberverordnung
MuSchG
Mutterschutzgesetz
m. w. N.
mit weiteren Nachweisen
NJW
Zeitschrift: Neue Juristische Wochenschrift
NJW RR
Zeitschrift: Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungsreport
NStZ
Neue Zeitschrift für Strafrecht
NZA
Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
OLG
Oberlandesgericht
PostO
Postordnung
PStG
Personenstandsgesetz
PflBG
Pflegeberufegesetz
PflR
Zeitschrift: Pflegerecht
PflRi
Pflegebedürftigkeitsrichtlinien
PsychKHG BaWü
Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz) in Baden-Württemberg
PsychKHG Hessen
Hessisches Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten
R & P
Zeitschrift: Recht und Psychiatrie
SchwbG
Schwerbehindertengesetz
SchwbWV
Werkstättenmitwirkungsverordnung zum Schwerbehindertengesetz
SGB
Sozialgesetzbuch
SGB I
Sozialgesetzbuch – Erstes Buch – Allgemeiner Teil
SGB III
Sozialgesetzbuch – Drittes Buch – Arbeitsförderung
SGB V
Sozialgesetzbuch – Fünftes Buch – Gesetzliche Krankenversicherung
SGB VI
Sozialgesetzbuch – Sechstes Buch – Gesetzliche Rentenversicherung
SGB VII
Sozialgesetzbuch – Siebtes Buch – Gesetzliche Unfallversicherung
SGB VIII
Sozialgesetzbuch – Achtes Buch – Kinder- und Jugendhilfe
SGB IX
Sozialgesetzbuch – Neuntes Buch – Rehabilitation und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen
SGB X
Sozialgesetzbuch – Zehntes Buch – Sozialverwaltungsverfahren und Sozialdatenschutz
SGB XI
Sozialgesetzbuch – Elftes Buch – Soziale Pflegeversicherung
SGB XII
Sozialgesetzbuch – Zwölftes Buch – Sozialhilfe
SGB XIV
Sozialgesetzbuch – Vierzehntes Buch – Soziale Entschädigung
SozR
Entscheidungssammlung der Richter des Bundessozialgerichts
StGB
Strafgesetzbuch
StPO
Strafprozessordnung
TVöD
Tarifvertrag öffentlicher Dienst
TzBfG
Teilzeit- und Befristungsgesetz
VersR
Zeitschrift: Versicherungsrecht
VO
Verordnung
VwVfG
Verwaltungsverfahrensgesetz
WBVG
Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz
WRV
Weimarer Reichsverfassung
WTPG
Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (BaWü)
WVO
Werkstättenverordnung
ZPO
Zivilprozessordnung
ZuSEG
Gesetz über die Entschädigung von Zeugen und Sachverständigen
Teil I Gemeinschaftskunde
2 Öffentliche Verwaltung
Die öffentliche Verwaltung, d. h. die Ämter und Behörden, ist Teil der Exekutive und an rechtsstaatlicheGrundsätze gebunden. Dies bedeutet, dass sie den betroffenen Bürgern zu dienen, ihre Aufgaben effizient wahrzunehmen und bei ihren Entscheidungen die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu beachten hat, d. h. keine Entscheidungen treffen darf, die den Bürger unangemessen benachteiligen. Sie muss außerdem stets im pflichtgemäßenErmessen entscheiden, was bedeutet, dass bei jeder Entscheidung alle Aspekte gewürdigt werden, auch diejenigen, die zu Gunsten des Bürgers sprechen. Es gilt in diesem Zusammenhang sowohl im allgemeinen Verwaltungsverfahren als auch im Sozialverfahren der Untersuchungsgrundsatz, d. h. die Behörde muss den Sachverhalt umfassend ermitteln. Im Verwaltungsverfahren gilt nach § 24 VwVfG:
(1)Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. […]
(2)Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen.
Im Sozialverfahren ist dazu analog in § 20 SGB X geregelt:
(1)Die Behörde ermittelt den Sachverhalt von Amts wegen. […]
(2)Die Behörde hat alle für den Einzelfall bedeutsamen, auch die für die Beteiligten günstigen Umstände zu berücksichtigen.
Die zuständige Behörde ist darüber hinaus dazu verpflichtet, den Bürger zu beraten und die erforderlichen Auskünfte zu erteilen. Dies regelt im allgemeinen Verwaltungsverfahren § 25 VwVfG:
»Die Behörde soll die Abgabe von Erklärungen, die Stellung von Anträgen oder die Berichtigung von Erklärungen oder Anträgen anregen, wenn diese offensichtlich nur versehentlich oder aus Unkenntnis unterblieben oder unrichtig abgegeben oder gestellt worden sind. Sie erteilt, soweit erforderlich, Auskunft über die den Beteiligten im Verwaltungsverfahren zustehenden Rechte und die ihnen obliegenden Pflichten.«
und im Sozialverfahren § 14 SGB I:
»Jeder hat Anspruch auf Beratung über seine Rechte und Pflichten nach diesem Gesetzbuch. Zuständig für die Beratung sind die Leistungsträger, denen gegenüber die Rechte geltend zu machen oder die Pflichten zu erfüllen sind.«
Bei Verletzung der Beratungspflicht kann der Bürger sogar eine Art von Schadenersatzanspruch, den sozialrechtlichenHerstellungsanspruch geltend machen.
Die weiteren Einzelheiten zum Verwaltungs- und Sozialverfahren werden in Teil V behandelt.
Teil II Rechtsgrundlagen
Die Rechtsordnung regelt das gesamte menschliche Zusammenleben von der Geburt bis zum Tod. Durch verschiedene Rechtsvorschriften soll gewährleistet werden, dass die menschlichen Beziehungen in »geregelten Bahnen« verlaufen. Diese Rechtsvorschriften stellen gewissermaßen die Spielregeln des gesellschaftlichen Miteinanders dar. Es handelt sich dabei um Gesetze, Verordnungen, Satzungen, Gewohnheitssätze und vertragliche Gestaltungen, die zusammen mit den Artikeln des Grundgesetzes, der Verfassung, die Rechtsordnung bilden.
Es werden zwei Rechtsgebiete unterschieden:
das Privatrecht und
das öffentliche Recht.
Die Abgrenzung zwischen den Rechtsgebieten hat in der Praxis Bedeutung
für die Möglichkeit der Inanspruchnahme gerichtlicher Hilfe, d. h. welches Gericht zuständig ist, und
dafür, wie Rechte durchgesetzt werden müssen, dabei auch, welche Rechtssubjekte sich gegenüberstehen.
Zum öffentlichen Recht zählen beispielsweise das Schulrecht, das Polizeirecht, das Gesundheitsrecht sowie das Unterbringungsrecht. Das Strafrecht kann als Sonderbereich des öffentlichen Rechts angesehen werden. Es gilt auch im Verhältnis zwischen Staat und Bürger. Mithilfe von speziellen Rechtsnormen, wie beispielsweise im Strafgesetzbuch, wird sozialschädliches Verhalten bestraft oder durch Bußgelder geahndet. Im öffentlichen Recht gilt grundsätzlich das Über-/Unterordnungsverhältnis. Es gilt im Verhältnis zwischen Staat und Bürger oder zwischen staatlichen Institutionen. Ansprüche aus dem öffentlichen Recht, beispielsweise eine Klage gegen die Ablehnung einer Baugenehmigung für ein Wohnheim oder die nicht bestandene Prüfung zum examinierten Heilerziehungspfleger, sind vor den Verwaltungsgerichten geltend zu machen. Für den Sonderbereich des Sozialrechts inklusive der Sozialhilfe stehen die Sozialgerichte und für den steuerlichen Bereich die Finanzgerichte zur Verfügung.
Im Privatrecht stehen sich gleichgeordnete Personen gegenüber. Einer der wichtigsten Teile des Privatrechts ist das Bürgerliche Recht mit seiner Hauptrechtsquelle, dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). Zum Bereich des Privatrechts zählt aber nicht nur das Bürgerliche Recht, sondern auch beispielsweise das Handelsrecht, das Gesellschaftsrecht und das Arbeitsrecht. Auseinandersetzungen privatrechtlicher Art müssen von den Zivilgerichten als Teil der ordentlichen Gerichtsbarkeit entschieden werden, wobei erste Instanz entweder das Amts- oder Landgericht ist. Eine Klage, z. B. auf Schadenersatz, muss beim Amtsgericht eingereicht werden. Wenn der Streitwert über 5.000,00 Euro liegt, jedoch beim Landgericht. Für arbeitsrechtliche Streitigkeiten ist das Arbeitsgericht zuständig. Der strafrechtliche Anspruch des Staates wird vor den Strafgerichten verhandelt. Die Zuständigkeit der Strafgerichte, wiederum bei den Amts- und Landgerichten als erste Instanz, besteht auch für so genannte Privatklagen wegen Beleidigung oder Hausfriedensbruch.
Zu den Einzelheiten des Aufbaus der Gerichtsbarkeit wird auf Tab. 1.1 bzw. Teil I, Kap. 1.2.2.2 verwiesen.
Alle Bürger haben in der Bundesrepublik Deutschland gemäß Art. 3 GG die gleichen Rechte und Pflichten. Kein Bürger darf ohne sachlichen Grund ungleich zu anderen behandelt bzw. benachteiligt werden. Das Grundgesetz garantiert jedem Bürger angemessenen Rechtsschutz. Zur Durchsetzung rechtlicher Ansprüche stehen dem Bürger die Gerichte zur Verfügung. Für jedes der oben genannten Rechtsgebiete existiert eine spezielle Gerichtsbarkeit.
Teil III Zivilrecht
Das Zivilrecht regelt das Verhältnis zwischen den einzelnen Bürgern bzw. zwischen Bürgern und Vereinigungen. Die wesentlichen Grundlagen sind im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) festgelegt. Dieses ist in folgende Abschnitte gegliedert:
Allgemeiner Teil,
Recht der Schuldverhältnisse,
Sachenrecht,
Familienrecht (inkl. Betreuungsrecht) und
Erbrecht.
Beispielhaft für den Inhalt des BGB sind die Voraussetzungen für den Abschluss von Verträgen bzw. deren Rückabwicklung, die Vertragsarten, die Beziehungen zwischen Eltern und Kind sowie der Ehegatten untereinander, die Rechtswirkungen des Eigentums und die Vermögensübertragung im Falle des Todes zu nennen. Im BGB sind jedoch auch die Voraussetzungen für eine (rechtliche) Betreuung und die »Patientenverfügung« sowie das Haftungsrecht geregelt.
Im Allgemeinen Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs werden Aussagen dazu getroffen, welche Person rechts- und handlungsfähig ist. Im Recht der Schuldverhältnisse ist unter anderem die deliktische Haftung (Teil III, Kap. 4) geregelt. Das Sachenrecht befasst sich mit dem Eigentum an beweglichen Sachen und Grundstücken. Das Familienrecht hat Bedeutung für die Betreuung (Teil III, Kap. 3.3), für die Rechtsfolgen der Ehe und die Unterhaltspflicht (Teil III, 4.2) sowie das Recht der elterlichen Sorge (Teil III, Kap. 6.1). Das Erbrecht, d. h. Fragen der gesetzlichen Erbfolge und Arten von Testamenten, wird in diesem Lehrbuch in Teil III, Kap. 7 abgehandelt.
3 Zivilrechtliche Handlungsfähigkeit
3.1 Rechtsfähigkeit
Durch die Rechtsfähigkeit ist jedes Rechtssubjekt Träger von Rechten und Pflichten. Rechte und Pflichten sind in der Rechtsordnung an ein Rechtssubjekt gebunden. Nur ein Rechtssubjekt kann die von der Rechtsordnung eingeräumten Rechte ausüben. Es werden dabei zwei Gruppen unterschieden:
natürliche Personen
juristische Personen
Natürliche Personen sind alle Menschen. Unter den Begriff juristische Personen fallen insbesondere Vereinigungen von Personen wie Vereine, staatliche Institutionen, Kirchen, Gesellschaften (z. B. GmbH, AG, KG) und Stiftungen, auch die öffentlichen Träger von Heimen, Krankenhäusern etc. sowie die politischen Parteien. Natürliche und juristische Personen sind Träger von Rechten und Pflichten, sie besitzen somit die Rechtsfähigkeit.
Natürliche Personen
Bei natürlichen Personen ist die Rechtsfähigkeit unabhängig vom körperlichen und geistigen Zustand gegeben, d. h. auch ein schwerstbehinderter Mensch ist rechtsfähig und bleibt dies auch, selbst im Zustand der Demenz und anderer schwerer psychischer Erkrankungen. Jede natürliche Person ist dabei besonders Träger von Grundrechten, insbesondere derjenigen auf Menschenwürde und körperliche Unversehrtheit bzw. Leben.
Die Rechtsfähigkeit beginnt beim Menschen gemäß § 1 BGB grundsätzlich mit der Vollendung der Geburt (Abb. 3.1), wobei als Ausnahmen gelten:
Das Leben des ungeborenen Kindes ist von der Verfassung (vgl. Art. 2 Abs. 2 GG; §§ 218 ff. StGB) geschützt. Das Recht auf Leben nach Art. 2 Abs. 2 GG existiert damit bereits vor der Geburt.
Im Rahmen der Unfallversicherung besteht außerdem der Schutz des Embryos bei einem Arbeitsunfall bzw. einer Berufskrankheit (§ 12 SGB VII), d. h. einer Schädigung durch die Arbeitstätigkeit der Mutter.
Der Embryo bzw. Fetus ist zudem bereits erbberechtigt, d. h. er »er erbt mit«, obwohl er noch nicht geboren ist und sein Erbe nicht selbst in Besitz nehmen kann (§ 1923 BGB).
Er hat im Rahmen der unerlaubten Handlung bei der deliktischen Haftung nach §§ 823 ff. BGB Schutz und damit Ansprüche auf Unterhaltszahlungen gemäß § 844 Abs. 2 BGB, sofern der Unterhaltspflichtige, beispielsweise der Vater, getötet wird.
Die Rechtsfähigkeit (Abb. 3.1) endet mit dem Tod, und dabei sind wiederum die Ausnahmen:
Die Leiche ist unter anderem durch § 168 StGB geschützt:
(1)Wer unbefugt aus dem Gewahrsam des Berechtigten den Körper oder Teile des Körpers eines verstorbenen Menschen, eine tote Leibesfrucht, Teile einer solchen oder die Ascheeines verstorbenen Menschen wegnimmt oder wer daran beschimpfenden Unfug verübt, wird mit Freiheitsstrafe […] bestraft.
Die unangemessene Behandlung einer Leiche ist folglich mit Strafe bedroht. Vergleichbares gilt für die Entnahme von Organen. Das Transplantationsgesetz sieht dies nur bei Zustimmung der Berechtigten vor.
Das allgemeine Persönlichkeitsrecht besteht gleichfalls über den Tod hinaus. Auch ein Verstorbener darf nicht verunglimpft werden.
Ebenfalls gilt nach dem Tod noch die Schweigepflicht (§ 203 Abs. 4 StGB), d. h. Auskünfte an Angehörige sind auch nach dem Tod nur in wenigen Ausnahmefällen möglich.
Schließlich kann der Verstorbene in Form eines Testamentes etc. über sein Vermögen dessen Empfänger nach dem Tod bestimmen, übergibt gewissermaßen für die Zeit nach dem Tod sein Vermögen.
Abb. 3.1: Rechtsfähigkeit.
Sofern Rechtsfähigkeit besteht, besitzt die natürliche Person gleichzeitig auch die Parteifähigkeit. Dies bedeutet, dass ein Mensch bereits kurz nach der Geburt selbst in einem Rechtsstreit Kläger oder Beklagter sein kann, wobei jedoch keine Aussage getroffen ist, ob der Betroffene, z. B. ein Kind, selbst oder durch andere Personen seine Rechte geltend macht.
Beispiel
Das zweijährige Kind kann gegenüber seinem Vater Unterhaltsansprüche geltend machen. Der Vater hingegen kann Anfechtungsklage gegen das Kind erheben und dabei behaupten, er sei nicht der leibliche Vater.
Beispiel
Der schwer geistig behinderte B. klagt auf Zahlung von Schmerzensgeld, weil er durch einen Fehler der Hebamme bei der Geburt geschädigt worden ist. Dies kann er trotz der Behinderung, da er wie jeder andere Mensch rechtsfähig ist. Er wird allerdings durch die Eltern gesetzlich vertreten.
Die Rechtsfähigkeit beim Menschen hat daher nicht nur theoretische, sondern auch erhebliche praktische Bedeutung.
Juristische Personen
Der Beginn der Rechtsfähigkeit einer juristischen Person ist an bestimmte Rechtsakte gebunden. So erhält ein Verein seine Rechtsfähigkeit erst mit der Eintragung in das Vereinsregister. Sie endet bei juristischen Personen mit der Auflösung.
Wiederholungsfragen
Welche beiden Personengruppen werden bei der Rechtsfähigkeit unterschieden?
Welche Bedeutung hat die Rechtsfähigkeit?
Was versteht man unter einer »juristischen Person«?
Wann beginnt und endet die Rechtsfähigkeit bei natürlichen Personen und welche Ausnahmen kennen Sie?
Was bedeutet »Parteifähigkeit«?
3.2 Handlungsfähigkeit
Von der Rechtsfähigkeit zu unterscheiden ist die Handlungsfähigkeit eines Menschen. Ob eine Person Träger von Rechten ist, sagt allein nichts darüber aus, ob das Rechtssubjekt, beispielsweise der Mensch, in der Lage ist, diese Rechte selbst auszuüben. Dies ist eine Frage der Handlungsfähigkeit. Die Wahrnehmung von Rechten durch einen selbst setzt Handlungsfähigkeit voraus.
Definition
Handlungsfähigkeit besteht, sobald ein Mensch in der Lage ist, Rechtsgeschäfte selbst abzuschließen, d. h. Handlungen mit rechtlicher Wirkung vorzunehmen und für sein Handeln selbst verantwortlich zu sein, mit der Folge, für verursachte Schäden Ersatz zu leisten.
Die Handlungsfähigkeit gliedert sich in die beiden Bereiche:
Geschäftsfähigkeit und
Deliktsfähigkeit.
Diese werden nachfolgend unter Berücksichtigung der Altersstufen und/oder geistiger Einschränkungen dargestellt (Abb. 3.2).
3.2.1 Geschäftsfähigkeit
Definition
Kann ein Mensch rechtlich verbindliche Handlungen vollziehen, ist die Geschäftsfähigkeit als Teil der Handlungsfähigkeit gegeben.
Abb. 3.2: Handlungsfähigkeit mit den Bereichen Geschäftsfähigkeit und Deliktsfähigkeit.
Die Geschäftsfähigkeit beginnt nicht wie die Rechtsfähigkeit mit dem Augenblick der Geburt, sondern ist an bestimmte Altersstufen und/oder an die geistigen Fähigkeiten gebunden.
Es werden drei Stufen unterschieden:
Geschäftsunfähigkeit (= Geschäftsfähigkeit fehlt ganz)
beschränkte Geschäftsfähigkeit (= der Betroffene kann nur bestimmte Handlungen vornehmen)
volle Geschäftsfähigkeit.
3.2.1.1 Geschäftsunfähigkeit
Kinder unterhalb des siebten Lebensjahres sind geschäftsunfähig, d. h. ihre Rechtsgeschäfte sind nichtig (§§ 104, 105 BGB) und die wechselseitigen Leistungen müssen zurückerstattet werden.
Beispiel
Der sechsjährige K. kauft im Spielwarengeschäft von Geld, welches er zum Geburtstag geschenkt bekommen hat, ein Dart-Spiel. Sobald die Eltern auf das Alter und damit die Geschäftsunfähigkeit hinweisen, muss der Kaufpreis zurückerstattet und auch das Spiel zurückgegeben werden. Der Kaufvertrag ist nichtig.
Bei einer schweren krankhaften Störung der Geistestätigkeit wie
einer psychischen Erkrankung oder
einer geistigen Behinderung
kann gleichfalls Geschäftsunfähigkeit vorliegen. Dabei kommt es auf das Ausmaß der Erkrankung bzw. Behinderung an. Leichtere Formen führen in der Regel nicht zur Geschäftsunfähigkeit. Falls jedoch eine Geschäftsunfähigkeit vorliegt, ist ein gesetzlicher Vertreter, meist ein Betreuer, notwendig. Bei volljährigen geschäftsunfähigen Personen, z. B. Personen mit Betreuungsbedarf bzw. Heimbewohnern oder erheblich psychisch Kranken, besteht allerdings aufgrund der Vorschrift des § 105a BGB die Besonderheit, dass ein sogenanntes Geschäft des täglichen Lebens, das mit geringen Mitteln bewirkt werden kann, wirksam wird, sobald Leistung und Gegenleistung erfüllt sind. Dies gilt nur dann nicht, wenn eine erhebliche Gefahr für die Person oder das Vermögen des Geschäftsunfähigen besteht, beispielsweise in der manischen Phase einer bipolaren affektiven Störung, bei Personen mit Spielsucht oder ähnlichem.
3.2.1.2 Beschränkte Geschäftsfähigkeit
Minderjährige zwischen dem siebten und dem achtzehnten Lebensjahr sind nach § 106 BGB beschränkt geschäftsfähig. Rechtsgeschäftliche Erklärungen dieser Altersgruppe sind schwebend unwirksam. Das Geschäft bzw. der Vertrag wird erst (voll) wirksam, wenn die Zustimmung durch den gesetzlichen Vertreter (Eltern, Vormund) erteilt wird. Es wird allerdings endgültig unwirksam, wenn sie verweigert wird. Gesetzliche Vertreter sind auch zur Vertretung der geschäftsunfähigen Kinder beim Abschluss von Verträgen befugt, wobei manche Verträge vom Familiengericht genehmigt werden müssen.
Das Gesetz sieht in § 110 BGB einen Ausnahmefall von der beschränkten Geschäftsfähigkeit vor: Wird einem Minderjährigen zwischen dem siebten und achtzehnten Lebensjahr oder einem psychisch kranken bzw. geistig behinderten Menschen ein bestimmter Geldbetrag zur freien Verfügung zugeteilt, kann er dieses Geld ohne die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters verbrauchen und damit Geschäfte ausführen. Diese Vorschrift ist auf das Taschengeld und auf den Barbetrag des Sozialhilfeträgers sowie weitere Beträge zur freien Verfügung anzuwenden. Es ist daher auch für den Klient einer Einrichtung nicht erforderlich, die Verwendung des Barbetrages oder Taschengeldes nachzuweisen. Der Klient muss über die Verwendung des Taschengeldes keinerlei Rechenschaft ablegen und muss jederzeit Zugriff auf diese Beträge haben. Diese Vorschrift ist selbst dann anzuwenden, wenn der Klientvom Taschengeld Beträge anspart, um eine größere Anschaffung zu machen. In der Praxis muss bei behinderten Menschen allerdings eine pragmatische Lösung insoweit gefunden werden, dass in Absprache mit dem jeweiligen Klienten eine bestimmte Zweckbestimmung für Teilbeträge (beispielsweise für Freizeiten etc.) gefunden wird. Der Betreuer ist allerdings nicht dazu berechtigt, dem Klientenohne vernünftige Gründe die Verwendung des Taschengeldes für eine Freizeit zu untersagen oder diesen zur Freizeit zu zwingen, da einerseits der Betreute selbst über die Verwendung bestimmen kann und der Betreuer nach § 1821 BGB die Wünsche und das Wohl des behinderten Menschen berücksichtigen muss.
Schließlich kann der Minderjährige frei entscheiden, d. h. muss der gesetzliche Vertreter einem Rechtsgeschäft nicht zustimmen, welches dem Minderjährigen lediglich einen rechtlichen Vorteil bringt (§ 107 BGB). Entscheidend sind dabei allein die rechtlichen Folgen, nicht die wirtschaftlichen. Deshalb sind Schenkungen an den Minderjährigen bzw. an den Klienten mit Betreuung (mit Ausnahme einer Grundstücksschenkung) ohne Zustimmung der Eltern bzw. des Betreuers wirksam.
Bei Minderjährigen steht die Vermögenssorge zusammen mit der Personensorge entweder den Eltern als gesetzlichen Vertretern oder einem Vormund zu. Bei Personen, die zwar volljährig, aber aufgrund einer Erkrankung oder Behinderung nicht geschäftsfähig sind, wird diese Funktion durch den Betreuer erfüllt.
Eine besondere Form der »beschränkten Geschäftsfähigkeit« ist die Sozialmündigkeit nach § 36 Abs. 1 SGB I. Durch diese Vorschrift wird Minderjährigen, die das fünfzehnte Lebensjahr vollendet haben, eine beschränkte Handlungsfähigkeit eingeräumt. Dies bedeutet, dass ab diesem Alter Anträge auf Sozialleistungen gestellt werden und derartige Leistungen entgegengenommen werden können. Die gesetzlichen Vertreter sollen jedoch informiert werden. Die Handlungsfähigkeit geht durch die genannte Vorschrift sogar so weit, dass die Minderjährigen ab dem fünfzehnten Lebensjahr sogar vor dem Sozialgericht prozessfähig sind.
Außerdem liegt in der Regel ab dem 14. Lebensjahr die notwendige Einsichts-bzw.Einwilligungsfähigkeit vor, d. h. der jeweilige Jugendliche kann selbst, unter Umständen mithilfe des Familiengerichts, in medizinische Maßnahmen auch gegen den Willen der Eltern einwilligen oder diese verweigern. Bei medizinischen Maßnahmen können daher die Eltern ab dem 14. Lebensjahr nicht mehr allein »über den Kopf des Kindes hinweg« entscheiden. Davon zu unterscheiden sind allerdings nicht notwendige Eingriffe, wie Piercing, Tätowierung und Schönheitsoperationen.
Bei Betreuungen kann das Betreuungsgericht nach § 1825 BGB einen Einwilligungsvorbehalt anordnen. Dadurch wird der Betreute durch §§ 1825 Abs. 1, Satz 2 BGB i. V. m. § 108 Abs. 1 BGB einem Minderjährigen zwischen dem siebten und dem achtzehnten Lebensjahr gleichgestellt und damit beschränkt geschäftsfähig. Seine Rechtsgeschäfte sind deshalb bis zur Genehmigung durch den Betreuer gleichfalls schwebend unwirksam. Näheres dazu in Teil III, 3.3.3.
3.2.1.3 Volle Geschäftsfähigkeit
Personen, die das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben, sind voll geschäftsfähig, sofern keine psychischen oder geistigen Beeinträchtigungen bestehen. Sofern volle Geschäftsfähigkeit besteht, können voll verantwortlich Rechtsgeschäfte abgeschlossen werden, und die Volljährigen haften selbst im gesamten von der Rechtsordnung vorgesehenen Umfang. Ausnahmen sind nur in Einzelfällen möglich.
Die Geschäftsfähigkeit besteht nur bei natürlichen Personen. Juristische Personen können am Rechtsverkehr nur über ihre gesetzlichen Vertreter, beispielsweise beim Verein über den Vorstand oder bei der Gesellschaft über den Geschäftsführer, teilnehmen.
Vor Gericht entspricht der Geschäftsfähigkeit die Prozessfähigkeit, d. h. die Fähigkeit, wirksam vor Gericht zu handeln. Jeder Mensch kann unabhängig vom Alter und der psychischen Gesundheit klagen und verklagt werden. Da jeder Mensch die Rechtsfähigkeit besitzt, ist jeder parteifähig. Er kann jedoch nicht in jedem Falle die notwendigen Prozesshandlungen selbst vornehmen. Hierzu ist er nur befugt, sofern zusätzlich die Prozessfähigkeit vorliegt. Prozessfähig ist derjenige, der geschäftsfähig ist (§ 51 ZPO).
Beispiel
Das achtjährige Kind kann zwar selbst als Kläger gegenüber seinem Vater auf Zahlung von Unterhalt auftreten, muss sich aber von der Mutter gesetzlich vertreten lassen, da ansonsten die Klage aufgrund seiner Prozessunfähigkeit unzulässig wäre.
Liegt keine oder nur beschränkte Geschäftsfähigkeit vor, muss der Betroffene sich durch seinen gesetzlichen Vertreter wie Eltern oder Vormund, Betreuer, Ergänzungspfleger oder Prozesspfleger vertreten lassen.
Wiederholungsfragen
Welche Stufen der Geschäftsfähigkeit gibt es, welche Altersgrenze gilt?
Wie ist das Rechtsgeschäft eines Geschäftsunfähigen zu beurteilen?
Wann kann ein Minderjähriger selbst Verträge abschließen?
Wer ist gesetzlicher Vertreter bei Kindern, wer bei Betreuten?
3.2.2 Deliktsfähigkeit
Definition
Die Deliktsfähigkeit ist die volle Verantwortlichkeit für die Verursachung eines fremden Schadens.
Sie ist nur bei natürlichen Personen gegeben. Sie ist gleichfalls Teil der Handlungsfähigkeit. Deliktsfähigkeit liegt nur vor, wenn eine Person in der Lage ist zu erkennen, dass sie einen anderen rechtswidrig schädigt. Fehlt diese Einsicht, ist der Schädiger, beispielsweise der psychisch kranke oder geistig behinderte Mensch, nicht verantwortlich, er ist deshalb nicht zum Ersatz des Schadens verpflichtet. Diese Eigenverantwortlichkeit kann jedoch nicht im Umfang und mit derselben Großzügigkeit, d. h. mit weiten Altersgrenzen, geregelt werden wie bei der Geschäftsfähigkeit, denn der Geschädigte hat Anspruch darauf, dass nur in Ausnahmefällen der Schaden nicht ersetzt wird und er ihn selbst zu tragen hat.
Es werden auch bei der Deliktsfähigkeit drei (Alters)Stufen unterschieden:
Deliktsunfähigkeit (= keine Verantwortung für Schädigung Dritter)
beschränkte Deliktsfähigkeit (= Verantwortung im Rahmen der Einsichtsfähigkeit)
volle Deliktsfähigkeit
Im Einzelnen gilt, dass derjenige, der geschäftsfähig ist, in der Regel auch gleichzeitig deliktsfähig ist. Umgekehrt jedoch kann auch der beschränkt Geschäftsfähige unter bestimmten Voraussetzungen deliktsfähig sein. Die beschränkte Geschäftsfähigkeit ist also nicht mit der beschränkten Deliktsfähigkeit gleichzusetzen. Die Deliktsfähigkeit ist der Regelfall, die Deliktsunfähigkeit hingegen die Ausnahme. Dies bedeutet, dass eine Person zwar durch eine Erkrankung geschäftsunfähig sein kann, aber trotzdem die notwendige Einsicht hat, dass sie andere Personen keinen Schaden zufügen darf, somit deliktsfähig ist.
3.2.2.1 Deliktsunfähigkeit
Stets deliktsunfähig sind
Kinder unterhalb des siebten Lebensjahres
Erwachsene,
–die im Zustand der Bewusstlosigkeit oder
–in einem Zustand schwerer krankhafter Störung der Geistestätigkeit
einer natürlichen oder juristischen Person einen Schaden zufügen (§ 827 BGB). Folglich sind durch Krankheit oder Behinderung deliktsunfähig
schwer psychisch kranke Menschen (z. B. akute Psychose)
erheblich seelisch behinderte Menschen (z. B. Alzheimer-Krankheit)
schwer geistig behinderte Menschen
Eine bloße Minderung der Geistes- und Willenskraft sowie krankhafte Gleichgültigkeit ist dafür aber nicht ausreichend. Auch eine bestehende Betreuung allein führt nicht automatisch zur Deliktsunfähigkeit.
Wurde der Schaden im Zustand der Deliktsunfähigkeit verursacht, haftet nicht der Schädiger, sondern derjenige, der ihn zu beaufsichtigen hatte. Es liegt dann unter Umständen ein Fall der Aufsichtspflichtverletzungvor (Teil III, Kap. 4.3.3). Dies allerdings nur dann, wenn die Aufsicht tatsächlich verletzt wurde, d. h. beim Aufsichtspflichtigen (beispielsweise Fachkraft) ein Verschulden vorliegt.
Beispiel
Ein fünfjähriger Junge zerkratzt den Lack eines Kraftfahrzeuges. Der Halter des PKW kann von ihm selbst keinen Ersatz für den Schaden, d. h. die Kosten für eine neue Lackierung, fordern. Diese Zahlung müsste also durch die Eltern des Kindes erfolgen, wenn sie ihre Aufsichtspflicht verletzt hätten.
Es haftet aber der Deliktsunfähige selbst, wenn nach besonderen Umständen die Billigkeit einen Ersatz des Schadens erfordert. Die Voraussetzungen dafür sind in § 829 BGB geregelt:
»… für einen von ihm verursachten Schaden … nicht verantwortlich ist, hat gleichwohl … den Schaden insoweit zu ersetzen, als die Billigkeit nach den Umständen, insbesondere nach den Verhältnissen der Beteiligten, eine Schadloshaltung erfordert und ihm nicht die Mittel entzogen werden, deren er zum angemessenen Unterhalte sowie zur Erfüllung seiner gesetzlichen Unterhaltspflichten bedarf.«
Es müssen bei der Prüfung der Billigkeit folglich alle Umstände, insbesondere die Vermögensverhältnisse von Schädiger und Geschädigtem, abgewogen werden. Sofern die Vermögensverhältnisse desjenigen, der den Schaden verursacht hat, erheblich besser sind als diejenigen des Geschädigten, ist die Zahlung von Schadenersatz aufgrund der so genannten Billigkeit notwendig und es tritt die Billigkeitshaftung ein.
3.2.2.2 Beschränkte Deliktsfähigkeit
Minderjährige sind zwischen dem siebten und dem achtzehnten Lebensjahr beschränkt deliktsfähig, d. h. nur für den verursachten Schaden verantwortlich, sofern er die erforderliche Einsicht bei der Tat hatten (§ 828 Abs. 3 BGB). Der Schädiger, also der Minderjährige, muss daher im Zeitpunkt der Handlung die geistige Entwicklung besitzen, die es ihm ermöglicht, das Unrecht seiner Handlung gegenüber den Mitmenschen zu erkennen und gleichzeitig die Verpflichtung, für die Folgen selbst einzustehen. Es wird daher vergleichbar mit dem Strafrecht die geistige Reife überprüft und gewürdigt.
Wiederholungsfragen
Wer ist »deliktsunfähig«?
Welche Personen haften wann für Deliktsunfähige?
Was bedeutet beschränke Deliktsfähigkeit?
Wann haften beschränkt Deliktsfähige?
3.3 Rechtliche Betreuung
Im Vordergrund des seit dem 1.01.2023 geltenden neuen Betreuungsrechts stehen die Wünsche und das Wohl des Betroffenen und der Wille, dem kranken und/oder behinderten Menschen Hilfestellung zu geben. Die Personensorge, d. h. die persönliche Betreuung, soll ein erhebliches Gewicht haben. Die rechtliche Betreuung soll dem Schutz und der Hilfe von Erwachsenen dienen. Sie stellt den Ersatz für das seit dem Jahre 1992 geltende Betreuungsrecht dar, welches seinerzeit die bis Ende 1991 mögliche Vormundschaft und Gebrechlichkeitspflegschaft abgelöst hat. Ziel des Gesetzes ist, die Rechte von (psychisch) kranken und behinderten Menschen zu verbessern sowie die Rechte von behinderten Menschen nach der UN-Behindertenkonvention2 umzusetzen. Nach der amtlichen Begründung zum Betreuungsrecht sollen Rechtseingriffe nur noch dort erfolgen, wo sie unausweichlichlich sind.3
3.3.1 Voraussetzungen der Betreuung
Voraussetzung der Betreuung sind nach § 1814 Abs. 1 BGB eine
Volljährigkeit und
Besorgung von Angelegenheiten nicht oder teilweise nicht möglich,
dies aufgrund Krankheit oder Behinderung.
Die Krankheit oder Behinderung allein führt aber noch nicht zur Bestellung eines Betreuers, denn zusätzlich muss es dem (psychisch) kranken oder behinderten Menschen unmöglich sein, seine (rechtlichen) Angelegenheiten selbst zu erledigen. Es muss folglich immer die Unfähigkeit zur Besorgung der Angelegenheiten zu den gesundheitlichen Einschränkungen hinzukommen.
Die Bestellung des Betreuers darf nur zusätzlich dann erfolgen, sofern eine Besorgung der Angelegenheiten nicht auf eine andere Weise, beispielsweise durch einen Bevollmächtigten oder andere Hilfen erfolgen kann. Eine dieser denkbaren anderen Möglichkeiten ist die Vollmacht (beispielsweise Vorsorgevollmacht) für einen Familienangehörigen oder andere Personen. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die Betreuung gemäß den §§ 1896 ff. BGB lediglich durchgeführt werden, wenn andere Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Die Betreuung soll also das letzte Mittel zur Regelung der Angelegenheiten sein.
Die rechtliche Betreuung darf nicht für rein tatsächliche Tätigkeiten wie Körperpflege, Kochen oder ähnliches angeordnet werden, sondern nur, wenn ein gesetzlicher Vertreter oder Beistand notwendig ist.
Gegen den »Freien Willen« darf keine Betreuung angeordnet werden (§ 1814 Abs. 2 BGB):
(2)Gegen den freien Willen des Volljährigen darf ein Betreuer nicht bestellt werden.
Dadurch wird mehr als früher der Tatsache Rechnung getragen, dass auch bei einem psychisch kranken Menschen oder Menschen mit Behinderung Art. 2 GG (Persönlichkeitsrecht) zu beachten ist.
Die Krankheit oder Behinderung allein führt aber noch nicht zur Bestellung eines Betreuers, denn zusätzlich muss es dem Kranken oder Behinderten unmöglich sein, seine (rechtlichen) Angelegenheiten selbst zu erledigen. Es muss folglich immer die Unfähigkeit zur Besorgung der Angelegenheiten zu den gesundheitlichen Einschränkungen hinzukommen.
Beispiel
Frau K. leidet an einer chronischen Psychose. Dennoch kann sie ihr Leben selbst gestalten und ihre finanziellen Angelegenheiten regeln. Deshalb ist ein Betreuer nicht möglich und auch nicht erforderlich.
Die Bestellung des Betreuers darf nur dann erfolgen, sofern eine Besorgung der Angelegenheiten nicht auf eine andere Weise, beispielsweise durch einen Bevollmächtigten (Rechtsanwalt, Bekannter, Verwandter oder Familienangehöriger) oder andere Hilfen erfolgen kann. Eine dieser denkbaren anderen Möglichkeiten ist die Vorsorgevollmacht für einen Familienangehörigen. Nach dem Willen des Gesetzgebers soll die Betreuung gemäß den §§ 1814 ff. BGB lediglich durchgeführt werden, wenn andere Möglichkeiten nicht zur Verfügung stehen. Die Betreuung soll also das letzte Mittel zur Regelung der Angelegenheiten sein.
Die rechtliche Betreuung darf nicht für rein tatsächliche Tätigkeiten wie Körperpflege, Kochen oder ähnliches angeordnet werden, sondern nur, wenn ein gesetzlicher Vertreter oder Beistand notwendig ist.
3.3.2 Betreuungsverfahren
Der Antrag auf Bestellung eines Betreuers muss grundsätzlich vom Betroffenen selbst gestellt werden. Sofern er »seinen Willen nicht kundtun« kann, ist die Bestellung von Amts wegen erforderlich. Die Anregung, d. h. der »Antrag« dazu, kann aber auch von Familienangehörigen und sonstigen Personen (z. B. Pflegekräften, Nachbarn), also von jeder Person erfolgen.
Beispiel
Der neunzehnjährige B. ist geistig behindert. Bisher hat seine Mutter die Angelegenheiten für ihn erledigt. Da sie selbst erkrankt, fühlt sie sich nun überfordert. Sie wendet sich deshalb an das Betreuungsgericht zur Bestellung eines Betreuers für ihren Sohn. Dieses bestellt einen Betreuer mit dem Aufgabenkreis Vermögenssorge.
Das Betreuungsverfahren wird vor dem Amtsgericht (dort: Betreuungsgericht