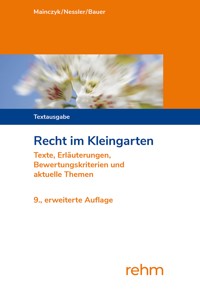
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Rehm Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die Textausgabe enthält die aktuellen Vorschriften rund um die Schaffung und den Betrieb von Kleingartenanlagen. Die handliche Sammlung bietet dazu neben dem Text des Bundeskleingartengesetzes u.a. Auszüge - aus den Bauordnungen der Länder, - aus den Kommunalabgabengesetzen der Länder, - aus dem BGB, - aus den Bewertungsgesetzen der DDR und des Bundes, - sowie aus dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz.Die verständliche Einführung gibt einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen von Kleingärten. Außerdem werden Grundzüge der Bewertung von Kleingärten dargestellt. Zusätzlich wurden nun auch Ausführungen zu zwei aktuellen Themen aufgenommen: - Photovoltaik-Fragen und - Fragen zum Wohnen in der LaubeMit dem Buch hat der am Kleingartenrecht Interessierte eine zuverlässige Hilfe und Kurzinformation zur Hand.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 414
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Hauptteil
Anhang
Inhaltsverzeichnis
Recht im Kleingarten
Impressum
Vorwort
Verzeichnis der aktiven Bearbeiter
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einführung
Teil A Einleitung
1. Anwendungsbereich
1.1 Kleingartenbegriff
(1) Kleingärtnerische Nutzung
(2) Kleingartenanlage
(3) Baulichkeiten
1.2 Abgrenzung von anderen ähnlichen Nutzungsarten
1.3 Dauerkleingärten
1.4 Eigenheime und vergleichbare Baulichkeiten in Kleingartenanlagen
2. Gartenlauben und ihre Nutzung
3. Kleingartenpachtverträge
3.1 Gestufte Pachtverhältnisse (Zwischenpacht)
3.2 Kleingärtnerische Gemeinnützigkeit
3.3 Vertragsdauer
3.4 Pachtzins und Nebenleistungen
3.4.1 Pachtobergrenze
3.4.2 Zwischenpächterzuschlag
3.4.3 Ermittlung des Pachtzinses und Anpassung an den Höchstpachtzins
3.4.4 Erstattung der Aufwendungen des Verpächters für die Kleingartenanlage
3.4.5 Kostenüberwälzung der öffentlich-rechtlichen Lasten auf die Kleingärtner
a) Grundsteuer
b) Beiträge
c) Gebühren
3.5 Kündigung
3.5.1 Fristlose Kündigung
3.5.2 Ordentliche Kündigung
a) Nicht unerhebliche Pflichtverletzungen
b) Neuordnung der Kleingartenanlage
c) Eigenbedarfskündigung
d) Andere wirtschaftliche Verwertung
e) Planverwirklichung
3.5.3 Kündigungsfrist
3.5.4 Kündigung von Zwischenpachtverträgen
3.6 Kündigungsentschädigung
4. Bereitstellung und Beschaffung von Ersatzland
5. Zwangsweise Begründung in Pachtverhältnissen
6. Überleitung der Kleingartenpachtverträge in den alten Ländern bei Inkrafttreten des BKleingG
7. Sonderregelungen in den neuen Ländern
7.1 Überleitung der Kleingartennutzungsverhältnisse
7.2 Eigentum an baulichen Anlagen in Kleingärten
7.3 Kleingartenpachtverträge über gemeindeeigene und sonstige Grundstücke
7.4 Zwischenpachtprivileg
7.5 Pachtzinsen
7.6 Bestandsschutz
7.7 Neuregelung der Zwischenpachtverhältnisse/Vertragseintritt des Grundstückseigentümers
Teil B Einführung in die Bewertung von Kleingärten
1. Gartengestaltung
2. Beurteilung der Nutzungsformen in der Kleingartenanlage
3. Beurteilung des Zustandes einer Kleingartenparzelle
4. Entschädigung
5. Verkehrssicherheit von Bäumen
Teil C Aktuelle Themen im Kleingarten
1. Photovoltaik in Kleingartenanlagen
I. Einführung
II. Kleingartenpachtrecht
1. Zulässigkeit von Photovoltaikanlagen
2. Kleingartenrechtliche Aspekte beim Pächterwechsel
III. Baurecht
IV. Energierecht
V. Steuerrecht
Abschlussbemerkung
2. Prüfung dauerhaftes Wohnen
Gesetzestexte
1. BKleingG
Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften
§ 1 Begriffsbestimmungen
§ 2 Kleingärtnerische Gemeinnützigkeit
§ 3 Kleingarten und Gartenlaube
Zweiter Abschnitt Kleingartenpachtverhältnisse
§ 4 Kleingartenpachtverträge
§ 5 Pacht
§ 6 Vertragsdauer
§ 7 Schriftform der Kündigung
§ 8 Kündigung ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist
§ 9 Ordentliche Kündigung
§ 10 Kündigung von Zwischenpachtverträgen
§ 11 Kündigungsentschädigung
§ 12 Beendigung des Kleingartenpachtvertrages bei Tod des Kleingärtners
§ 13 Abweichende Vereinbarungen
Dritter Abschnitt Dauerkleingärten
§ 14 Bereitstellung und Beschaffung von Ersatzland
§ 15 Begründung von Kleingartenpachtverträgen durch Enteignung
Vierter Abschnitt Überleitungs- und Schlussvorschriften
§ 16 Überleitungsvorschriften für bestehende Kleingärten
§ 17 Überleitungsvorschrift für die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit
§ 18 Überleitungsvorschriften für Lauben
§ 19 Stadtstaatenklausel
§ 20 Aufhebung von Vorschriften
§ 20a Überleitungsregelungen aus Anlass der Herstellung der Einheit Deutschlands
§ 20b Sonderregelungen für Zwischenpachtverhältnisse im Beitrittsgebiet
§ 21 Berlin-Klausel – aufgehoben
§ 22 Inkrafttreten
2. BKleingÄndG
Artikel 1 Änderung des Bundeskleingartengesetzes
Artikel 2 Änderung des Baugesetzbuchs
Artikel 3 Überleitungsregelungen
Artikel 4 Inkrafttreten
3. SchuldRÄndG
Artikel 1 Gesetz zur Anpassung schuldrechtlicher Nutzungsverhältnisse an Grundstücken im Beitrittsgebiet (Schuldrechtsanpassungsgesetz – SchuldRAnpG)
Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften
Abschnitt 1 Anwendungsbereich
§ 1 Betroffene Rechtsverhältnisse
§ 2 Nicht einbezogene Rechtsverhältnisse
§ 3 Zeitliche Begrenzung
Abschnitt 3 Grundsätze
Unterabschnitt 1 Durchführung der Schuldrechtsanpassung
§ 6 Gesetzliche Umwandlung
§ 7 Kündigungsschutz durch Moratorium
Unterabschnitt 2 Rechtsgeschäfte mit anderen Vertragschließenden
§ 8 Vertragseintritt
§ 9 Vertragliche Nebenpflichten
§ 10 Verantwortlichkeit für Fehler oder Schäden
§ 19 Heilung von Mängeln
Artikel 5 Änderung des Bundeskleingartengesetzes
„§ 20b Sonderregelungen für Zwischenpachtverhältnisse im Beitrittsgebiet
Artikel 6 Inkrafttreten
4. BGB
Buch 1 Allgemeiner Teil
Abschnitt 1 Personen
Titel 2 Juristische Personen
Untertitel 1 Vereine
Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften
§ 21 Nicht wirtschaftlicher Verein
§ 24 Sitz
§ 25 Verfassung
§ 26 Vorstand und Vertretung
§ 27 Bestellung und Geschäftsführung des Vorstands
§ 28 Beschlussfassung des Vorstands
§ 29 Notbestellung durch Amtsgericht
§ 30 Besondere Vertreter
§ 31 Haftung des Vereins für Organe
§ 31a Haftung von Organmitgliedern und besonderen Vertretern
§ 31b Haftung von Vereinsmitgliedern
§ 32 Mitgliederversammlung; Beschlussfassung
§ 33 Satzungsänderung
§ 34 Ausschluss vom Stimmrecht
§ 35 Sonderrechte
§ 36 Berufung der Mitgliederversammlung
§ 37 Berufung auf Verlangen einer Minderheit
§ 38 Mitgliedschaft
§ 39 Austritt aus dem Verein
§ 40 Nachgiebige Vorschriften
§ 41 Auflösung des Vereines
§ 42 Insolvenz
§ 43 Entziehung der Rechtsfähigkeit
§ 44 Zuständigkeit und Verfahren
§ 45 Anfall des Vereinsvermögens
§ 46 Anfall an den Fiskus
§ 47 Liquidation
§ 48 Liquidatoren
§ 49 Aufgaben der Liquidatoren
§ 50 Bekanntmachung des Vereins in Liquidation
§ 50a Bekanntmachungsblatt
§ 51 Sperrjahr
§ 52 Sicherung für Gläubiger
§ 53 Schadensersatzpflicht der Liquidatoren
§ 54 Nicht rechtsfähige Vereine
Kapitel 2 Eingetragene Vereine
§ 55 Zuständigkeit für die Registereintragung
§ 55a Elektronisches Vereinsregister
§ 56 Mindestmitgliederzahl des Vereins
§ 57 Mindesterfordernisse an die Vereinssatzung
§ 58 Sollinhalt der Vereinssatzung
§ 59 Anmeldung zur Eintragung
§ 60 Zurückweisung der Anmeldung
§ 64 Inhalt der Vereinsregistereintragung
§ 65 Namenszusatz
§ 66 Aufbewahrung von Dokumenten
§ 67 Änderung des Vorstands
§ 68 Vertrauensschutz durch Vereinsregister
§ 69 Nachweis des Vereinsvorstands
§ 70 Vertrauensschutz bei Eintragungen zur Vertretungsmacht
§ 71 Änderungen der Satzung
§ 72 Bescheinigung der Mitgliederzahl
§ 73 Unterschreiten der Mindestmitgliederzahl
§ 74 Auflösung
§ 75 Eintragungen bei Insolvenz
§ 76 Eintragungen bei Liquidation
§ 77 Anmeldepflichtige und Form der Anmeldungen
§ 78 Festsetzung von Zwangsgeld
Abschnitt 2 Sachen und Tiere
§ 90 Begriff der Sache
§ 93 Wesentliche Bestandteile einer Sache
§ 94 Wesentliche Bestandteile eines Grundstücks oder Gebäudes
§ 95 Nur vorübergehender Zweck
§ 96 Rechte als Bestandteile eines Grundstücks
§ 97 Zubehör
§ 99 Früchte
§ 100 Nutzungen
Abschnitt 3 Rechtsgeschäfte
Titel 2 Willenserklärung
§ 125 Nichtigkeit wegen Formmangels
§ 126 Schriftform
§ 126a Elektronische Form
§ 126b Textform
§ 127 Vereinbarte Form
§ 127a Gerichtlicher Vergleich
§ 128 Notarielle Beurkundung
§ 129 Öffentliche Beglaubigung
§ 130 Wirksamwerden der Willenserklärung gegenüber Abwesenden
§ 132 Ersatz des Zugehens durch Zustellung
§ 133 Auslegung einer Willenserklärung
Abschnitt 4 Fristen, Termine
§ 186 Geltungsbereich
§ 187 Fristbeginn
§ 188 Fristende
§ 189 Berechnung einzelner Fristen
§ 190 Fristverlängerung
§ 191 Berechnung von Zeiträumen
§ 192 Anfang, Mitte, Ende des Monats
§ 193 Sonn- und Feiertag; Sonnabend
Abschnitt 5 Verjährung
Titel 1 Gegenstand und Dauer der Verjährung
§ 194 Gegenstand der Verjährung
§ 195 Regelmäßige Verjährungsfrist
§ 196 Verjährungsfrist bei Rechten an einem Grundstück
§ 197 Dreißigjährige Verjährungsfrist
§ 199 Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist und Verjährungshöchstfristen
§ 200 Beginn anderer Verjährungsfristen
§ 201 Beginn der Verjährungsfrist von festgestellten Ansprüchen
§ 202 Unzulässigkeit von Vereinbarungen über die Verjährung
Titel 2 Hemmung, Ablaufhemmung und Neubeginn der Verjährung
§ 203 Hemmung der Verjährung bei Verhandlungen
§ 204 Hemmung der Verjährung durch Rechtsverfolgung
§ 205 Hemmung der Verjährung bei Leistungsverweigerungsrecht
§ 206 Hemmung der Verjährung bei höherer Gewalt
§ 209 Wirkung der Hemmung
§ 212 Neubeginn der Verjährung
§ 213 Hemmung, Ablaufhemmung und erneuter Beginn der Verjährung bei anderen Ansprüchen
Titel 3 Rechtsfolgen der Verjährung
§ 214 Wirkung der Verjährung
§ 215 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrecht nach Eintritt der Verjährung
§ 216 Wirkung der Verjährung bei gesicherten Ansprüchen
§ 217 Verjährung von Nebenleistungen
Buch 2 Recht der Schuldverhältnisse
Abschnitt 1 Inhalt der Schuldverhältnisse
Titel 1 Verpflichtung zur Leistung
§ 242 Leistung nach Treu und Glauben
§ 280 Schadensersatz wegen Pflichtverletzung
§ 286 Verzug des Schuldners
Abschnitt 3 Schuldverhältnisse aus Verträgen
Untertitel 3 Anpassung und Beendigung von Verträgen
§ 313 Störung der Geschäftsgrundlage
Abschnitt 8 Einzelne Schuldverhältnisse
Titel 5 Mietvertrag, Pachtvertrag
Untertitel 1 Allgemeine Vorschriften für Mietverhältnisse
§ 535 Inhalt und Hauptpflichten des Mietvertrags
§ 536 Mietminderung bei Sach- und Rechtsmängeln
§ 536a Schadens- und Aufwendungsersatzanspruch des Mieters wegen eines Mangels
§ 536b Kenntnis des Mieters vom Mangel bei Vertragsschluss oder Annahme
§ 536c Während der Mietzeit auftretende Mängel; Mängelanzeige durch den Mieter
§ 536d Vertraglicher Ausschluss von Rechten des Mieters wegen eines Mangels
§ 537 Entrichtung der Miete bei persönlicher Verhinderung des Mieters
§ 538 Abnutzung der Mietsache durch vertragsgemäßen Gebrauch
§ 539 Ersatz sonstiger Aufwendungen und Wegnahmerecht des Mieters
§ 540 Gebrauchsüberlassung an Dritte
§ 541 Unterlassungsklage bei vertragswidrigem Gebrauch
§ 542 Ende des Mietverhältnisses
§ 543 Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund
§ 544 Vertrag über mehr als 30 Jahre
§ 545 Stillschweigende Verlängerung des Mietverhältnisses
§ 546 Rückgabepflicht des Mieters
§ 546a Entschädigung des Vermieters bei verspäteter Rückgabe
§ 547 Erstattung von im Voraus entrichteter Miete
§ 548 Verjährung der Ersatzansprüche und des Wegnahmerechts
Untertitel 2 Mietverhältnisse über Wohnraum
Kapitel 1 Allgemeine Vorschriften
§ 550 Form des Mietvertrags
Kapitel 3 Pfandrecht des Vermieters
§ 562 Umfang des Vermieterpfandrechts
§ 562a Erlöschen des Vermieterpfandrechts
§ 562b Selbsthilferecht, Herausgabeanspruch
§ 562c Abwendung des Pfandrechts durch Sicherheitsleistung
§ 562d Pfändung durch Dritte
Kapitel 4 Wechsel der Vertragsparteien
§ 563b Haftung bei Eintritt oder Fortsetzung
§ 566 Kauf bricht nicht Miete
§ 566a Mietsicherheit
§ 566b Vorausverfügung über die Miete
§ 566c Vereinbarung zwischen Mieter und Vermieter über die Miete
§ 566d Aufrechnung durch den Mieter
§ 566e Mitteilung des Eigentumsübergangs durch den Vermieter
§ 567 Belastung des Wohnraums durch den Vermieter
§ 567a Veräußerung oder Belastung vor der Überlassung des Wohnraums
§ 567b Weiterveräußerung oder Belastung durch Erwerber
Kapitel 5 Beendigung des Mietverhältnisses
Unterkapitel 1 Allgemeine Vorschriften
§ 569 Außerordentliche fristlose Kündigung aus wichtigem Grund
§ 570 Ausschluss des Zurückbehaltungsrechts
Untertitel 3 Mietverhältnisse über andere Sachen und digitale Produkte
§ 578 Mietverhältnisse über Grundstücke und Räume
§ 578a Mietverhältnisse über eingetragene Schiffe
§ 579 Fälligkeit der Miete
§ 580a Kündigungsfristen
Untertitel 4 Pachtvertrag
§ 581 Vertragstypische Pflichten beim Pachtvertrag
§ 584 Kündigungsfrist
§ 584a Ausschluss bestimmter mietrechtlicher Kündigungsrechte
§ 584b Verspätete Rückgabe
5. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
Sechster Teil Inkrafttreten und Übergangsrecht aus Anlass der Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs und dieses Einführungsgesetzes in dem in Art. 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet
Art. 231 Erstes Buch. Allgemeiner Teil des Bürgerlichen Gesetzbuchs
§ 2 Vereine
§ 4 Haftung juristischer Personen für ihre Organe
§ 5 Sachen
§ 6 Verjährung
Art. 232 Zweites Buch. Recht der Schuldverhältnisse
§ 1 Allgemeine Bestimmungen für Schuldverhältnisse
§ 1a Überlassungsverträge
§ 2 Mietverträge
§ 3 Pachtverträge
§ 4 Nutzung von Bodenflächen zur Erholung
§ 4a Vertrags-Moratorium
Art. 233 Drittes Buch. Sachenrecht
Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften
§ 1 Besitz
§ 2 Inhalt des Eigentums
§ 2a Moratorium
§ 2b Gebäudeeigentum ohne dingliches Nutzungsrecht
§ 2c Grundbucheintragung
§ 3 Inhalt und Rang beschränkter dinglicher Rechte
§ 4 Sondervorschriften für dingliche Nutzungsrechte und Gebäudeeigentum
§ 5 Mitbenutzungsrechte
6. SachenRBerG
Kapitel 1 Gegenstände der Sachenrechtsbereinigung
§ 1 Betroffene Rechtsverhältnisse
§ 2 Nicht einbezogene Rechtsverhältnisse
Kapitel 2 Nutzung fremder Grundstücke durch den Bau oder den Erwerb von Gebäuden
Abschnitt 1 Allgemeine Bestimmungen
Unterabschnitt 1 Grundsätze
§ 3 Regelungsinstrumente und Regelungsziele
Unterabschnitt 2 Anwendungsbereich
§ 4 Bauliche Nutzungen
§ 5 Erwerb oder Bau von Eigenheimen
Kapitel 5 Ansprüche auf Bestellung von Dienstbarkeiten
§ 116 Bestellung einer Dienstbarkeit
§ 117 Einwendungen des Grundstückseigentümers
§ 118 Entgelt
§ 119 Fortbestehende Rechte, andere Ansprüche
7. BauGB
Erstes Kapitel Allgemeines Städtebaurecht
Erster Teil Bauleitplanung
Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften
§ 1 Aufgabe, Begriff und Grundsätze der Bauleitplanung
§ 1a Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz
§ 2 Aufstellung der Bauleitpläne
§ 2a Begründung zum Bauleitplanentwurf, Umweltbericht
§ 3 Beteiligung der Öffentlichkeit
§ 4 Beteiligung der Behörden
§ 4a Gemeinsame Vorschriften zur Beteiligung
§ 4b Einschaltung eines Dritten
§ 4c Überwachung
Zweiter Abschnitt Vorbereitender Bauleitplan (Flächennutzungsplan)
§ 5 Inhalt des Flächennutzungsplans
§ 6 Genehmigung des Flächennutzungsplans
§ 6a Zusammenfassende Erklärung zum Flächennutzungsplan; Einstellen in das Internet
§ 7 Anpassung an den Flächennutzungsplan
Dritter Abschnitt Verbindlicher Bauleitplan (Bebauungsplan)
§ 8 Zweck des Bebauungsplans
§ 9 Inhalt des Bebauungsplans
§ 9a Verordnungsermächtigung
§ 10 Beschluss, Genehmigung und Inkrafttreten des Bebauungsplans
§ 10a Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan; Einstellen in das Internet
Vierter Abschnitt Zusammenarbeit mit Privaten; vereinfachtes Verfahren
§ 11 Städtebaulicher Vertrag
§ 12 Vorhaben- und Erschließungsplan
§ 13 Vereinfachtes Verfahren
§ 13a Bebauungspläne der Innenentwicklung
§ 13b Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren
Zweiter Teil Sicherung der Bauleitplanung
Zweiter Abschnitt Teilung von Grundstücken; Gebiete mit Fremdenverkehrsfunktionen
§ 19 Teilung von Grundstücken
Dritter Teil Regelung der baulichen und sonstigen Nutzung; Entschädigung
Erster Abschnitt Zulässigkeit von Vorhaben
§ 29 Begriff des Vorhabens; Geltung von Rechtsvorschriften
§ 30 Zulässigkeit von Vorhaben im Geltungsbereich eines Bebauungsplans
§ 31 Ausnahmen und Befreiungen
§ 32 Nutzungsbeschränkungen auf künftigen Gemeinbedarfs-, Verkehrs-, Versorgungs- und Grünflächen
§ 33 Zulässigkeit von Vorhaben während der Planaufstellung
§ 34 Zulässigkeit von Vorhaben innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile
§ 35 Bauen im Außenbereich
§ 36 Beteiligung der Gemeinde und der höheren Verwaltungsbehörde
§ 37 Bauliche Maßnahmen des Bundes und der Länder
§ 38 Bauliche Maßnahmen von überörtlicher Bedeutung aufgrund von Planfeststellungsverfahren; öffentlich zugängliche Abfallbeseitigungsanlagen
Zweiter Abschnitt Entschädigung
§ 39 Vertrauensschaden
§ 40 Entschädigung in Geld oder durch Übernahme
Vierter Teil Bodenordnung
Erster Abschnitt Umlegung
§ 45 Zweck und Anwendungsbereich
§ 61 Aufhebung, Änderung und Begründung von Rechten
Fünfter Teil Enteignung
Erster Abschnitt Zulässigkeit der Enteignung
§ 85 Enteignungszweck
§ 86 Gegenstand der Enteignung
Sechster Teil Erschließung
Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften
§ 123 Erschließungslast
Zweiter Abschnitt Erschließungsbeitrag
§ 127 Erhebung des Erschließungsbeitrags
§ 133 Gegenstand und Entstehung der Beitragspflicht
§ 134 Beitragspflichtiger
§ 135 Fälligkeit und Zahlung des Beitrags
Zweites Kapitel Besonderes Städtebaurecht
Achter Teil Miet- und Pachtverhältnisse
§ 182 Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen
§ 183 Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen über unbebaute Grundstücke
§ 184 Aufhebung anderer Vertragsverhältnisse
§ 185 Entschädigung bei Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen
Drittes Kapitel Sonstige Vorschriften
Erster Teil Wertermittlung
§ 192 Gutachterausschuss
§ 193 Aufgaben des Gutachterausschusses
§ 197 Befugnisse des Gutachterausschusses
§ 198 Oberer Gutachterausschuss
Zweiter Teil Allgemeine Vorschriften; Zuständigkeiten; Verwaltungsverfahren; Planerhaltung
Erster Abschnitt Allgemeine Vorschriften
§ 200 Grundstücke; Rechte an Grundstücken; Baulandkataster
§ 201 Begriff der Landwirtschaft
Viertes Kapitel Überleitungs- und Schlussvorschriften
Erster Teil Überleitungsvorschriften
§ 242 Überleitungsvorschriften für die Erschließung
8. BNatSchG
Kapitel 3 Allgemeiner Schutz von Natur und Landschaft
§ 14 Eingriffe in Natur und Landschaft
§ 15 Verursacherpflichten, Unzulässigkeit von Eingriffen; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
§ 16 Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen
§ 17 Verfahren; Ermächtigung zum Erlass von Rechtsverordnungen
§ 18 Verhältnis zum Baurecht
9a. BewG
Zweiter Teil Besondere Bewertungsvorschriften
§ 17 Geltungsbereich
§ 18 Vermögensarten
Erster Abschnitt Einheitsbewertung
B. Land- und forstwirtschaftliches Vermögen
I. Allgemeines
§ 33 Begriff des land- und forstwirtschaftlichen Vermögens
§ 34 Betrieb der Land- und Forstwirtschaft
C. Grundvermögen
I. Allgemeines
§ 68 Begriff des Grundvermögens
§ 69 Abgrenzung des Grundvermögens vom land- und forstwirtschaftlichen Vermögen
§ 70 Grundstück
II. Unbebaute Grundstücke
§ 72 Begriff
§ 73 Baureife Grundstücke
9b. Bewertungsgesetz der ehemaligen DDR
§ 10 Bewertungsgrundsatz
§ 11 Mit Grundbesitz verbundene Rechte, Bestandteile und Zubehör
II. Grundvermögen
§ 50 Begriff des Grundvermögens
§ 51 Abgrenzung des Grundvermögens von anderen Vermögensarten
§ 52 Bewertung von bebauten Grundstücken
§ 53 Bewertung von unbebauten Grundstücken
10. GrStG
Abschnitt I Steuerpflicht
§ 1 Heberecht
§ 2 Steuergegenstand
§ 9 Stichtag für die Festsetzung der Grundsteuer, Entstehung der Steuer
§ 10 Steuerschuldner
§ 11 Persönliche Haftung
§ 12 Dingliche Haftung
Abschnitt II Bemessung der Grundsteuer
§ 13 Steuermesszahl und Steuermessbetrag
§ 14 Steuermesszahl für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
§ 15 Steuermesszahl für Grundstücke
§ 16 Hauptveranlagung
§ 17 Neuveranlagung
§ 18 Nachveranlagung
Abschnitt III Festsetzung und Entrichtung der Grundsteuer
§ 25 Festsetzung des Hebesatzes
§ 26 Koppelungsvorschriften und Höchsthebesätze
§ 27 Festsetzung der Grundsteuer
§ 28 Fälligkeit
11. VermG
Abschnitt I Allgemeine Bestimmungen
§ 1 Geltungsbereich
Abschnitt II Rückübertragung von Vermögenswerten
§ 3 Grundsatz
Abschnitt III Aufhebung der staatlichen Verwaltung
§ 11 Grundsatz
§ 11a Beendigung der staatlichen Verwaltung
Abschnitt IV Rechtsverhältnisse zwischen Berechtigten und Dritten
§ 16 Übernahme von Rechten und Pflichten
§ 17 Miet- und Nutzungsrechte
12. ZGB
Dritter Teil Verträge zur Gestaltung des materiellen und kulturellen Lebens
Erstes Kapitel Allgemeine Bestimmung über Verträge
Erster Abschnitt Grundsätze
§ 45 Bestimmungen des Vertragsinhalts
Zweites Kapitel Verleihung von Nutzungsrechten an volkseigenen Grundstücken
§ 287 Entstehen des Nutzungsrechts
§ 288 Inhalt des Nutzungsrechts
§ 289 Übergang des Nutzungsrechts
§ 290 Entzug des Nutzungsrechts
Drittes Kapitel Persönliche Nutzung genossenschaftlich genutzten Bodens
§ 291 Entstehen des Nutzungsrechts
§ 292 Inhalt des Nutzungsrechts
§ 293 Übergang des Nutzungsrechts
§ 294 Entzug des Nutzungsrechts
Viertes Kapitel Persönliches Eigentum an Grundstücken und Gebäuden
§ 296 Eigentum an Wochenendhäusern und anderen Baulichkeiten auf vertraglich genutzten Bodenflächen
Fünftes Kapitel Nutzung von Bodenflächen zur Erholung
§ 312 Abschluss des Vertrages
§ 313 Rechte und Pflichten des Nutzungsberechtigten
§ 314 Beendigung des Nutzungsverhältnisses
Sechstes Kapitel Benachbarte Grundstücksnutzer
. . . Mitbenutzungsrecht an Grundstücken
§ 321 Vereinbarung
§ 322 Wege-Überfahrtsrecht
13. VereinG
Grundsätze
§ 1 Begriffsbestimmungen; Geltungsbereich des Gesetzes
§ 2 Genehmigungsfreiheit; Verbot
§ 3 Mitgliedschaft
Rechtsfähige Vereinigung
§ 4 Rechtsfähigkeit; Registrierung
§ 5 Namen
§ 6 Mitgliederversammlung
§ 7 Vorstand
§ 8 Verantwortlichkeit; Haftung
§ 9 Auflösung
§ 10 Gesamtvollstreckung
§ 11 Löschung
§ 12 Registergericht; Gebühren; Öffentlichkeit des Registers
§ 13 Keine Registrierung
§ 14 Einzutragende Tatsachen; Urkunde
§ 15 Änderungen des Statuts; Auflösung; Verlust der Rechtsfähigkeit
Nichtrechtsfähige Vereinigungen
§ 16 Anwendbare Bestimmungen
§ 17 Gemeinschaftliche Verwaltung
§ 18 Auflösungsbeschluss; Folgen der Auflösung
Verbot einer Vereinigung
§ 19 Verfahren
§ 20 Auflösung
§ 21 Gemeinnützige Vereinigungen
§ 21 a Finanzielle Unterstützung von gemeinnützigen und anderen Vereinigungen
§ 22 Übergangsbestimmungen
Schlussbestimmungen
§ 23 Ausländer und Staatenlose
§ 24 Durchführungsbestimmungen
§ 25 Inkrafttreten; Außerkrafttreten
14. DVO
§ 1 Zuständigkeit
§ 2 Einrichtung des Vereinigungsregisters
§ 3 Führung des Vereinigungsregisters
§ 4 Anmeldung zur Registrierung
§ 5 Prüfung der Voraussetzungen der Registrierung
§ 6 Einsichtnahme
§ 7 Abschriften und Beglaubigungen
§ 8 Auflösung der Vereinigung
§ 9 Gesamtvollstreckung und Verbot
§ 10 Gebühren
§ 11 Zwangsgeld
§ 12 Beschwerde
§ 13 Schlussbestimmung
Anhang
1. Bauordnungen der Länder
2. BauO NRW
Erster Teil Allgemeine Vorschriften
§ 1 Anwendungsbereich
§ 2 Begriffe
§ 3 Allgemeine Anforderungen
Fünfter Teil Bauaufsichtsbehörden, Verfahren
Erster Abschnitt Bauaufsichtsbehörden
§ 57 Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden
§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden
Zweiter Abschnitt Genehmigungspflicht, Genehmigungsfreiheit
§ 60 Grundsatz
§ 62 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen
3. Kleingartenrecht der Länder
Fußnoten
Recht im Kleingarten
Texte, Erläuterungen, Bewertungskriterien und aktuelle Themen
E-Book-Fassung
begründet von
Dr. Lorenz Maincyk †ehemals Ministerialrat im Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Rechtsanwalt, Bonn
ab der 8. Auflage bearbeitet von
Patrick R. NesslerRechtsanwalt, St. Ingbert
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Thomas BauerÖffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für Haus- und Kleingärten, Augsburg
9. erweiterte Auflage
Stand: Mai 2023
Impressum
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
ISBN 978-3-8073-2889-8
E-Mail: [email protected]
Telefon: +49 89/2183-1780Telefax: +49 89/2183-7620
Copyright 2023, rehm, eine Marke der Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH
www.rehm-verlag.de
Hinweis des Verlages zum Urheberrecht und Digitalen Rechtemanagement (DRM)Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des ebooks das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfätigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.Der Verlag schützt seine ebooks vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die ebooks mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert.Bei Kauf in anderen ebook-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Vorwort zur 9. Auflage
Im Jubiläumsjahr 2023, also genau 40 Jahre nach Inkrafttreten des BKleingG, erscheint diese 9. Auflage des bisher als Textsammlung titulierten Werkes. Das Gesetz hat sich in der Praxis bewährt, was sich in seiner langen Gültigkeit zeigt.
Auch diese Auflage berücksichtigt nicht nur die in einigen Bundesländern geänderten landesrechtlichen Bestimmungen zu Kleingärten, sondern in der Einführung auch aktuelle Entwicklungen der Rechtsprechung zum Kleingartenrecht. Außerdem wurde das ab dem 1.1.2025 geltende neue Grundsteuerrecht berücksichtigt.
Der in der 8. Auflage erstmals in diese Textsammlung eingebrachte Beitrag zur sachverständigen Bewertung der kleingärtnerischen Nutzung wurde ebenfalls aktualisiert. Die sachverständigen Feststellungen zur tatsächlichen gärtnerischen Nutzung etc. dienen als Grundlage für die rechtliche Bewertung, ob eine ausreichende gärtnerische Nutzung im Sinne der Rechtsprechung des BGH gegeben ist oder nicht. Deshalb ist es hilfreich zu wissen, wie diese Frage gartenfachlich zu beantworten ist.
Die Gesetze bzw. Vorschriften der ehemaligen DDR, wie das ZGB und das BewertungsG von 1970 sowie das noch im Hinblick auf die Überleitung von Kleingärtnerorganisationen als Zwischenpächter in der damaligen DDR relevante Vereinigungsgesetz von 1990 wurden in der Textsammlung (noch) beibehalten. Das fortgeltende VeränderungsG wurde ebenfalls abgedruckt.
Die auf den aktuellen Stand gebrachte Textsammlung soll allen am Kleingartenrecht Interessierten eine zuverlässige Hilfe und Kurzinformation zum geltenden Kleingartenrecht und den Nebengesetzen an die Hand geben.
St. Ingbert, im Mai 2023
Rechtsanwalt Patrick R. Nessler
Verzeichnis der aktiven Bearbeiter
Rechtsanwalt Patrick R. Nessler ist seit rund 25 Jahren auf den Gebieten des Kleingartenrechts sowie des Vereins- und Gemeinnützigkeitsrechts tätig. Seine Kanzlei hat ihren Sitz in St. Ingbert im Saarland. Er ist Mitglied der Arbeitsgruppe Recht und des Wissenschaftlichen Beirates des Bundesverbandes Deutscher Gartenfreunde e. V. sowie Verbandsanwalt mehrerer Landesverbände der Kleingärtner.
Seit der 12. Auflage bearbeitet Rechtsanwalt Nessler den einzigen aktuellen Kommentar zum BKleingG („Mainczyk/Nessler, Bundeskleingartengesetz, Praktiker-Kommentar“, 13. Auflage 2023) und veröffentlicht regelmäßig in den verschiedensten Publikationen. Er ist außerdem häufig als Referent für Vorträge, Seminare und Workshops zum Kleingartenrecht sowie zum Vereins- und Gemeinnützigkeitsrecht tätig.
(Einführung Teil A und Teil C Photovoltaik)
Dipl.-Wirtsch.-Ing (FH) Thomas Bauer ist nach seinem Studium des Agrarmanagement & Agrarmarketing mit Schwerpunkt Gartenbau als öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger der Regierung von Schwaben für das Fachgebiet „Haus- und Kleingärten“ tätig und arbeitet zusätzlich in einem eigenen Sachverständigenbüro. Er ist dabei auch als zertifizierter Baumkontrolleur, Umweltbaubegleiter und Sachkundiger für Baumhabitatstrukturen tätig. Neben der Wertermittlung und Schadensfeststellung gehören auch die Themen des Garten- und Landschaftsbaus, wie z. B. die Abnahme, zu seinem breiten Tätigkeitsfeld (siehe auch www.gartenbewertung.de).
Herr Bauer hat bei den Genehmigungsverfahren mehrerer Wertermittlungsrichtlinien für das Kleingartenwesen mitgewirkt und ist außerdem Mitautor zahlreicher Publikationen.
(Einführung Teil B und Teil C Wohnen in der Laube)
Inhaltsverzeichnis
Vorwort zur 9. Auflage
Bearbeiterverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Einführung
Teil A
Einleitung
1.
Anwendungsbereich
1.1
Kleingartenbegriff
(1)
Kleingärtnerische Nutzung
(2)
Kleingartenanlage
(3)
Baulichkeiten
1.2
Abgrenzung von anderen ähnlichen Nutzungsarten
1.3
Dauerkleingärten
1.4
Eigenheime und vergleichbare Baulichkeiten in Kleingartenanlagen
2.
Gartenlauben und ihre Nutzung
3.
Kleingartenpachtverträge
3.1
Gestufte Pachtverhältnisse (Zwischenpacht)
3.2
Kleingärtnerische Gemeinnützigkeit
3.3
Vertragsdauer
3.4
Pachtzins und Nebenleistungen
3.4.1
Pachtobergrenze
3.4.2
Zwischenpächterzuschlag
3.4.3
Ermittlung des Pachtzinses und Anpassung an den Höchstpachtzins
3.4.4
Erstattung der Aufwendungen des Verpächters für die Kleingartenanlage
3.4.5
Kostenüberwälzung der öffentlich-rechtlichen Lasten auf die Kleingärtner
a)
Grundsteuer
b)
Beiträge
c)
Gebühren
3.5
Kündigung
3.5.1
Fristlose Kündigung
3.5.2
Ordentliche Kündigung
a)
Nicht unerhebliche Pflichtverletzungen
b)
Neuordnung der Kleingartenanlage
c)
Eigenbedarfskündigung
d)
Andere wirtschaftliche Verwertung
e)
Planverwirklichung
3.5.3
Kündigungsfrist
3.5.4
Kündigung von Zwischenpachtverträgen
3.6
Kündigungsentschädigung
4.
Bereitstellung und Beschaffung von Ersatzland
5.
Zwangsweise Begründung in Pachtverhältnissen
6.
Überleitung der Kleingartenpachtverträge in den alten Ländern bei Inkrafttreten des BKleingG
7.
Sonderregelungen in den neuen Ländern
7.1
Überleitung der Kleingartennutzungsverhältnisse
7.2
Eigentum an baulichen Anlagen in Kleingärten
7.3
Kleingartenpachtverträge über gemeindeeigene und sonstige Grundstücke
7.4
Zwischenpachtprivileg
7.5
Pachtzinsen
7.6
Bestandsschutz
7.7
Neuregelung der Zwischenpachtverhältnisse/Vertragseintritt des Grundstückseigentümers
Teil B
Einführung in die Bewertung von Kleingärten
1.
Gartengestaltung
2.
Beurteilung der Nutzungsformen in der Kleingartenanlage
3.
Beurteilung des Zustandes einer Kleingartenparzelle
4.
Entschädigung
5.
Verkehrssicherheit von Bäumen
Teil C
Aktuelle Themen im Kleingarten
1.
Photovoltaik in Kleingartenanlagen
2.
Prüfung dauerhaftes Wohnen
Gesetzestexte
1.
Bundeskleingartengesetz
2.
Gesetz zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes
3.
Gesetz zur Änderung schuldrechtlicher Bestimmungen im Beitrittsgebiet
4.
Bürgerliches Gesetzbuch
5.
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
6.
Gesetz zur Sachenrechtsbereinigung im Beitrittsgebiet
7.
Baugesetzbuch
8.
Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege
9a.
Bewertungsgesetz
9b.
Bewertungsgesetz der ehemaligen DDR
10.
Grundsteuergesetz
11.
Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen
12.
Zivilgesetzbuch der ehemaligen DDR
13.
Gesetz über Vereinigungen (Vereinigungsgesetz) der ehemaligen DDR
14.
Erste Durchführungsverordnung zum Vereinigungsgesetz der ehemaligen DDR
Anhang
1.
Bauordnungen der Länder
2.
Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
3.
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Länder zum Kleingartenrecht
Stichwortverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Abs.
Absatz
a. F.
alte Fassung
ABl
Amtsblatt
AG
Amtsgericht
Art.
Artikel
BauGB
Baugesetzbuch
BauNVO
Baunutzungsverordnung
BauO
Bauordnung
BauR
Baurecht, Zeitschrift für das gesamte öffentliche und private Baurecht (Jahr, Seite)
BauROG
Bau- und Raumordnungsgesetz
BauZVO
Verordnung zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung und der Investitionen in den Gemeinden (Bauplanungs- und Zulassungsverordnung) vom 20.6.1990 – GBl I DDR S. 739 –
BayBO
Bayerische Bauordnung
BDG
Bundesverband Deutscher Gartenfreunde
BewG
Bewertungsgesetz
BFH
Bundesfinanzhof
BGB
Bürgerliches Gesetzbuch
BGBl
Bundesgesetzblatt
BGH
Bundesgerichtshof
BGHZ
Entscheidungen des BGH in Zivilsachen
BKleingÄndG
Gesetz zur Änderung des Bundeskleingartengesetzes
BKleingG
Bundeskleingartengesetz
BMBau
Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau
BR
Bundesrat
BStBl
Bundessteuerblatt
BT-Drs.
Bundestags-Drucksache
BVerfG
Bundesverfassungsgericht
DVBl
Deutsches Verwaltungsblatt (Jahr, Seite)
EGBGB
Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EGZGB
Einführungsgesetz zum Zivilgesetzbuch
ff.
fortfolgende
GBl
Gesetzblatt
GG
Grundgesetz
GMBl
Gemeinsames Ministerialblatt
GVBl
Gesetz- und Verordnungsblatt
i. d. F.
in der Fassung
KAG
Kommunalabgabengesetz
KGO
Kleingarten- und Kleinpachtlandordnung vom 31.7.1919
LandAnpG
Landwirtschaftsanpassungsgesetz
LG
Landgericht
LPG
Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft
MinBl (MBl)
Ministerialblatt
NJ
Neue Justiz, Zeitschrift für Rechtsentwicklung und Rechtsprechung in den Neuen Ländern
NJW
Neue Juristische Wochenschrift
Nr.
Nummer
n. v.
nicht veröffentlicht
NW
Nordrhein-Westfalen
OLG
Oberlandesgericht
OVG
Oberverwaltungsgericht
Rn.
Randnummer
s.
siehe
S.
Seite
SchuldRAnpG
Schuldrechtsanpassungsgesetz
SchuldRÄndG
Schuldrechtsänderungsgesetz
StAnz
Staatsanzeiger
Urt.
Urteil
VermG
Vermögensgesetz, Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen
VGH
Verwaltungsgerichtshof
vgl.
vergleiche
VKSK
Verband der Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (in der ehemaligen DDR)
V/VO
Verordnung
z. B.
zum Beispiel
ZGB
Zivilgesetzbuch der ehemaligen DDR
ZOV
Zeitschrift für offene Vermögensfragen
ZPO
Zivilprozessordnung
Einführung
Teil AEinleitung
1.Anwendungsbereich
Das Bundeskleingartengesetz (BKleingG) ist Sonderrecht. Es fasst das bundesrechtlich geregelte materielle Kleingartenrecht in einem Gesetz zusammen. Es ist ein in sich geschlossenes, vom öffentlichen Recht her bestimmtes einheitliches Rechtsgebiet mit zivilrechtlichen Inhalten und findet nur auf Pachtverträge über Kleingärten i. S. dieses Gesetzes Anwendung. Was ein Kleingarten i. S. d. Gesetzes ist, ergibt sich aus den Bestimmungen des § 1 BKleingG.
1.1Kleingartenbegriff
Nach § 1 Abs. 1 BKleingG ist ein Kleingarten eine Grundstücksfläche, die dem Nutzer (Kleingärtner) zur nichterwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung, insbesondere zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen für den Eigenbedarf und zur Erholung auf Grund eines schuldrechtlichen Vertrages – in der Regel eines Pachtvertrages – überlassen worden ist (kleingärtnerische Nutzung). Diese Grundstücksfläche muss in einer Anlage liegen, in der mehrere Einzelgärten mit gemeinschaftlichen Einrichtungen, z. B. Wegen, Spielflächen, Vereinshäusern zusammengefasst sind (Kleingartenanlage). Wesensmerkmal des Kleingartens ist die Nutzung fremden Landes (BVerfGE 52, 1, 32). Diese Begriffsmerkmale grenzen den Kleingarten gegenüber anderen Formen der (gärtnerischen) Nutzung (z. B. Fallobstwiese, Freizeitgrundstück, Acker) von auf Grund eines schuldrechtlichen Vertrages überlassenen Grundstücken ab.
(1)Kleingärtnerische Nutzung
Die nichterwerbsmäßige gärtnerische Nutzung ist ein zentrales Merkmal des Kleingartens. Sie umfasst die Erzeugung von Obst, Gemüse und anderen Früchten durch Selbstarbeit des Kleingärtners oder seiner Familienangehörigen. Kennzeichnend für diese Nutzungsart ist die Vielfalt der Gartenbauerzeugnisse, die zumindest teilweise für mehrere Jahre angelegt sein muss (BGH VIZ 2000, 149). Sie ist eine zwingende Voraussetzung der Kleingarteneigenschaft. Zweites Element der kleingärtnerischen Nutzung ist die Erholungsfunktion des Kleingartens. Erholung i. S. d. BKleingG ist sowohl die gärtnerische Betätigung als solche, als auch Ruhe und Entspannung. Die Erzeugung von Obst, Gemüse und anderen Früchten muss bei der Nutzung aber prägend sein. Die Gartenfläche darf also, wenn es ein Kleingarten sein soll, nicht allein oder fast ausschließlich aus Rasenbewuchs und Zierbepflanzung bestehen. Die Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen ist ein notwendiges prägendes Merkmal des Kleingartens (BGH NJW-RR 2004, 1241 ff.).
(2)Kleingartenanlage
Der Garten muss ferner, um ein Kleingarten i. S. d. BKleingG zu sein, in einer Kleingartenanlage liegen. Diese ist nach § 1 Abs. 1 Nr. 2 BKleingG nur gegeben, wenn in der Anlage mehrere Einzelgärten – die absolute Untergrenze liegt nach dem BGH bei fünf Pachtparzellen (BGH NZM 2006, 18 f.) – mit gemeinschaftlichen Einrichtungen zusammengefasst sind. Das Gesetz nennt als Gemeinschaftseinrichtungen beispielhaft Wege, Spielflächen und Vereinshäuser. Eine Gemeinschaftseinrichtung genügt, um die Eigenschaft „Kleingartenanlage“ zu begründen. Ein schmaler kurzer Stichweg ist allerdings keine gemeinschaftliche Einrichtung (BGH a.a.O.). Kleingärtnerisch genutzte Flächen außerhalb einer Kleingartenanlage sind keine Kleingärten i. S. des BKleingG.
Der Kleingartencharakter einer Anlage setzt nach der Rechtsprechung des BGH darüber hinaus voraus, dass in der Regel wenigstens ein Drittel der Fläche zum Anbau von Gartenerzeugnissen für den Eigenbedarf genutzt wird (BGH NJW-RR 2004, 1241). Bei der Feststellung des Anteils der Nutzung zum Anbau von Gartenerzeugnissen für den Eigenbedarf ist auf die Gesamtheit der an Dritte überlassenen oder zur Überlassung vorgesehene Parzellen – ohne Einbeziehung der Gemeinschaftsflächen – abzustellen, nicht auf die Gesamtfläche der Kleingartenanlage (OLG München Urt. v. 19.8.2021 – 32 U 3372/17, BeckRS 2021, 43655). Abweichungen vom Regelfall können sich aus der Größe der Kleingartenanlage mit flächenmäßig großzügigen Gemeinschaftseinrichtungen ergeben, z. B. bei sog. Kleingartenparks.
(3)Baulichkeiten
Für die rechtliche Einordnung einer Anlage spielen auch die Beschaffenheit und die Art der Nutzung der auf den Parzellen befindlichen Baulichkeiten eine wesentliche Rolle. S. hierzu Nr. 1.4.
1.2Abgrenzung von anderen ähnlichen Nutzungsarten
Nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BKleingG sind Eigentümergärten keine Kleingärten. Gemeint sind hiermit Gärten, die der Eigentümer des Grundstücks selbst nutzt oder durch die Haushaltsangehörigen im Sinne des § 18 des Wohnraumförderungsgesetzes nutzen lässt. Keine Kleingärten sind ferner Wohnungsgärten und Arbeitnehmergärten. Die Rechtsverhältnisse dieser Gärten richten sich nach den für das Hauptvertragsverhältnis (Wohnraummietvertrag bzw. Arbeitsvertrag) geltenden Vorschriften.
Charakteristisch für die kleingärtnerische Nutzung ist der Anbau verschiedener Kulturen (BGH VIZ 2000, 149). Grundstücke, auf denen vertraglich nur wenige bestimmte Erzeugnisse angebaut werden dürfen, sind daher keine Kleingärten, z. B. Obstplantagen. Ebenfalls keine Kleingärten sind Grundstücksflächen, die vertraglich nur mit einjährigen Pflanzen bestellt werden dürfen (Grabeland).
Abzugrenzen sind auch Kleingartenanlagen von anderen Gartenkomplexen, z. B. von Freizeit- und Erholungsanlagen. Eine Kleingartenanlage i. S. des BKleingG liegt nur dann vor, wenn die Nutzung der Parzellen zur Gewinnung von Gartenbauerzeugnissen den Charakter der Anlage maßgeblich prägt. Die Kleingarteneigenschaft ist jedenfalls anzunehmen, wenn ein Drittel der Gesamtfläche der an Dritte überlassenen oder zur Überlassung vorgesehenen Parzellen – ohne Einbeziehung der Gemeinschaftsflächen – nicht die Gesamtfläche der Kleingartenanlage (OLG München Urt. v. 19.8.2021 – 32 U 3372/17, BeckRS 2021, 43655) – für den Anbau von Obst, Gemüse und anderen Früchten verwendet wird (S. zu den Anforderungen an die Baulichkeiten Nr. 1.4). In Einzelfällen wird diese Grenze unterschritten werden, wenn Besonderheiten vorliegen (Topographie, Bodenqualität u. Ä.).
Die Wochenendsiedlergärten in den neuen Ländern sind ebenfalls keine Kleingärten i. S. d. BKleingG. Hierbei handelt es sich um Grundstücksflächen, die der Erholung und Freizeitgestaltung dienen und mit den dieser Zweckbestimmung dienenden Baulichkeiten (Datschen, Bungalow) bebaubar waren. Nach der Ordnung für Wochenendsiedlungen des Verbandes für Kleingärtner, Siedler und Kleintierzüchter (VKSK) in der ehemaligen DDR (Beschluss des Präsidiums des Zentralvorstandes vom 21.6.1985) waren die Möglichkeiten zur Erzeugung von Obst und Gemüse lediglich „zu nutzen“. Diese Vertragsverhältnisse sind durch Art. 1 des Schuldrechtsänderungsgesetzes (SchuldRAnpG) gesetzlich neu geregelt worden.
1.3Dauerkleingärten
Dauerkleingärten sind nach § 1 Abs. 3 BKleingG Kleingärten auf einer Fläche, die im Bebauungsplan für Kleingärten festgesetzt ist (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB). Nur im Flächennutzungsplan ausgewiesene „Dauerkleingärten“ (§ 5 Abs. 2 Nr. 5 BauGB) sind keine Dauerkleingärten i. S. d. BKleingG. Der kleingartenrechtliche Begriff „Dauerkleingärten“ und der gleiche Begriff im Baugesetzbuch sind nicht deckungsgleich. Gemeinsam ist dem bauplanungsrechtlichen und kleingartenrechtlichen Begriff, dass hierunter nur solche kleingärtnerisch genutzten Flächen fallen, die auf Grund von Pacht- oder ähnlichen Verträgen kleingärtnerisch bewirtschaftet werden.
Die Differenzierung des BKleingG zwischen Dauerkleingärten und anderen Kleingärten ergibt sich aus der rechtlichen Natur des Bebauungsplans. Der Bebauungsplan ist Ortsgesetz. Er wird von der Gemeinde als Satzung beschlossen und enthält die rechtsverbindlichen Festsetzungen für die städtebauliche Ordnung und Entwicklung in einem Teil der Gemeinde. Der Bebauungsplan hat daher Rechtsnormcharakter.
Der Flächennutzungsplan dagegen ist nur ein vorbereitender Bauleitplan. Er enthält keine rechtsverbindlichen Nutzungsregelungen, sondern lediglich richtungsweisende Darstellungen, aus denen die rechtsverbindlichen Festsetzungen des Bebauungsplans (erst) zu entwickeln sind.
1.4Eigenheime und vergleichbare Baulichkeiten in Kleingartenanlagen
Die kleingärtnerische Nutzung ist ein zentrales aber nicht das alleinige Entscheidungskriterium der Kleingarteneigenschaft einer Gartenparzelle oder eines Gartenkomplexes als Kleingartenanlage. Insoweit stellt das Urteil des BGH (NZM 2003, 913 ff.) klar, dass es nicht allein auf die kleingärtnerische Nutzung ankommt, sondern auch auf die vorhandenen Baulichkeiten in den Gartenparzellen.
Bauplanungsrechtlich ist die kleingärtnerische Nutzung als Grünflächennutzung zu bewerten. Sie schließt aber eine ihr dienende und in Umfang und Art beschränkte bauliche Nutzung nicht aus. Zulässig sind jedoch nur solche baulichen Anlagen, die der kleingärtnerischen Nutzung dienen und von ihrer Funktion der kleingärtnerischen Nutzung auch räumlich-gegenständlich zu- und untergeordnet sind. Es handelt sich hierbei um bauliche Anlagen, die im Hinblick auf die Hauptnutzung, die kleingärtnerische Nutzung, lediglich eine Hilfsfunktion haben. Das sind vor allem Gartenlauben, die den Anforderungen des § 3 Abs. 2 BKleingG entsprechen und sonstige der kleingärtnerischen Nutzung dienende bauliche Anlagen, z. B. Gewächshäuser usw.
Nicht zulässig sind dem Wohnen dienende oder auch nur zum Wohnen geeignete Gebäude (Eigenheime) sowie vergleichbare Bauwerke. Denn diese dienen nicht der kleingärtnerischen Nutzung und sind insoweit auch keine ihr untergeordnete bauliche Anlage. Diese Baulichkeiten können die Kleingartenanlage derart beeinflussen, dass der Gartenkomplex nicht mehr als Kleingartenanlage i. S. d. § 1 Abs. 1 BKleingG angesehen werden kann. Das ist der Fall, wenn mehr als die Hälfte der Parzellen mit Eigenheimen oder diesen nahe kommenden Baulichkeiten bebaut ist (BGHZ 156, 71). Der Kleingartencharakter einer Anlage kann im Einzelfall aber auch dann zu verneinen sein, wenn weniger als die Hälfte der Parzellen mit derartigen Gebäuden bebaut ist (BGH NJ 2004, 464). Das gilt vor allem dann, wenn weitere Umstände hinzutreten, die die Anlage nicht mehr als Kleingartenanlage, sondern als Siedlungsgebiet erscheinen lassen, wenn die Anlage z. B. von einer Straße durchquert wird, an der diese Baulichkeiten liegen. Entscheidend für die Einordnung eines Gebäudes in der Gartenparzelle als Eigenheim ist die Wohnhausqualität (bei in den neuen Bundesländern gelegenen Kleingärten nach den Maßstäben des DDR-Rechts). Hierzu gehören die bautechnischen (Mindest-)Anforderungen: Heizung, Sanitäranschluss, Stromanlagen, usw.
2.Gartenlauben und ihre Nutzung
Gartenlauben sind zwar kein notwendiger Bestandteil der kleingärtnerischen Nutzung, aber seit jeher im Kleingartenwesen üblich.
§ 3 Abs. 2 BKleingG enthält einige Regelungen über Gartenlauben. Danach ist eine Laube in einfacher Ausführung mit höchstens 24 m² Grundfläche einschließlich überdachtem Freisitz zulässig. Diese Höchstgrenze der Grundfläche kann durch Festsetzungen im Bebauungsplan oder auch durch vertragliche Vereinbarungen zwischen dem Kleingärtner und seinem Verpächter unterschritten werden, nicht aber überschritten. Zulässig ist ferner nur eine Laube in einfacher Ausführung, d. h. unter Verwendung von kostengünstigen Baustoffen und Bauteilen mit konstruktiv einfachen, auf die Funktion der Laube abgestellten Ausbaumaßnahmen. Darüber hinaus darf die Laube nach ihrer Beschaffenheit, insbesondere nach ihrer Ausstattung und Einrichtung, nicht zum dauernden Wohnen geeignet sein. Lauben sollen nur einen vorübergehenden Aufenthalt ermöglichen. Nach geltendem Recht ist die Ausstattung der Laube mit Ver- und Entsorgungseinrichtungen (Strom, Gas, Wasser und Abwasserbeseitigung) nicht zulässig. Im Gesetzgebungsverfahren zur Änderung des BKleingG hat der Deutsche Bundestag einen Antrag, die Ver- und Entsorgungseinrichtungen in Gartenlauben für zulässig zu erklären, unter Hinweis auf verfassungsrechtliche Bedenken ausdrücklich abgelehnt (BT-Drs. 12/6782 S. 8). Das BVerfG hat die Zulässigkeit von Ver- und Entsorgungseinrichtungen in Gartenlauben im geltenden kleingartenrechtlichen Regelungssystem (Pachtpreisbindung) verfassungsrechtlich grundsätzlich ausgeschlossen (BVerfG NJW-RR 1998, 1166 f.).
Zulässig sind Anschlusseinrichtungen zur Versorgung der Kleingärtner mit Arbeitsstrom zum Betrieb von Gartengeräten in den einzelnen Kleingärten. Dabei muss jedoch sichergestellt sein, dass die Einzelgärten nicht auf Dauer mit Elektrizität versorgt werden. Das kann dadurch geschehen, dass z. B. die Kleingärten nur tagsüber, zentral gesteuert, Arbeitsstrom erhalten. Voraussetzung für solche Anschlusseinrichtungen ist das Einvernehmen zwischen Pächter und Verpächter. Grundsätzlich hat weder der Pächter einen Anspruch auf Arbeitsstrom noch ist der Verpächter verpflichtet, entsprechenden Wünschen der Pächter nachzukommen. Die Stromversorgung des Vereinsheims gehört dagegen zur funktionsgerechten Nutzbarkeit dieser baulichen Anlage.
Der Wasseranschluss ist im Kleingarten ebenfalls zulässig, aber nicht in der Gartenlaube, weil ein Wasseranschluss in der Laube deren Geeignetheit zum Wohnen fördert. Die Gartenlaube ist kein dem Wohnen dienendes Gebäude, das mit Trink- und/oder Brauchwasser zu versorgen ist. Aus dem gleichen Grund ist auch ein Anschluss der Laube an die Abwasserentsorgungseinrichtungen oder die Errichtung einer wasserdichten Grube für diese unzulässig. Trockentoiletten dürfen grundsätzlich verwendet werden, da bei ihnen kein Abwasser anfällt.
Nicht betroffen von diesen Einschränkungen sind Lauben, die vor dem Inkrafttreten des BKleingG (zum 01.04.1983 in den alten und zum 03.10.1990 in den neuen Bundesländern) rechtmäßig mit solchen Ver- und Entsorgungseinrichtungen versehen gewesen sind. Der Bestandsschutz gilt ferner für Wohnlauben oder früher rechtmäßig zum Wohnen genutzte Lauben und für Vereinsheime.
3.Kleingartenpachtverträge
Die Kleingartenpacht ist in den §§ 4 bis 13 BKleingG wegen der sozialpolitischen und städtebaulichen Funktion des Kleingartenwesens sondergesetzlich geregelt. Diese Sonderregelungen gehen dem allgemeinen Pachtrecht des BGB vor. Soweit das BKleingG keine einschlägige Regelung enthält, richten sich die vertraglichen Beziehungen zwischen Verpächter und Pächter gemäß § 4 Abs. 1 BKleingG nach den Vorschriften des BGB über die Pacht (§§ 581 ff. BGB). Da § 581 Abs. 2 BGB auf Vorschriften über die Miete verweist, gelten auch die §§ 535 ff. BGB entsprechend und über § 578 Abs. 1 BGB sogar einige Vorschriften des Wohnraummietrechts. Ansonsten findet das Wohnraummietrecht auf den Kleingartenpachtvertrag keine Anwendung.
Kleingartenpachtrechtliche Sonderregelungen enthält das BKleingG über
-
die Zwischenpacht und die Übertragung der Verwaltung einer Kleingartenanlage (§ 4 BKleingG),
-
den Pachtzins und die Überwälzung der auf dem Kleingartengrundstück ruhenden öffentlich-rechtlichen Lasten auf die Pächter (§ 5 BKleingG),
-
die Vertragsdauer bei Dauerkleingärten und die Schriftform der Kündigung (§§ 6 und 7 BKleingG),
-
die Kündigung des Kleingartenpachtvertrages durch den Verpächter (§§ 8 – 10 BKleingG),
-
die Beendigung des Kleingartenpachtvertrages bei Tod des Kleingärtners (§ 12 BKleingG) und
-
die Nichtigkeit von Vertragsvereinbarungen bei Abweichung von den pachtrechtlichen Sondervorschriften des BKleingG zum Nachteil des Pächters (§ 13 BKleingG).
Neben den Vorschriften des Miet- und Pachtrechts finden auf Kleingartenpachtverhältnisse auch die anderen einschlägigen Bestimmungen des BGB Anwendung. Das gilt insbesondere für die Vorschriften des Allgemeinen Teils, des Rechts der Schuldverhältnisse inklusive des Rechts der allgemeinen Geschäftsbedingungen und des Sachenrechts des BGB.
3.1Gestufte Pachtverhältnisse (Zwischenpacht)
Die Nutzung von Kleingärten erfolgt in der Regel auf Grund gestufter Pachtverhältnisse. Auch mehrfach gestufte Pachtverhältnisse sind in der Praxis anzutreffen und rechtlich zulässig (BGH NJW 1993, 55 ff.). Das BKleingG trägt dieser Praxis Rechnung, indem es in § 4 Abs. 2 Satz 1 bestimmt, dass die Vorschriften über Kleingartenpachtverträge auch für Zwischenpachtverträge gelten.
Der Begriff „Zwischenpacht“ ist entsprechend dem Schutzzweck des Gesetzes weit auszulegen. Er umfasst alle Vereinbarungen, die eine kleingärtnerische Nutzung i. S. d. § 1 Nr. 1 BKleingG zum Gegenstand haben (BGH NJW 1987, 2865).
Der Zwischenpächter hat eine doppelte Rechtsstellung. Er ist Pächter im Zwischenpachtverhältnis und Verpächter bei einem Einzelpachtvertrag oder einem weiteren Zwischenpachtvertrag. Zwischenpächter kann nur die Gemeinde oder eine als kleingärtnerisch gemeinnützig anerkannte Kleingärtnerorganisation sein (§§ 2, 4 BKleingG). Der Zwischenpächter kann sich eines Beauftragten zur Weiterverpachtung von Kleingartenland bedienen. In der Praxis wird häufig so verfahren. Wenn die Tätigkeit des Beauftragten die Verwaltung der Kleingartenanlage ist, muss auch der Beauftragte eine als kleingärtnerisch gemeinnützig anerkannte Kleingärtnerorganisation sein.
3.2Kleingärtnerische Gemeinnützigkeit
Nach § 4 Abs. 2 Satz 2 BKleingG sind Zwischenpachtverträge nichtig, wenn sie nicht mit der Gemeinde oder einer als kleingärtnerisch gemeinnützig anerkannten Kleingärtnerorganisation (Zwischenpachtprivileg) geschlossen sind. Sie werden aber wirksam, wenn die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit nach Vollzug des Vertrages anerkannt wird (BGH NJW 1987, 2865). Dieses „Zwischenpachtprivileg“ soll die Kleingärtner vor der Ausnutzung durch einen gewerbsmäßigen Zwischenpächter schützen. Als kleingärtnerisch gemeinnützig anerkannte Kleingärtnerorganisationen bieten sie eine Gewähr dafür, dass die Aufgaben, die ein Zwischenpächter zu erfüllen hat, sachgerecht und im Interesse der Kleingärtner und des Kleingartenwesens wahrgenommen werden. Das setzt aber andererseits voraus, dass bestimmte Garantien gegeben sein müssen. Diese sind in der Vorschrift des § 2 BKleingG über die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit (abschließend) geregelt.
Nach § 2 BKleingG wird eine Kleingärtnerorganisation von der für sie zuständigen Landesbehörde als gemeinnützig anerkannt, wenn sie im Vereinsregister eingetragen ist, sich der regelmäßigen Prüfung der Geschäftsführung unterwirft und wenn die Satzung bestimmt, dass die Kleingärtnerorganisation ausschließlich oder überwiegend die Förderung des Kleingartenwesens sowie die fachliche Betreuung ihrer Mitglieder bezweckt, erzielte Einnahmen kleingärtnerischen Zwecken zugeführt werden und bei der Auflösung der Organisation deren Vermögen für kleingärtnerische Zwecke verwendet wird. Liegen diese Voraussetzungen vor, dann hat die Kleingärtnerorganisation einen Rechtsanspruch, als kleingärtnerisch gemeinnützig anerkannt zu werden.
Die Voraussetzung für den Entzug der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit regelt das BKleingG nicht. Diese ergeben sich aber im Wege des Umkehrschlusses aus den Anerkennungsvoraussetzungen.
Das Verfahren der Anerkennung und des Entzugs der kleingärtnerischen Gemeinnützigkeit sowie die Gemeinnützigkeitsaufsicht regeln die Bundesländer. Die Fundstellen sind in dieser Textsammlung abgedruckt. Soweit die Bundesländer keine speziellen Regelungen dafür erlassen haben, richtet sich das Verfahren nach dem jeweiligen Verwaltungsverfahrensgesetz des betreffenden Bundeslandes. Die Aufsicht erstreckt sich auf die Einhaltung der materiellen Anerkennungsvoraussetzungen, insbesondere auch darauf, ob die Führung der Geschäfte mit den Regelungen des BKleingG und den aus § 2 BKleingG resultierenden Bestimmungen der Satzung in Übereinstimmung steht.
Die kleingärtnerische Gemeinnützigkeit ist von der steuerlichen Gemeinnützigkeit zu unterscheiden. Die steuerliche Gemeinnützigkeit begünstigt steuerlich den Einsatz von Kapital und Arbeit zur Erfüllung gemeinnütziger Zwecke, sofern dieser Einsatz selbstlos, d. h. nicht zu Erwerbszwecken, erfolgt. Die Ausgestaltung der Steuervergünstigung ist den Einzelsteuergesetzen vorbehalten.
3.3Vertragsdauer
Nach § 6 BKleingG können Kleingartenpachtverträge über Dauerkleingärten nur auf unbestimmte Zeit geschlossen werden. Befristet abgeschlossene Verträge sind nicht unwirksam, sondern gelten als auf unbestimmte Dauer geschlossen. Unbefristet ist die Pachtzeit, wenn aus den Vereinbarungen der Parteien der Zeitpunkt der Beendigung der Pacht weder unmittelbar noch mittelbar hervorgeht. Ein zeitlich befristeter Vertrag mit unbegrenzter automatischer Verlängerungsklausel ist wie ein auf unbestimmte Zeit geschlossener Vertrag mit vereinbarter Kündigungsfrist zu behandeln (BGH NJW 1991, 1348).
Die Dauer von Verträgen über Kleingärten, die nicht im Bebauungsplan als Dauerkleingärten festgesetzt sind (s. o. Nr. 1.3), ist der Vereinbarung der Parteien überlassen.
3.4Pachtzins und Nebenleistungen
3.4.1Pachtobergrenze
Nach § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG darf als Pachtzins höchstens der vierfache Betrag des ortsüblichen Pachtpreises im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau – bezogen auf die gesamte Fläche der Kleingartenanlage – verlangt werden. Dabei sind die auf gemeinschaftliche Einrichtungen, z. B. Wege, Spielflächen usw., entfallenden Flächen bei der Ermittlung des Pachtzinses für den einzelnen Kleingarten anteilig zu berücksichtigen (§ 5 Abs. 1 Satz 2 BKleingG). Das BVerfG (NJW-RR 1998, 1166) hat in seiner Entscheidung vom 25. Februar 1998 festgestellt, dass diese mit der Novelle des BKleingG vom 8. April 1994 (BGBl I S. 766) eingeführte Pachtzinsregelung verfassungskonform ist.
Zu ermitteln ist die ortsübliche Pacht im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau. Das ist der in der betreffenden Gemeinde durchschnittlich für solche Flächen gezahlte Pachtzins (§ 5 Abs. 1 Satz 4 BKleingG). Auskünfte über den örtlichen Pachtzins im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau können die für die Anzeige von Landpachtverträgen zuständigen Behörden erteilen. Liegen ortsübliche Pachtpreise nicht vor, so ist der entsprechende Pachtzins einer vergleichbaren Gemeinde als Bemessungsgrundlage zugrunde zu legen. Vergleichbar sind Gemeinden gleicher Größenordnung und gleicher Wirtschaftsstruktur. Kriterien für die Vergleichbarkeit können sich aus raumordnerischen und landesplanungsrechtlichen Gesichtspunkten ergeben im Hinblick auf die zentralörtliche Gliederung der Gemeinden in Ober-, Mittel-, Grund- und Unterzentren entsprechend den Landesplanungsgesetzen bzw. Landesentwicklungsplänen. Verglichen werden zunächst die Gemeinden innerhalb des jeweiligen Landes. Erst dann, wenn innerhalb des Landes keine vergleichbaren Gemeinden ermittelt werden können, kann auf vergleichbare Gemeinden in anderen Bundesländern zurückgegriffen werden.
Die Vorschrift des § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG regelt lediglich den zulässigen Höchstpachtzins. Die Vertragsparteien können selbstverständlich auch Pachtzinsen vereinbaren, die unter der gesetzlich zulässigen Höchstpacht liegen. Überschreitet dagegen der vereinbarte Pachtzins zum Zeitpunkt der Einigung die gesetzlich zulässige Höchstgrenze, ist die Vereinbarung insoweit nichtig (§ 13 BKleingG). An die Stelle des vereinbarten (überhöhten) Pachtzinses tritt der Höchstpachtzins des § 5 Abs. 1 Satz 1 BKleingG (BGH BGHZ 108, 147, 150). Im Übrigen bleibt der Pachtvertrag in diesen Fällen unverändert.
3.4.2Zwischenpächterzuschlag
Der Zwischenpächter kann den im Zusammenhang mit der Verwaltung der Kleingartenanlage entstehenden Aufwand dadurch ausgleichen, dass er mit dem Eigentümer als Verpächter der Kleingartenflächen einen Pachtzins unter der gesetzlichen Pachtobergrenze vereinbart, von den Kleingärtnern dagegen den zulässigen Höchstpachtzins verlangt. Ist ein solcher Zwischenpächterzuschlag nicht mehr möglich, weil die Höchstgrenze für die Pacht bereits bei der Zwischenpacht erreicht ist, dann kann der Zwischenpächter seine Aufwendungen für die Kleingartenanlage über die Mitgliedsbeiträge finanzieren. Soweit in Ausnahmefällen ein Kleingärtner nicht (mehr) Mitglied der Kleingärtnerorganisation ist, kann der Zwischenpächter zur Deckung seines Aufwandes einen Verwaltungsbeitrag (Verwaltungszuschlag) erheben, wenn dies zuvor im Pachtvertrag ausdrücklich vereinbart worden ist. Soweit die Verpachtung einer Gartenparzelle vertraglich erkennbar an die Mitgliedschaft im Kleingärtnerverein geknüpft ist, ist darüber hinaus durch den Austritt oder den Ausschluss aus dem Verein die Geschäftsgrundlage der Verpachtung des Kleingartens gestört und der Vertrag kann nach § 313 BGB insoweit anzupassen sein. Die Anpassung erfolgt durch die Heranziehung zu einem Verwaltungszuschlag.
3.4.3Ermittlung des Pachtzinses und Anpassung an den Höchstpachtzins
Die Pachtpreisermittlung ist grundsätzlich Aufgabe der Vertragsparteien. Einigt man sich über den durchschnittlichen Pachtzins im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau nicht, so hat der nach § 192 BauGB bei den kommunalen Gebietskörperschaften eingerichtete Gutachterausschuss auf Antrag einer der Vertragsparteien ein Gutachten über den Höchstpachtzins zu erstatten. Die Kosten für das Gutachten trägt der Antragsteller. Dieses Gutachten hat keine bindende Wirkung, soweit nichts anderes vereinbart wird. Auch wenn das Gutachten eine rechtlich bindende Wirkung nicht hat, hat es faktisch erhebliche Bedeutung, insbesondere wenn es zum Prozess kommt. Denn im Streitfalle entscheiden die ordentlichen Gerichte über den zulässigen Höchstpachtzins, und das Gutachten gilt dann als Sachverständigenbeweis i. S. d. §§ 402 ff. ZPO.
Da der Gutachterausschuss keine eigene Pachtpreissammlung führt, ist er auf die Auskünfte der für die Anzeige von Landpachtverträgen zuständigen Behörden angewiesen, denen grundsätzlich alle Verträge über die Verpachtung von landwirtschaftlichen und erwerbsgärtnerisch genutzten Flächen mitzuteilen sind. § 5 Abs. 2 Satz 2 BKleingG bestimmt daher, dass die für die Anzeige von Landpachtverträgen zuständigen Behörden auf Verlangen des Gutachterausschusses Auskünfte über den ortsüblichen Pachtzins im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau zu erteilen haben. Diese Pachtpreise müssen anonymisiert werden können; es müssen also mehr als zwei Pachtfälle vorliegen. Liegen anonymisierbare Daten i. S. d. Datenschutzrechts nicht vor, sind ergänzend Pachtzinsen im erwerbsmäßigen Obst- und Gemüseanbau einer vergleichbaren Gemeinde als Bemessungsgrundlage heranzuziehen.
Der Höchstpachtzins nach § 5 Abs. 1 BKleingG knüpft an den Bodenpachtmarkt an. Um diese Anknüpfung auf Dauer sicherzustellen, sieht § 5 Abs. 3 BKleingG die Anpassung des Pachtzinses an veränderte Marktverhältnisse vor. Danach können die Vertragsparteien die Anpassung verlangen, dies aber frühestens nach Ablauf von 3 Jahren seit Vertragsschluss bzw. der vorgehenden Anpassung.
Die Anpassung erfolgt durch einseitige vertragsgestaltende Erklärung in Textform der jeweiligen Vertragspartei, den bisherigen Pachtzins bis zur Höhe des gesetzlich zulässigen Pachtpreises anzuheben oder auch, sofern der bisherige Pachtzins darüber liegt, herabzusetzen. In Textform bedeutet, dass die Erklärung in einer Urkunde oder auf andere zur dauerhaften Wiedergabe in Schriftzeichen geeignete Weise abgegeben, die Person des Erklärenden genannt und der Abschluss der Erklärung durch Nachbildung der Namensunterschrift oder anders erkennbar gemacht werden (§ 126b BGB). Den Nachweis der Veränderung auf dem Pachtzinsmarkt hat derjenige zu erbringen, der eine Herauf- oder Herabsetzung des Pachtzinses erklärt.





























