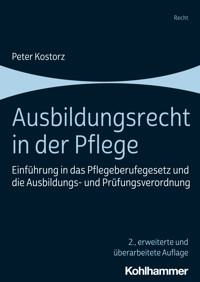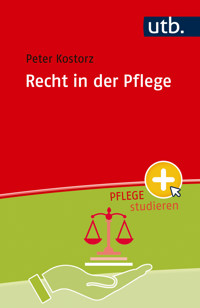
45,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: UTB GmbH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Pflege studieren
- Sprache: Deutsch
Der Titel erklärt die spezifischen Rechte und Pflichten der drei Hauptakteure pflegerischen Handelns: von pflegebedürftigen Menschen, Pflegekräften und Gesundheitseinrichtungen. Welche sozialrechtlichen Ansprüche und Rechte bei deren Umsetzung haben pflegebedürftige Menschen, wie ist eine Patientenverfügung rechtlich geregelt? Wie gestalten sich das Ausbildungs- und das Arbeitsrecht von Pflegekräften und welche rechtlichen Folgen können Pflegefehler nach sich ziehen? Welche pflegerechtlichen Bestimmungen müssen Gesundheitseinrichtungen einhalten? Anhand solcher Fragestellungen wird ein grundlegender und zugleich anschaulicher Einblick in eine noch junge juristische Teildisziplin gegeben. utb+: Zusätzlich zum Buch erhalten Leser:innen online ein Video und Testaufgaben mit Lösungen zur Vertiefung und Prüfungsvorbereitung.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 340
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Eine Arbeitsgemeinschaft der Verlage
Brill | Schöningh – Fink · Paderborn
Brill | Vandenhoeck & Ruprecht · Göttingen – Böhlau · Wien · Köln
Verlag Barbara Budrich · Opladen · Toronto
facultas · Wien
Haupt Verlag · Bern
Verlag Julius Klinkhardt · Bad Heilbrunn
Mohr Siebeck · Tübingen
Narr Francke Attempto Verlag – expert verlag · TübingenPsychiatrie Verlag · Köln
Ernst Reinhardt Verlag · München
transcript Verlag · Bielefeld
Verlag Eugen Ulmer · Stuttgart
UVK Verlag · München
Waxmann · Münster · New York
wbv Publikation · Bielefeld
Wochenschau Verlag · Frankfurt am Main
Pflege studieren
Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. h.c. Andreas Büscher
Peter Kostorz
Recht in der Pflege
Mit 22 Abbildungen und 18 Tabellen Mit Onlinematerial
Ernst Reinhardt Verlag München
Prof. Dr. Peter Kostorz lehrt Rechtswissenschaften mit den Schwerpunkten Gesundheits- und Bildungsrecht am Fachbereich Gesundheit der Fachhochschule Münster.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http: / / dnb.d-nb.de> abrufbar.
UTB-Band-Nr.: 6323
ISBN 978-3-8252-6323-2 (Print)
ISBN 978-3-8385-6323-7 (PDF-E-Book)
ISBN 978-3-8463-6323-2 (EPUB)
© 2024 by Ernst Reinhardt, GmbH & Co KG, Verlag, München
Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne schriftliche Zustimmung der Ernst Reinhardt GmbH & Co KG, München, unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen in andere Sprachen, Mikroverfilmungen und für die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Der Verlag Ernst Reinhardt GmbH & Co KG behält sich eine Nutzung seiner Inhalte für Text- und Data-Mining i. S. v. § 44b UrhG einschließlich Einspeisung/Nutzung in KI-Systemen ausdrücklich vor.
Dieses Werk kann Hinweise/Links zu externen Websites Dritter enthalten, auf deren Inhalt der Verlag keinen Einfluss hat und die der Haftung der jeweiligen Seitenanbieter oder -betreiber unterliegen. Ohne konkrete Hinweise auf eine Rechtsverletzung ist eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten nicht zumutbar. Sollten jedoch entsprechende Rechtsverletzungen bekannt werden, werden die betroffenen externen Links soweit möglich entfernt.
Printed in EU
Einbandgestaltung: Atelier Reichert, Stuttgart
Cover unter Verwendung einer Grafik von © Md Abdul Mannan/stock.adobe.com
Satz: m4p Kommunikationsagentur GmbH, Nürnberg
Ernst Reinhardt Verlag, Kemnatenstr. 46, D-80639 München
Net: www.reinhardt-verlag.de E-Mail: [email protected]
Inhalt
Vorwort
Einleitung
1Grundlagen des Pflegerechts
1.1 Recht in der Pflege – die Theorie
1.1.1 Begriff und Gegenstand des Pflegerechts
1.1.2 Rechtsbereiche und Rechtsquellen
1.2 Recht in der Pflege – die Praxis
1.2.1 Juristische Methodik und Arbeitsweise
1.2.2 Hinweise zu pflegerechtlicher Literatur
2Pflegerecht aus Sicht der Pflegekräfte
2.1 Ausbildungsrecht
2.1.1 Berufliche Pflegeausbildung
2.1.2 Hochschulische Pflegeausbildung
2.2 Berufsrecht
2.2.1 Führen der Berufsbezeichnung
2.2.2 Vorbehaltsaufgaben in der Pflege
2.2.3 Pflegekammern und Berufsordnungen
2.3 Arbeitsrecht
2.3.1 Zustandekommen des Arbeitsverhältnisses
2.3.2 Rechte und Pflichten im Arbeitsverhältnis
2.3.3 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
2.4 Zusammenarbeit mit anderen Gesundheitsfachberufen
2.4.1 Personelle Arbeitsteilung im Gesundheitswesen
2.4.2 Delegation und Substitution von ärztlichen Tätigkeiten
2.5 Folgen von Pflegefehlern und sonstigem Fehlverhalten
2.5.1 Zivilrechtliche Haftung
2.5.2 Strafrechtliche Verantwortung
3 Pflegerecht aus Sicht der Patienten und Pflegebedürftigen
3.1 Verfassungsnormen und Programmsätze
3.1.1 Grundrechte
3.1.2 Pflege-Charta
3.2 Recht auf Selbstbestimmung
3.2.1 Patientenwille und dessen Surrogate
3.2.2 Einwilligung und Einwilligungsfähigkeit
3.2.3 Rechtliche Betreuung
3.2.4 Vorsorgevollmacht und Notvertretungsrecht
3.2.4.2 Notvertretungsrecht des Ehepartners
3.2.5 Patientenverfügung
3.2.6 Notfallversorgung
3.2.7 Zwangsmaßnahmen
3.3 Sozialleistungsrecht
3.3.1 Soziale Pflegeversicherung
3.3.2 Gesetzliche Krankenversicherung
4 Pflegerecht aus Sicht der Gesundheitseinrichtungen
4.1 Leistungserbringerrecht
4.1.1 Leistungserbringung im System der sozialen Pflegeversicherung
4.1.2 Leistungserbringung im System der gesetzlichen Krankenversicherung
4.2 Vertragliche Beziehungen zur Leistungsbewirkung
4.2.1 Dienst- bzw. Werk- und Kaufvertrag
4.2.2 Behandlungsvertrag
4.2.3 Krankenhausvertrag
4.2.4 Pflegevertrag
4.2.5 Heimvertrag
Literatur
Sachregister
Hinweise zur Benutzung dieses Lehrbuches
Folgende Icons werden im Buch verwendet:
Zusammenfassung
Definition
Merksatz
Übungsaufgabe
Beispiel
Literatur- und Websiteempfehlungen
In den einzelnen Kapiteln gibt es Übungsaufgaben und Reflexionsfragen. Passwortgeschützte Beispiellösungen finde sie auf der Homepage des Ernst Reinhardt Verlages und der UTB GmbH bei der Darstellung dieses Titels: www.reinhardt-verlag.de, www.utb.de. Das Passwort zum Öffnen der Dateien finden Sie im Buch vor dem Literaturverzeichnis.
Hinweise des Autors:
Das Pflegerecht ist als eigenständiges Rechtsgebiet sehr dynamisch und einer Vielzahl schnell aufeinander folgender Gesetzesänderungen unterworfen. Die vorliegende Darstellung zum Recht in der Pflege bildet den Rechtsstand vom 1. Januar 2024 ab. Entsprechendes gilt für die in Euro angegeben (Sozialversicherung-)Werte. Über die abgedruckten QR-Codes können die zitierten gesetzlichen Bestimmungen in ihrer jeweils aktuellsten Fassung recherchiert und eingesehen werden.
Vorwort
Das Verhältnis von Pflege und Recht erscheint kompliziert und unüberschaubar. Es gibt eine große Unsicherheit in den Pflegeberufen, ob das eigene Handeln immer den rechtlichen Vorgaben entspricht. Die Dokumentation der Pflege wird oftmals mit rechtlichen Fragen in Verbindung gebracht und weniger als fachliches Informationsmedium angesehen. Zum Teil besteht auch Angst, etwas Falsches oder nicht das Richtige zu tun und rechtliche Konsequenzen befürchten zu müssen. In diesem Sinne scheinen rechtliche Fragen die Pflegepraxis eher zu erschweren.
Eine genauere Betrachtung zeigt jedoch, dass dies keinesfalls so sein muss, sondern das Recht auch für Klarheit sorgen kann und dass es bei einigen Fragen der Pflege sogar sehr vorteilhaft ist, wenn klare rechtliche Regelungen bestehen. Bereits heute sind viele Aspekte der Pflege rechtlich geregelt. So gibt es sehr umfassende Rechtsgrundlagen für Studium und Ausbildung, zur Finanzierung gesundheitlicher und pflegerischer Leistungen und natürlich auch zu der Frage, wer bei Schäden, die durch die Pflege entstehen, die Verantwortung trägt. Eine Pflegepraxis ohne einen rechtlichen Rahmen ist nicht vorstellbar. Wie umfassend die rechtlichen Kenntnisse von Pflegefachpersonen sein müssen, darüber gibt es unterschiedliche Ansichten. Eine Vorstellung davon, welche Bereiche des Rechts unmittelbar oder mittelbar die Pflege beeinflussen (können), dürfte aber in jedem Fall sehr hilfreich sein.
Der vorliegende Band von Peter Kostorz zum Recht in der Pflege bietet einen kompakten Überblick und eine gute Einführung in die verschiedenen Rechtsbereiche, die für die Pflege von Bedeutung sind. Der Band ist darauf ausgelegt, ein grundsätzliches Verständnis dieser Rechtsbereiche zu vermitteln und Möglichkeiten zur Vertiefung aufzuzeigen. Verschiedene Beispiele ermöglichen einen guten Zugang zu rechtlichen Fragen in der Pflege sowie zur pflegerischen Versorgung und illustrieren eindrücklich, in welcher Form Recht und Pflege zusammenhängen können. Um das Verständnis in der Pflege für rechtliche Aspekte zu verbessern und die Unsicherheit gegenüber dem Recht zu nehmen, ist dem Band eine hohe Verbreitung zu wünschen.
Der vorliegende Band ist nach den Bänden zur Ethik, Qualität und Forschung in der Pflege sowie zur Pflege im Lebensverlauf der fünfte Band aus der Reihe Pflege studieren. Die Reihe ist darauf angelegt, gezielt die Förderung der im Pflegeberufegesetz ausgewiesenen und durch das Studium zu erlangenden Kompetenzen zu unterstützen. Die Bände sind darauf ausgerichtet, gute Begleiter durch das Pflegestudium zu sein. Sie eignen sich aber auch für diejenigen, die sich im Rahmen von Aus-, Fort- und Weiterbildung mit Fragen der Weiterentwicklung der Pflege befassen möchten. Weitere Bände widmen sich folgenden Themen:
•Beratung und Kommunikation in der Pflege
•Grundlagen der Pflegepraxis
•Bezugswissenschaften in der Pflege
•Pflege im Gesundheitssystem
•Handlungsfelder in der Pflege
Osnabrück, April 2024
Prof. Dr. Andreas Büscher
Einleitung
„Es ist mit der Jurisprudenz wie mit dem Bier; das erste Mal schaudert man, doch hat man‘s einmal getrunken, kann man‘s nicht mehr lassen.“ (Johann Wolfgang von Goethe)
In der Pflege ist das Thema Recht für gewöhnlich eher unbeliebt. Der Umgang mit Gesetzen und Paragraphen gilt als verhältnismäßig kompliziert und meist langweilig – zudem gelten viele rechtliche Regelungen als zu weit vom Berufsalltag entfernt, als dass man sich um sie kümmern müsste. Gleichwohl sind juristische Fragestellungen bereits Bestandteil der Pflegeausbildung und das insofern völlig zu Recht, als die (professionelle bzw. berufsmäßige) Versorgung von Menschen mit Pflegebedarfen nahezu vollständig verrechtlicht ist.
So ist bereits das Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann oder Pflegefachperson rechtlich reglementiert, da es die Erlaubnis einer staatlichen Behörde voraussetzt. Ist sie erteilt, sind die Angehörigen dieses Berufsstandes in aller Regel nicht selbständig tätig, sondern stehen in einem arbeitsrechtlichen Beschäftigungsverhältnis zu einer Einrichtung des Gesundheitswesens (i. d. R. ein Krankenhaus, ein Pflegeheim oder ein Pflegedienst). Diese Gesundheitseinrichtung wiederum geht mit den von ihr zu versorgenden Personen einen Vertrag über die zu erbringenden Behandlungs- bzw. Pflege- und Unterstützungsmaßnahmen ein, was aus Sicht der Adressaten dieser Maßnahmen in den meisten Fällen nur deshalb (ökonomisch) möglich ist, weil sie bestimmte Leistungsansprüche gegen ihre Kranken- bzw. Pflegekasse geltend machen können, die wiederum auf einem mit diesen Sozialversicherungsträgern bestehenden Versicherungsverhältnis beruhen. Aufgabe der Pflegepersonen ist es in diesem Zusammenhang schließlich, diese vertraglichen und gesetzlichen Ansprüche der behandlungs- bzw. pflegebedürftigen Menschen im Rahmen ihrer Berufsausübung umzusetzen; dabei besteht auch zwischen ihnen und den von ihnen zu versorgenden Personen ein spezifisches Rechtsverhältnis, das von dem Selbstbestimmungsrecht der Pflegeadressaten einerseits und der Pflicht der Pflegepersonen zur sorgfaltsgemäßen Durchführung der Pflege nach medizinisch-pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen und Standards andererseits geprägt ist.
Die an der Versorgung von Menschen mit Pflegebedarfen beteiligten Akteure handeln nicht im rechtsfreien Raum. Im Gegenteil: Sie sind vielmehr eingebunden in ein dichtes Netz an unterschiedlichen Rechtsverhältnissen mit jeweils spezifischen (gegenseitigen) Rechten und Pflichten der einzelnen Akteure. Pflege ist damit insofern verrechtlicht, als nahezu alles in ihr rechtlich reglementiert ist.
Das vorliegende Buch zum Recht in der Pflege (im Folgenden häufig auch synonym als Pflegerecht bezeichnet) greift diese Rechtsverhältnisse auf und stellt dabei die drei Hauptakteure im System der Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf in das Zentrum der Betrachtung (Abb. 1). Zunächst geht es aus Sicht der Pflege(fach)kräfte um den rechtlichen Rahmen ihrer Ausbildung und ihrer Berufstätigkeit, um die haftungsrechtlichen Konsequenzen von Fehlleistungen und Fehlverhalten während ihrer Berufsausübung und um ihre arbeitsrechtlichen Beziehungen zu den sie beschäftigenden Einrichtungen des Gesundheitswesens (Kap. 2). Aus der Perspektive dieser Gesundheitseinrichtungen wird zum einen der Frage nachgegangen, unter welchen Voraussetzungen sie zur Erbringung von (pflegerischen) Leistungen zugelassen werden und wie die erbrachten Leistungen honoriert werden; zum anderen werden die möglichen vertraglichen Beziehungen zu den von ihnen zu versorgenden Personen dargestellt (Kap. 4). Deren Sichtweise auf das Versorgungsgeschehen ist wiederum geprägt von ihrem Recht auf eine selbstbestimmte Entscheidung über konkret durchzuführende medizinische Maßnahmen und pflegerische Interventionen sowie den Leistungsansprüchen, die sie gegenüber ihrer Kranken- bzw. Pflegekasse geltend machen können (Kap. 3).
Abb. 1: Rechtliche Beziehungen der an der Versorgung vom Menschen mit Pflegebedarf beteiligten Hauptakteure
Dabei stößt das Bemühen um eine prägnante Bezeichnung der Protagonisten im System der pflegerischen Versorgung der Bevölkerung auf eine deutliche terminologische Schwierigkeit: Während die Pflegenden (mit einer mindestens dreijährigen Fachausbildung) einheitlich als Pflegefachmänner bzw. Pflegefachfrauen oder Pflegefachkräfte/-personen bezeichnet werden können, ist die Betitelung der von ihnen in institutionalisierten Gesundheitseinrichtung zu versorgenden Personen deutlich komplizierter, werden sie doch in einem Krankenhaus als Patientinnen und Patienten, in einem Pflegeheim als Bewohnerinnen und Bewohner (resp. Verbraucherinnen und Verbraucher) und von einem Pflegedienst regelmäßig als Klientinnen und Klienten (resp. Kundinnen und Kunden) bezeichnet. Der Oberbegriff der Pflegebedürftigen bzw. der pflegebedürftigen Personen ist dabei insofern untauglich, als er auf die Pflegebedürftigkeit im Sinne des Pflegeversicherungsrechts rekurriert, die mit ihr implizierten physischen bzw. psychischen Beeinträchtigungen aber bei den meisten Patienten eines Krankenhauses und bei einem Teil der Klienten eines Pflegedienstes, die keine Leistungen der Langzeitpflege, sondern (nur) die der medizinischen Behandlungspflege in Anspruch nehmen, (anders als bei den Bewohnern eines Pflegeheims) i. d. R. eben nicht gegeben sind – bei ihnen geht es vielmehr vorrangig um die Deckung eines (akuten) medizinischen Behandlungsbedarfs. Demgegenüber integriert der Begriff des Patienten zwar sowohl in einem Krankenhaus zu versorgende Personen als auch einen Teil der Kunden ambulanter Pflegedienste, nicht jedoch die Bewohner eines Pflegeheims oder diejenigen Klienten eines Pflegedienstes, die (vorrangig) Leistungen der ambulanten Langzeitpflege beziehen. Aus diesem Grund wird für die von den Pflegefachkräften zu versorgenden Personen vorliegend das Begriffspaar Patienten bzw. Pflegebedürftige verwendet; dies entspricht zudem der sozialrechtlichen Nomenklatur im Recht der gesetzlichen Kranken- und der sozialen Pflegeversicherung, die das Gesundheits- und damit auch das Pflegesystem maßgeblich prägen.
Mit dem Begriff der Pflegefachkraft bzw. der Pflegefachperson werden vorliegend mindestens dreijährig ausgebildete und staatlich geprüfte Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner (sowie klientenspezifisch ausgebildete Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger[innen] sowie Altenpfleger[innen]) bezeichnet.
Mit Gesundheitseinrichtungen sind vornehmlich die hier näher in den Fokus genommenen Krankenhäuser, Pflegeheime und Pflegedienste gemeint.
Unter dem Begriffspaar Patienten/Pflegebedürftige werden – sofern rechtlich keine Ausdifferenzierung erforderlich ist – einheitlich (behandlungsbedürftige) Patienten eines Krankenhauses, (pflegebedürftige) Bewohner eines Pflegeheims sowie (behandlungs- und/oder pflegebedürftige) Klienten eines Pflegedienstes verstanden.
Gemäß dem Reihentitel Pflege studieren ist der vorliegende Band vornehmlich adressiert an (angehende) Pflegefachkräfte, die eine hochschulische Pflegeausbildung absolvieren, ausbildungs- bzw. berufsbegleitend oder -integrierend Pflege studieren oder sich in einem Studium des Pflegemanagements, der Pflegepädagogik oder der Pflegewissenschaft beruflich weiterqualifizieren. Da er sich mithin nicht vorrangig an Juristinnen und Juristen oder Studierende eines rechtswissenschaftlichen Studiums richtet, werden die in der Jurisprudenz und in der juristischen Fachliteratur regelmäßig geführten Meinungsstreitigkeiten über die Auslegung und Anwendung bestimmter rechtlicher Regelungen vorliegend mehr oder minder ausgeblendet. Recht wird in dieser Darstellung also eher schwarz-weiß gezeichnet, weshalb sie im rechtlichen Ernstfall nicht die Lektüre eines großes (juristischen) Lehrbuchs oder eines Gesetzeskommentars mit allen Grauschattierungen des Rechts ersetzen kann. Im vorliegenden Lehrbuch wird vielmehr versucht, ein Grundverständnis für das Recht in der Pflege zu schaffen und die für die Berufsausübung notwendigen Grundlagen des Pflegerechts zu vermitteln, um dessen Leserinnen und Lesern zumindest ein wenig die Scheu vor rechtlichen Themen zu nehmen und sie bestenfalls sogar für sie zu gewinnen (erinnert sei an das einleitende Zitat von Goethe, der bekanntermaßen nicht nur Dichter, sondern auch Jurist war).
1Grundlagen des Pflegerechts
Beim Pflegerecht handelt es sich um ein Rechtsgebiet, das querschnittsartig zu verschiedenen anderen Rechtsbereichen verläuft und sich dementsprechend durch ein Zusammenspiel unterschiedlichster Rechtsquellen auszeichnet. Es überschreitet deutlich die herkömmliche Kategorisierung des Rechts in Privatrecht und öffentliches Recht, integriert unter anderem Regelungen des Berufsrechts, des Arbeits- und Sozialrechts, des Vertragsrechts, des Haftungsrechts und des Rechts auf Patientenautonomie und verteilt sich dementsprechend auf eine Vielzahl von gesetzlichen und untergesetzlichen Rechtsquellen. Die Kenntnis dieser Grundlagen und Grundstrukturen des Rechts in der Pflege ist dabei – neben einem gewissen Grundverständnis für den Umgang mit Gesetzestexten und die spezifisch juristische Arbeitsweise und Methodik – eine notwendige Bedingung für das Verständnis der rechtlichen Beziehungen zwischen den im Pflegesystem agierenden Gesundheitseinrichtungen, den dort beschäftigten Pflegekräften und den von ihnen zu versorgenden Patienten bzw. Pflegebedürftigen.
1.1Recht in der Pflege – die Theorie
Das Pflegerecht ist als verhältnismäßig junges Rechtsgebiet noch unkonturiert. Es statuiert zusammengefasst die Rechte und Pflichten der an der Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf beteiligten Akteure und reglementiert deren (rechtliche) Beziehungen untereinander. Dabei verläuft es querschnittsartig zu verschiedenen anderen Teilgebieten der Rechtswissenschaft und zeichnet sich durch ein interdependentes Zusammenwirken unterschiedlicher Rechtsquellen aus; insofern existiert leider kein in sich geschlossenes „Pflegegesetzbuch“.
1.1.1Begriff und Gegenstand des Pflegerechts
Im Gegensatz etwa zum Arzt- oder Medizinrecht, für das es einen relativ gefestigten Kanon an Rechtsfragen gibt, die diesem Rechtsgebiet zugeordnet werden können, zeigt das Pflegerecht – ähnlich wie das ihm übergeordnete Gesundheitsrecht (Kostorz 2020, 13 f.) – bislang deutlich weniger klare Konturen. So zeigt beispielsweise allein ein Blick in die Inhaltsverzeichnisse der wichtigsten Lehrbücher zum Pflegerecht (Kap. 1.2.2), dass hier jeweils unterschiedliche Aspekte des Rechts in der Pflege thematisiert bzw. andere inhaltliche Schwerpunkte gesetzt werden.
Um sich dem Begriff des Pflegerechts definitorisch zu nähern, bietet es sich daher an, sich zunächst mit dem der Pflege auseinanderzusetzen (Siefarth 2023, 1 ff.). Jenseits der diesbezüglich in der Pflegewissenschaft intensiv geführten Diskussion und neben den recht umfassenden Definitionen der World Health Organization (WHO) und des International Council of Nurses (ICN) kann Pflege kurzgefasst verstanden werden als
„Unterstützung von Personen, die aufgrund gesundheitlicher Beeinträchtigungen in ihrer Selbstversorgung eingeschränkt sind oder voraussehbar sein werden“ (Bartholomeyczik,in: Pschyrembel 2023, Stw. Pflege).
Dabei wird die genannte Unterstützung im gesetzlich reglementierten, öffentlichen Gesundheitssystem regelmäßig durch institutionalisierte Gesundheitseinrichtungen (vor allem Krankenhäuser, Pflegeheime und Pflegedienste) gewährleistet, die sich zur Erbringung der gegenüber den unterstützungsbedürftigen Personen geschuldeten pflegerischen Versorgungsleistungen der bei ihnen beschäftigten Pflege(fach)kräfte bedienen. Dementsprechend kann das Pflegerecht wie folgt eingegrenzt werden:
Das Pflegerecht umfasst die Gesamtheit aller Rechtsvorschriften, die die Rechte und Pflichten der an der Unterstützung und Versorgung von Menschen mit Pflegebedarf beteiligten Akteure statuiert und reglementiert. Neben den zu pflegenden Personen selbst gehören zu diesen Akteuren in erster Linie beruflich bzw. professionell tätige Pflegepersonen sowie Pflegeleistungen anbietende bzw. erbringende Gesundheitseinrichtungen.
Aus Sicht der Pflegekräfte(Kap. 2) spielt das Pflegerecht vor allem bei der Berufszulassung nach einer erfolgreich abgeschlossenen Pflegeausbildung und bei der anschließenden Berufsausübung eine Rolle; werden sie als Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmer tätig, sind in diesem Zusammenhang auch die Vorschriften des (allgemeinen) Arbeitsrechts zu berücksichtigen. Ferner sind bestimmte rechtliche Maßgaben bei der interdisziplinären Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Gesundheitsfachberufe und beim Unterlaufen von Pflegefehlern zu berücksichtigen, für die Pflegekräfte unter Umständen in unterschiedlicher Form einstehen müssen.
Als vulnerable Personen sollen Patienten bzw. Pflegebedürftige (auch) durch die Rechtsordnung besonders geschützt werden; insofern stellt sich das Recht in der Pflege für sie vor allem als Teilhaberecht dar (Kap. 3). Hierzu gehört zum einen, ihr Selbstbestimmungsrecht in möglichst vielen (nicht nur gesundheitsbezogenen) Angelegenheiten zu wahren und zu fördern sowie sie bei der Durchsetzung ihres (tatsächlich geäußerten oder mutmaßlichen) Willens (rechtlich) zu unterstützen und ihre individuellen Wünsche (auch und gerade an Behandlungs- bzw. Pflegemaßnahmen) zu berücksichtigen. Zum anderen werden ihnen bestimmte (pflegebezogene) Sozialleistungen zur Verfügung gestellt, die ihnen trotz ihres Hilfe- und Unterstützungsbedarfs ein selbständiges und selbstbestimmtes Leben ermöglichen und so zu ihrer möglichst uneingeschränkten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft beitragen sollen; in den Fokus rückt hier vornehmlich das Leistungsrecht der gesetzlichen Krankenversicherung und der sozialen Pflegeversicherung.
Als Erbringer von pflegerischen Leistungen stellen die Gesundheitseinrichtungen eine Art Bindeglied zwischen den Kranken- und Pflegekassen einerseits und den Patienten bzw. Pflegebedürftigen andererseits dar (Kap. 4). So ist es ihre Aufgabe, die Leistungsansprüche der von ihnen zu versorgenden Personen zu bewirken bzw. umzusetzen, wozu zwischen ihnen ein privatrechtlicher Vertrag geschlossen wird, der deren gegenseitige Ansprüche und Obliegenheiten im Behandlungs- bzw. Pflegeverhältnis regelt. Die Gesundheitseinrichtungen werden hierzu von den Kranken- und Pflegekassen ermächtigt bzw. zugelassen, die die erbrachten Leistungen daraufhin auch honorieren müssen.
Dabei ist insgesamt zu betonen, dass sich die jeweiligen Rechte und Pflichten der genannten Akteure zum Teil bedingen und es sich bei der beschriebenen Zuordnung daher insofern um eine eher idealtypische handelt, als ihr regelmäßig ein gegenseitiges (synallagmatisches) Schuld- bzw. Vertragsverhältnis zu Grunde liegt:
•So kann beispielsweise das in der Pflege geltende Arbeitsrecht eben nicht nur aus der Perspektive der Pflegekräfte als Arbeitnehmer, sondern auch aus Sicht der sie als Arbeitgeber beschäftigenden Gesundheitseinrichtung betrachtet werden.
•Die haftungsrechtliche Verantwortung der Pflegekräfte für Pflegefehler und sonstiges Fehlverhalten bedingt regelmäßig gleichzeitig einen Schadensersatzanspruch der geschädigten (behandlungs- bzw. pflegebedürftigen) Person.
•Ähnliches gilt für Fragen des Selbstbestimmungsrechts von Patienten und Pflegebedürftigen, das im Sinne einer Pflicht zu dessen Berücksichtigung insofern sowohl die die Leistungsansprüche der zu versorgenden Personen umsetzenden Pflegekräfte als auch die zur Leistungserbringung verpflichteten Gesundheitseinrichtungen bindet.
•Schließlich begründet der zwischen einem Patienten bzw. Pflegebedürftigen und einer Gesundheitseinrichtung geschlossene Vertrag – je nach Perspektive – sowohl ein Recht auf eine adäquate medizinisch-pflegerische Versorgung als auch eine Pflicht zu einer adäquaten medizinisch-pflegerischen Versorgung.
1.1.2Rechtsbereiche und Rechtsquellen
Bedingt dadurch, dass das Pflegerecht die jeweils spezifischen (und häufig synallagmatischen) Rechte und Pflichten der an der pflegerischen Versorgung von Patienten bzw. Pflegebedürftigen beteiligten Akteure in den Fokus nimmt (Kap. 1.2.1), vereint es als eigenständiges Rechtsgebiet unterschiedliche, ansonsten separat betrachtete Rechtsbereiche und versucht, diese für die Pflege möglichst zusammenhängend und kontextualisiert darzustellen. Da das Recht seiner Teilbereiche dabei aus unterschiedlichsten Quellen sprudelt, sieht man sich im Recht der Pflege zudem mit verschiedensten Gesetzen und untergesetzlichen Regelungen konfrontiert (Tab. 1).
Das Pflegerecht besteht aus einem Konglomerat unterschiedlichster (gesetzlicher und untergesetzlicher) Bestimmungen zu den einzelnen Teilbereichen dieses Rechtsgebietes. Eine einheitliche Kodifikation in Form eines „Pflegegesetzbuches“ existiert nicht.
Tab. 1: Teilbereiche des Pflegerechts und deren maßgebliche Rechtsquellen
maßgebliche Rechtsquellen
Ausbildungsrecht
•Pflegeberufegesetz (PflBG)
•Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung (PflAPrV)
Berufszulassungsrecht
•Pflegeberufegesetz (PflBG)
Berufsausübungsrecht
•Pflegeberufegesetz (PflBG)
•Berufsrecht interdisziplinär kooperierender Gesundheits(fach)berufe
•Kammergesetze und Berufsordnungen der Länder
Arbeitsrecht
•Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
•Entgeltfortzahlungsgesetz (EFZG)
•Arbeitszeitgesetz (ArbZG)
•Bundesurlaubsgesetz (BUrlG)
•Mutterschutzgesetz (MuSchG)
•Pflegezeitgesetz (PflZG)
•Familienpflegezeitgesetz (FPflZG)
•Kündigungsschutzgesetz (KSchG)
•Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG)
Haftungsrecht
•Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
•Strafgesetzbuch (StGB)
Sozialleistungsrecht
•Sozialgesetzbuch (SGB)
Recht der Patientenautonomie
•Grundgesetz (GG)
•Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
Leistungserbringerrecht
•Sozialgesetzbuch (SGB)
Vertragsrecht
•Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
•Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz (WBVG)
•Sozialgesetzbuch (SBG)
Rechtssystematisch werden die einzelnen Teilbereiche der Rechtsordnung entweder dem privaten oder dem öffentlichen Recht zugeordnet. Grund hierfür sind nicht nur unterschiedliche Gerichtsbarkeiten (Siefarth 2023, 12 ff.), sondern vor allem unterschiedliche Grade der Verbindlichkeit der jeweiligen Rechtsquellen: Während die Bestimmungen des öffentlichen Rechts im Allgemeinen verpflichtende, nicht-dispositive Regelungen darstellen, gilt im Privatrecht das Prinzip der Privatautonomie; hier kann jeder Rechtsakteur seine Lebensverhältnisse und seine Rechtsbeziehungen zu anderen grundsätzlich (also von Ausnahmen abgesehen!) frei von staatlicher Einflussnahme gestalten.
Das Privatrecht regelt die Rechtsbeziehungen der einzelnen Bürger und anderer nichthoheitlich handelnder Rechtssubjekte (juristische Personen wie z. B. Krankenhäuser oder Pflegeeinrichtungen) untereinander; es herrscht das Prinzip der Gleichordnung und Selbstbestimmung (Trenczek/Behlert, in: Trenczek et al. 2024, 65).
Das öffentliche Recht regelt demgegenüber die Rechtsverhältnisse des Staates sowie der mit Hoheitsgewalt ausgestatteten Rechtssubjekte (z. B. Sozialversicherungsträger oder Strafverfolgungsbehörden) zu den Bürgerinnen und Bürgern sowie zwischen staatlichen Institutionen untereinander (Trenczek/Behlert, in: Trenczek et al. 2024, 65).
In diesem Sinne gehören beispielsweise die vertraglichen Beziehungen zwischen Patienten bzw. Pflegebedürftigen und den sie versorgenden Gesundheitseinrichtungen ebenso zum Privatrecht wie der größte Teil des Rechts der sog. Patientenautonomie, wohingegen etwa das Sozialleistungsrecht oder das Berufs(zulassungs)-recht in der Pflege dem öffentlichen Recht zuzuordnen ist. Beim Haftungsrecht zeigt sich ein gespaltenes Bild: Während das Recht der strafrechtlichen Verantwortung für Behandlungs- und Pflegefehler Bestandteil des öffentlichen Rechts ist, gehört die zivilrechtliche Haftung in Form des Schadensausgleichs durch Schadensersatzzahlungen zum Privatrecht.
Hinsichtlich ihres Verhältnisses untereinander folgen die verschiedenen Rechtsquellen zudem einer bestimmten Normenhierarchie (sog. Rangordnungsverhältnis) (Abb. 2). Danach darf – stark vereinfacht ausgedrückt – eine in diesem Sinne rangniedrigere Regelung einer ranghöheren Regelung inhaltlich nicht widersprechen und darüber hinaus auch nur dann erlassen werden, wenn das höherrangigere Recht dies zulässt (Röhl/Röhl 2008, 305 ff.).
Nach dem Rangordnungsprinzip darf das Recht auf einer niedrigeren Ebene nicht gegen die Bestimmungen einer höheren Ebene verstoßen.
Abb. 2: Normenpyramide im Pflegerecht
Das höchste nationale Recht stellt dabei die Verfassung der Bundesrepublik, also das Grundgesetz dar. Es enthält beispielsweise das Recht auf körperliche Unversehrtheit oder das Recht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, also auch das Recht auf Privatautonomie und das Recht zur Selbstbestimmung. Des Weiteren finden sich in ihm Maßgaben zur jeweiligen Gesetzgebungskompetenz von Bund und Ländern.
Bei den von diesen beiden Gebietskörperschaften erlassenen Rechtquellen handelt es sich in erster Linie um Parlamentsgesetze, die auf dem jeweils vorgeschriebenen Wege von den Organen der Legislative, also vor allem vom Bundestag bzw. dem jeweiligen Landtag, verabschiedet worden sind (sog. formelles und materielles Recht). In diesen Gesetzen kann die (Bundes- bzw. Landes-) Regierung als Exekutive ermächtigt werden, bestimmte Sachverhalte durch Rechtsverordnungen zu regeln; dieses sog. (ausschließlich) materielle Recht ist im Vergleich zum Gesetzesrecht insofern rangniedriger, als es grundsätzlich nur dann erlassen werden darf, wenn Inhalt, Zweck und Ausmaß der erteilten Ermächtigung durch ein formell-materielles Gesetz bestimmt worden sind (Röhl/Röhl 2008, 549 und 585 f.).
Ein gutes Beispiel für die Rangordnung zwischen Parlamentsgesetzen und Rechtsverordnungen stellt das Ausbildungs- bzw. Berufszulassungsrecht in der Pflege dar. So statuiert etwa das Pflegeberufegesetz als Voraussetzung für die Erteilung einer Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann das Bestehen einer staatlichen Prüfung nach dem Absolvieren einer Pflegeausbildung, doch enthält es kaum Vorschriften, die diese staatliche Prüfung reglementieren. Vielmehr ermächtigt das Gesetz das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie das Bundesministerium für Gesundheit, „das Nähere über die staatliche Prüfung“ durch eine Rechtsverordnung zu regeln. Die danach erlassene Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung enthält dementsprechend recht detaillierte Maßgaben zu den Zulassungsvoraussetzungen, zur Durchführung und zu den einzelnen Teilen der Staatsprüfung sowie zum (Nicht-)Bestehen der staatlichen Prüfung (Kostorz 2022a, 15 ff.).
Unter diesem Überbau befinden sich weitere (untergesetzliche) Rechtsquellen, die je nach Rechtsbereich unterschiedlich ausgestaltet sein können. In Betracht kommen beispielsweise privatrechtliche Verträge, öffentlich-rechtliche Erlasse oder Richtlinien, Satzungen oder Berufs- und Weiterbildungsordnungen.
Die allermeisten Bundesgesetze können auf der Internetseite www.gesetze-im-internet.de des Bundesministeriums der Justiz recherchiert und eingesehen werden. Viele Verlage bieten darüber hinaus editierte Gesetzessammlungen zu speziellen Rechtsgebieten bzw. Rechtsbereichen an, wie etwa zum Arbeits- oder zum Sozialrecht; exemplarisch können hier die Ausgaben des Verlages C.H.Beck (www.beck.de) oder des Fachverlages Walhalla (www.walhalla.de) genannt werden.
Ergänzt werden diese Rechtsquellen durch die Rechtsprechung in Form des sog. Richterrechts. Getreu dem Motto Wenn zwei sich streiten, freut sich der Richter! wird hier – regelmäßig aus Anlass eines konkreten Streites über die Interpretation bzw. Anwendung einer Rechtsvorschrift – das bestehende, insofern uneindeutige Recht durch eine gerichtliche Entscheidung präzisiert und so weiterentwickelt.
In wissenschaftlichen Arbeiten werden die in Bezug genommenen Rechtsquellen nur im Text genannt (zur Zitierweise Kap. 1.2.1) und nicht ins Literaturverzeichnis aufgenommen. Entsprechendes gilt für Gerichtsurteile, die nach folgender Struktur zu belegen sind: Gericht vom Datum(Aktenzeichen) (z. B. BGH vom 13.09.1994 [Az. 1 StR 357/94]).
1.2Recht in der Pflege – die Praxis
Gesetze und Paragraphen werden erlassen, um sie in der Rechtspraxis anzuwenden. Hierfür haben Juristinnen und Juristen die Technik der sog. Subsumtion entwickelt. Dabei wird ein konkreter Lebenssachverhalt mit den abstrakten Tatbestandsmerkmalen einer Rechtsnorm abgeglichen. Fällt der zu beurteilende Sachverhalt unter den Tatbestand der Norm, kann daraus eine bestimmte, gesetzlich vorgegebene Rechtsfolge abgeleitet werden. Trotz des insofern geltenden Grundsatzes Ein Blick ins Gesetz erleichtert die Rechtsfindung wird in der Rechtswissenschaft neben den originären Rechtsquellen allerdings auch ein breites Spektrum an Sekundärliteratur zur Klärung rechtlicher Sachverhalte genutzt. Neben den auch in anderen geisteswissenschaftlichen Disziplinen üblichen Fachbüchern und Fachzeitschriften spielen in der Rechtswissenschaft darüber hinaus Gesetzeskommentare und Handbücher eine besondere Rolle.
Eine (auch für Nicht-Juristinnen und Nicht-Juristen) gut lesbare Einführung in die juristische Arbeitsweise und Methodik bietet beispielsweise Bydlinski (2023) oder König (2024).
1.2.1Juristische Methodik und Arbeitsweise
Um Recht und Gesetz anwenden zu können, muss zunächst die richtige Vorschrift ausfindig gemacht werden. Dies kommt oftmals der sprichwörtlichen Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleich, die unter Anwendung einer gestuften Selektionssystematik indes erleichtert werden kann. Die Vorgehensweise orientiert sich dabei an folgender Reihenfolge:
1.Auffinden des richtigen Gesetzes: Orientiert an der Aufstellung in Tab. 1 ist zunächst das einschlägige Gesetz auszuwählen. Da Gesetze i. d. R. einigermaßen aussagekräftige Bezeichnungen haben (oder sie sie zumindest haben sollten), kann hier auch eine Recherche im Internet weiterhelfen. Sofern eine editierte Gesetzessammlung zur Verfügung steht, kann nach einem passenden Gesetz auch in deren Inhaltsverzeichnis gesucht werden.
2.Auffinden des richtigen Gesetzesabschnitts: Sodann ist innerhalb des einschlägigen Gesetzes nach dem Kapitel bzw. dem Abschnitt zu suchen, dessen Vorschriften nach seinem Titel am ehesten zur Beantwortung der zu lösenden Fragestellung beitragen könnten. Auch hier kann die Inhaltsübersicht (diesmal des einzelnen Gesetzes) genutzt werden, die Gesetzen (sowohl auf den gängigen Internetportalen als auch in Printfassungen) für gewöhnlich vorangestellt werden.
3.Auffinden des richtigen Paragraphen: Schließlich ist innerhalb des (mutmaßlich einschlägigen) Gesetzesabschnitts der für die Lösung der Rechtsfrage vermutlich passende Paragraph herauszusuchen. Dies kann – orientiert an den (amtlichen) Paragraphenbezeichnungen – entweder durch blättern/scrollen oder erneut unter Zuhilfenahme der Inhaltsübersicht des Gesetzes erfolgen.
Zu beantworten ist die Frage, ob Studierende vom Grundsatz her gesetzlich krankenversichert sind. Da es sich um eine kranken- und damit sozialrechtliche Frage handelt, ist das Sozialgesetzbuch, genauer das V. Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V) mit dem Titel Gesetzliche Krankenversicherung einschlägig. Relevant ist hierin der Erste Abschnitt (Versicherung kraft Gesetzes) des Zweiten Kapitels (Versicherter Personenkreis) und darin der Paragraph 5 mit der Überschrift Versicherungspflicht.
Eine derart aufgefundene Rechtsvorschrift ist möglichst präzise zu zitieren. Hierfür sind exakt die Ordnungsmerkmale zu nutzen, nach denen der Paragraph aufgebaut ist (Tab. 2); zudem ist das Gesetz zu benennen, aus dem die Vorschrift (sei es direkt oder indirekt) zitiert wird.
Tab. 2: Mögliche Ordnungsmerkmale im Aufbau von Paragraphen
Zeichen
Ordnungsmerkmal
Zitierweise
§
Paragraph
§
(1)
Absatz
Abs.
1
Satz
Satz oder S.
1.
Nummer
Nr.
a)
Buchstabe
B. oder lit.(für lateinisch litera)
Bezogen auf die Frage, ob Studierende vom Grundsatz her gesetzlich krankenversichert sind, führt der fünfte Paragraph des fünften Buches des Sozialgesetzbuches in der Nummer neun seines ersten Absatzes aus, versicherungspflichtig seien „Studenten, die an […] Hochschulen eingeschrieben sind […] längstens bis zur Vollendung des dreißigsten Lebensjahres“. Zu zitieren ist dieser Passus mit § 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V.
Schließlich ist die Vorschrift mit dem zu beurteilenden Lebenssachverhalt bzw. der juristisch zu beantwortenden Frage abzugleichen, um daraus eine bestimmte Schlussfolgerung ziehen zu können; Juristen nennen diesen Vorgang Subsumtion. Dabei ist auf den Grundaufbau einer Rechtsvorschrift Bezug zu nehmen, welche sich für gewöhnlich aus dem Tatbestand (mit unterschiedlichen Tatbestandsmerkmalen) und einer aus deren Vorliegen resultierenden Rechtsfolge zusammensetzt. Hierbei handelt es sich stets um eine Wenn-Dann-Beziehung, die auf das zu lösende rechtliche Problem übertragen werden kann (Abb. 3).
Abb. 3: Aufbau einer Rechtsnorm und Verfahren der Subsumtion
Der beispielhaft bemühte § 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V kann im Sinne einer Wenn-Dann-Beziehung wie folgt (um)formuliert werden: „Wenn ein Student an einer […] Hochschulen eingeschrieben ist […] und das dreißigste Lebensjahr noch nicht vollendet hat, dann ist er versicherungspflichtig [in der gesetzlichen Krankenversicherung].“ Zum Tatbestand der Vorschrift gehören hier die Merkmale Einschreibung als Student an einer Hochschule sowie Alter unter 30Jahren; die Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung stellt die Rechtsfolge dar. Möchte ein ratsuchender Kommilitone nun eine Einschätzung, ob er gesetzlich krankenversichert und damit etwa einen Anspruch auf ärztliche Behandlung hat, wäre im Sinne einer Subsumtion zu prüfen, ob er tatsächlich als Student an einer Hochschule immatrikuliert und jünger als 30 Jahre ist. Wäre dies der Fall, könnte daraus die Konsequenz (Rechtsfolge) abgeleitet werden, dass er in der gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert ist – jedenfalls im Prinzip, da es kaum ein Gesetz ohne Ausnahme gibt (zur vorliegenden Fallfrage im Detail Kostorz 2012).
1.2.2Hinweise zu pflegerechtlicher Literatur
Auch wenn ein Blick in das Gesetz die Rechtsfindung erheblich erleichtern kann, bedarf es zum juristischen Erkenntnisgewinn nicht selten der Zuhilfenahme rechtswissenschaftlicher Sekundärliteratur, die entweder systematisch in ein bestimmtes Rechtsgebiet einführt oder zur Beantwortung bzw. Lösung einer vergleichsweise speziellen rechtlichen Frage resp. Problemstellung dient. Zu unterscheiden ist diesbezüglich vor allem zwischen Lehr- und Studienbüchern, Beiträgen in Fachzeitschriften, Kommentaren und Handbüchern.
Einführende Lehr- bzw. Studienbücher stellen (wie das vorliegende) die Materie eines bestimmten Rechtsgebietes möglichst systematisch und anschaulich dar; häufig ist die Darbietung didaktisch angereichert durch visualisierende Abbildungen, konkretisierende Fallbeispiele oder prüfungsvorbereitend zu bearbeitende Übungsaufgaben. Die speziell zum Pflegerecht erschienen Lehrbücher setzen dabei zum Teil unterschiedliche inhaltliche Schwerpunkte, etwa auf das Haftungs- und Arbeitsrecht (Großkopf/Klein 2020 sowie Müller/Schabbeck 2018) oder das Sozialleistungsrecht (Janda 2023). Daneben bietet der Buchmarkt ein breites Spektrum an Lehr- und Studienbüchern zu den unterschiedlichen im Pflegerecht aufgehenden Rechtsbereichen (Kap. 1.1.2), die hier auch nicht nur annähernd vollständig aufgeführt werden können.
Zu den wichtigsten Lehr- und Studienbüchern zum Recht in der Pflege gehören die Publikationen von Bohnes (2023), Großkopf/Klein (2020), Hobusch (2022), Höfert (2017), Janda (2023), Kienzle (2020), Müller/Schabbeck (2018), Schellhorn/Tönnies (2023), Siefarth (2023), Smolibowski (2023), Weiß (2020) und Wiese (2014).
Im Vergleich zu Lehr- und Studienbüchern werden in Fachaufsätzen in pflegerechtlichen Fachzeitschriften speziellere und/oder aktuellere Fragen des Rechts in der Pflege behandelt. Neben allgemeiner ausgerichteten Zeitschriften etwa zum Sozial- oder Arbeitsrecht behandeln vor allem die folgenden Zeitschriften spezielle pflegerechtliche Themen:
•PflegeRecht (PflR) (Roßbruch Verlag)
•Rechtsdepesche für das Gesundheitswesen (RDG)(G&S Verlag)
•Gesundheit und Pflege (GuP) (Nomos Verlagsgesellschaft)
•Medizinrecht (MedR) (Springer Verlag)
•GesundheitsRecht (GesR) (Verlag Dr. Otto Schmidt)
Eine besondere und rechtswissenschaftsspezifische Literaturgattung stellen Kommentare dar, die es zu (fast) allen Gesetzen gibt. Sie befassen sich – etwa unter Berücksichtigung der einschlägigen Rechtsprechung und der bestehenden Sekundärliteratur zu einem rechtlichen Thema – mit Fragen der Anwendung und Auslegung einzelner Paragraphen; Aufbau und Systematik des Kommentars orientieren sich daher strikt an der Paragraphenfolge des erläuterten Gesetzes.
Besteht bei der Anwendung des § 5 Abs. 1 Nr. 9 SGB V (Beispiele aus Kap. 1.2.1) etwa Unklarheit über die Bedeutung bzw. das Vorliegen des Tatbestandsmerkmals Student an einer Hochschule, kann etwa im Kommentar von Berchtold et al. (2018) unter den Erläuterungen zu § 5 SGB V nachgelesen werden, dass „Student ist, wer sich an einer Hochschule einer wissenschaftlichen Bildung oder Ausbildung widmet. Die Versicherungspflicht setzt die Immatrikulation als Student voraus […]; regelmäßig nicht entscheidend ist, ob ein Studium ernsthaft betrieben wird“. Mit dieser, das Gesetz konkretisierenden bzw. interpretierenden Information kann nun geschlussfolgert werden, dass sich auch faulenzende oder prokrastinierende Studierende nicht um ihren Krankenversicherungsschutz sorgen müssen.
Dabei folgt der Nachweis von Kommentarstellen eigenen Zitierregeln. Im Literaturverzeichnis einer wissenschaftlichen Arbeit wird der Kommentar wie eine Monographie bzw. ein Herausgeberband aufgeführt; im laufenden Text wird dem Kurzbeleg (sofern explizit ausgewiesen) der Bearbeiter der Paragraphenkommentierung vorangestellt, die sonst übliche Angabe der Seitenzahl wird durch die Nennung des kommentierten Paragraphen und der jeweiligen Randnummer ersetzt.
Der Kommentar von Berchtold et al. (2018) würde damit wie folgt in das Literaturverzeichnis aufgenommen: Berchtold, J., Huster, S., Rehborn, M. (Hrsg.) (2018): Gesundheitsrecht. SGB V | SGB XI. 2. Aufl. Nomos, Baden-Baden. Im Text wäre die zitierte Kommentarstelle wie folgt anzugeben: Simon, in: Berchtold et al. 2018, § 5 SGB V Rdnr. 50.
Eine Art Zwitterstellung nehmen die in der Rechtswissenschaft verbreiteten Handbücher ein, die sich hinsichtlich ihrer Literaturgattung zwischen Kommentaren und Lehrbüchern einordnen lassen. Sie stellen den Inhalt und den Themenbereich eines bestimmten Rechtsgebietes – ähnlich einem Lehrbuch – systematisch dar, erheben dabei aber mehr oder minder den Anspruch, den aktuellen Stand der rechtswissenschaftlichen Forschung zu diesem Sachgebiet (in Rechtsprechung und Literatur) – vergleichbar mit einem Kommentar – in enzyklopädischer Weise aufzuarbeiten. Zum Pflegerecht existiert ein solches Handbuch derzeit (noch) nicht, wohl aber zu affinen Rechtsgebieten oder zu Teilbereichen des Rechts in der Pflege.
Bislang sind derartige Handbücher beispielsweise zum Medizin- (etwa von Ratzel/Luxenburger [2020]) oder zum Arztrecht (so von Laufs et al. [2019]) erschienen; für das Pflegerecht können zudem die Handbücher zum Sozial- (Ruland et al. 2022) bzw. zum Krankenversicherungsrecht (Sodan 2018) oder zum Arbeitsrecht (exemplarisch Schaub 2023) relevant sein.
Wegen ihres in aller Regel recht immensen (inhaltlichen sowie seitenmäßigen) Umfangs werden Handbücher für gewöhnlich von mehreren Autorinnen und Autoren verfasst und als Herausgeberband publiziert. Je nach Aufbau und Struktur eines Handbuchs werden dessen Beiträge in wissenschaftlichen Arbeiten entweder als Artikel eines Sammelbandes aufgeführt oder (häufiger) entsprechend einer Erläuterung in einem Gesetzeskommentar zitiert.
Zur Literaturrecherche können neben den üblichen (Bibliotheks-) Katalogen und Suchmaschinen auch spezielle juristische Datenbanken genutzt werden, die indes regelmäßig kostenpflichtig sind, wenn sie nicht etwa über eine Hochschullizenz genutzt werden. Hierzu gehören vor allem die drei folgenden:
•Beck online (www.beck-online.beck.de)
•Juris (www.juris.de)
•Wolters Kluwer Online (www.wolterskluwer-online.de)
2Pflegerecht aus Sicht der Pflegekräfte
Aus Sicht der Pflegekräfte spielt das Pflegerecht vor allem bei der Berufszulassung und der Berufsausübung eine Rolle. Grundvoraussetzung für die Berufszulassung, also die Erteilung einer Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung Pflegefachfrau bzw. Pflegefachmann ist dabei eine entsprechende, regelmäßig mindestens dreijährige Ausbildung und das Bestehen einer staatlichen Prüfung. Bei der Berufsausübung unterliegen examinierte Pflegefachkräfte dann ihrem spezifischen Berufsrecht, das etwa den Schutz der Berufsbezeichnung oder die Ausübung der Pflege vorbehaltener Tätigkeiten regelt, sowie für gewöhnlich dem allgemeinen Arbeitsrecht, das in erster Linie ihrem Schutz als abhängig beschäftigte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dient. Zudem sind bestimmte rechtliche Maßgaben bei der interdisziplinären Zusammenarbeit mit Angehörigen anderer Gesundheitsfachberufe und beim Unterlaufen von Pflegefehlern zu beachten, für die Pflegekräfte unter Umständen in unterschiedlicher Form einstehen müssen.
2.1Ausbildungsrecht
Die (duale) Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) und der Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung (PflAPrV) kann auf zwei Arten absolviert werden. In beiden Fällen wird die praktische Unterweisung von einer Praxiseinrichtung des Gesundheitswesens verantwortet, mit der die Lernenden einen Ausbildungsvertrag abschließen. Korrespondierend dazu werden die primär theoretischen Ausbildungsinhalte bei der beruflichen Variante der Pflegeausbildung nach Teil 2 des Pflegeberufegesetzes im Unterricht einer Pflegeschule vermittelt, bei der sog. primärqualifizierenden Pflegeausbildung an Hochschulen nach Teil 3 des Pflegeberufegesetzes in Lehrveranstaltungen im Rahmen eines Studiums. Beide Ausbildungsvarianten werden mit einer staatlichen Prüfung abgeschlossen.
Eine systematische Einführung in das Pflegeberufegesetz sowie die Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung bietet Kostorz mit seinem Lehrbuch zum Ausbildungsrecht in der Pflege (Kostorz 2023a; ergänzt bzw. aktualisiert durch Kostorz 2024 sowie Kostorz/Niehues 2024).
2.1.1Berufliche Pflegeausbildung
Bei der beruflichen Ausbildung zur Pflegefachperson handelt es sich um eine duale Ausbildung, an der im Wesentlichen drei Akteure mit jeweils spezifischen Rechten und Pflichten beteiligt sind: Während der Ausbildungsträger für die praktische Ausbildung zuständig ist, erteilen die Pflegeschulen theoretischen und praktischen Pflegeunterricht; die Auszubildenden sind dabei verpflichtet, sich aktiv an der Ausbildung zu beteiligen und am Erreichen des Ausbildungsziels mitzuwirken.
Zu den Rechten und Pflichten der an der Pflegeausbildung beteiligten Akteure siehe auch die Aufsatzreihe von Kostorz (2018a–c).
2.1.1.1 Rechtsstellung des Ausbildungsträgers
Grundlage des Ausbildungsverhältnisses ist stets ein Ausbildungsvertrag nach § 16 PflBG, der in schriftlicher Form zwischen dem Auszubildenden und dem Träger der Ausbildung abgeschlossen wird. Ausbildungsträger kann dabei ausschließlich ein zur Versorgung von Patienten bzw. Pflegebedürftigen zugelassenes Krankenhaus oder eine stationäre bzw. ambulante Pflegeeinrichtung sein (Kap. 4.1.2.1 bzw. 4.1.1.1), welche(s) entweder selbst eine Pflegeschule betreibt (sog. Trägeridentität) oder mit einer Pflegeschule einen Vertrag über die Durchführung des theoretischen und praktischen Unterrichts für ihre Auszubildenden abgeschlossen hat (§ 8 Abs. 2 i. V. m. § 7 Abs. 1 PflBG).
Beim Abschluss des Ausbildungsvertrages sind bestimmte, in § 16 Abs. 2 PflBG aufgeführten Mindestinhalte zu berücksichtigen, die in erster Linie der Transparenz und damit der Information sowie dem Schutz der Auszubildenden dienen. Zu ihnen gehören etwa die genaue Bezeichnung des Berufs, zu dem ausgebildet wird, eine Darstellung der zeitlichen und inhaltlichen Gliederung der Ausbildung, der für das dritte Ausbildungsjahr gewählte bzw. vereinbarte Vertiefungseinsatz oder der Hinweis auf Urlaubsansprüche, die zu zahlende Ausbildungsvergütung oder die Modalitäten einer Ausbildungsbeendigung.
Auch wenn auf den Ausbildungsvertrag „die für Arbeitsverträge geltenden Rechtsvorschriften und Rechtsgrundsätze anzuwenden“ sind (§ 16 Abs. 4 PflBG), so dass auch im Ausbildungsverhältnis grundsätzlich die üblichen gegenseitigen arbeitsrechtlichen Rechte und Pflichten von Arbeitnehmern und Arbeitgebern gelten (Kap. 2.3), ist zu betonen, dass es sich bei dem Ausbildungsverhältnis selbst dem Grund nach nicht um ein Arbeitsverhältnis handelt: Im Vordergrund steht nicht die Erbringung von Diensten gegen Arbeitsentgelt, sondern die Ausbildung zum Beruf der Pflegefachfraubzw. desPflegefachmanns. Aus Sicht des Ausbildungsträgers ergibt sich daraus in erster Linie die Pflicht zur praktischen Ausbildung seiner Auszubildenden. Um diese nicht dem Zufall zu überlassen, ist sie nach einem strukturierten Ausbildungsplan durchzuführen (§ 6 Abs. 3 Satz 1 PflBG) – die Planmäßigkeit der praktischen Ausbildung hat mithin Vorrang vor anderen, gegebenenfalls arbeitsorganisatorischen Erwägungen (Verbot des sog. ,Stationhoppings‘ [Dielmann 2022, § 18 PflBG Rdnr. 7]); zudem stellt § 18 Abs. 2 PflBG klar, dass Auszubildenden nur Aufgaben übertragen werden dürfen, „die dem Ausbildungszweck und dem Ausbildungsstand entsprechen“.
„Eine dem Ausbildungszweck dienende Aufgabe liegt vor, wenn diese geeignet ist, den Ausbildungszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Unter Ausbildungszweck ist dabei die systematische Vermittlung der beruflichen Fertigkeiten und Kenntnisse sowie der charakterlichen Bildung zu verstehen. […] Grundsätzlich ist danach die Übertragung aller berufsfremden Arbeiten, insbesondere von Hilfs- und Nebenarbeiten unzulässig. Eine an sich zulässige Verrichtung kann durch Wiederholung von dem Zeitpunkt ab unzulässig werden, von dem ab sie keine weiteren beruflichen Fertigkeiten oder Kenntnisse mehr vermittelt. Deshalb dürfen grundsätzlich auch keine Routinearbeiten verlangt werden. […] Die Grenze zwischen erlaubt und unerlaubt liegt dort, wo die berufsnotwendigen Fertigkeiten bereits hinreichend gegeben sind und der Einsatz bei bestimmten Verrichtungen dem Mangel entsprechender Arbeitnehmer abhelfen soll.“ (OLG Karlsruhe vom 05.09.1988 [Az. 1 Ss 134/88])
Lehrjahre sind keine Herrenjahre – aber auch keine Jahre der bedingungslosen Unterwerfung! Dementsprechend darf der Ausbildungsträger den Auszubildenden nur Aufgaben übertragen, die dem Ausbildungszweck entsprechen, weshalb die Übertragung von ausbildungsfremden Tätigkeiten grundsätzlich ebenso unzulässig ist, wie die (ausschließliche) Zuweisung von Routinetätigkeiten zur Kompensation fehlender examinierter Pflegekräfte.
Zu den ausbildungsfremden Tätigkeiten gehören unter anderen nicht berufsspezifische Reinigungsarbeiten (etwa das turnusmäßige Reinigen der Patientenzimmer), zu den Routinetätigkeiten vor allem Hol- und Bringdienste, das Austeilen der Mahlzeiten oder die Ausführung körperbezogener Pflegemaßnahmen, wie etwa die Hilfe beim Toilettengang.
Zur Einhaltung seiner Ausbildungspflicht gehört auch, dass der Ausbildungsträger die Durchführung sämtlicher vorgesehener Einsätze der praktischen Ausbildung zu gewährleisten hat (§ 18 Abs. 1 Nr. 2 PflBG). Diese müssen gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 PflAPrV in der Summe mindestens 2.500 Stunden umfassen (zur Anrechnung von Fehlzeiten siehe § 13 PflBG sowie § 1 Abs. 4 PflAPrV), dem Ausbildungsplan folgen und den Maßgaben der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung entsprechen, nach denen zwischen einem Orientierungseinsatz zu Beginn der Ausbildung, den Pflichteinsätzen in den Versorgungsbereichen der stationären Akutpflege, der stationären Langzeitpflege, der ambulanten Akut- und Langzeitpflege (sog. allgemeine Versorgungsbereiche), der pädiatrischen sowie der psychiatrischen Versorgung, einem Vertiefungseinsatz in einem Bereich eines der genannten Pflichteinsätze sowie zwei weiteren, grundsätzlich frei gestaltbaren Einsätzen unterschieden wird (vgl. vor allem Anlage 7 PflAPrV).
Besonderheiten ergeben sich dann, wenn im Ausbildungsvertrag ein Vertiefungseinsatz im speziellen Bereich der pädiatrischen Versorgung oder im Bereich der Langzeitpflege vereinbart wurde und der Auszubildende von seinem Wahlrecht nach §§ 59 bis 61 PflBG Gebrauch gemacht hat, statt des generalistisch geprägten Berufs der Pflegefachperson einen klientenspezifischen Berufsabschluss