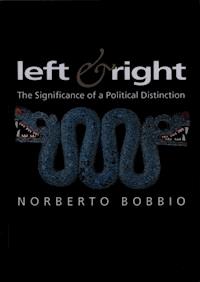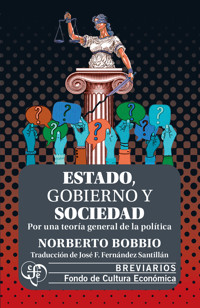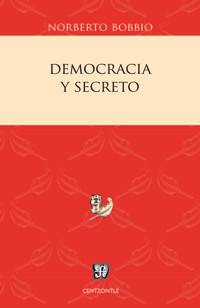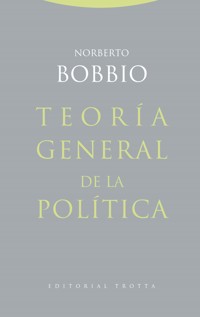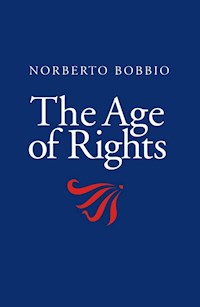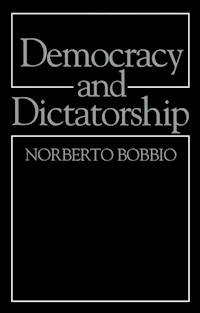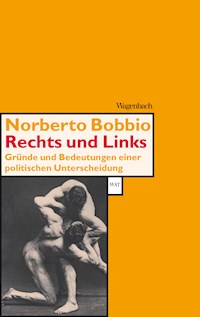
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Rechts und links, Freiheit oder Gleichheit – welche Bedeutung und welchen Sinn haben diese Begriffe heute noch? Wer den Unterschied von rechts und links leugnet, gibt die Idee einer Gesellschaft mit gleichen Rechten auf, stiehlt sich aus der Spannung zwischen Freiheit und Gleichheit, die seit der Französischen Revolution besteht. Norberto Bobbio, der große politische Denker Italiens, hat mit 'Rechts und links' einen in seiner Klarheit unübertroffenen Klassiker der politischen Philosophie geschrieben. »Für diese italienische Einmischung, mit Lust am Demokratischen, mit Leidenschaft gegen die Denunziation von Demokratie als Gleichmacherei, kann man nur dankbar sein.« Die Zeit
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus dem Italienischen von Moshe Kahn
Die italienische Originalausgabe erschien 1994
bei Donzelli Editore unter dem Titel Destra e sinistra.
E-Book-Ausgabe 2021
© 1994, 2004, 2014 Donzelli Editore, Roma
© 1994 für die deutsche Übersetzung: Verlag Klaus Wagenbach, Emser Straße 40/41, 10719 Berlin
Covergestaltung Groothuis & Malsy unter Verwendung eines
Photos © W. G. Mill (Fight, 1918).
Das Karnickel zeichnete Horst Rudolph.
Datenkonvertierung bei Zeilenwert, Rudolstadt.
Alle Rechte vorbehalten. Jede Vervielfältigung und Verwertung der Texte, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Verbreiten von Kopien auf Papier, Datenträgern oder im Internet sowie Übersetzungen.
ISBN: 978 3 8031 4322 8
Auch in gedruckter Form erhältlich: 978 3 8031 2311 4
www.wagenbach.de
Vorwort
Noch nie wurde so viel gegen die herkömmliche Differenzierung zwischen Rechts und Links geschrieben wie heute: Sie wird als überholt betrachtet, als sinnlos, vorausgesetzt, sie hatte in der Vergangenheit einen Sinn.1 Noch nie wurde, wie heute, da ich diese Zeilen schreibe, der politische Schauplatz von zwei Lagern beherrscht, die sich jeweils der Rechten und der Linken zuzählen.
Existieren also die Rechte und die Linke noch? Und wenn sie noch existieren und sich behaupten, wie kann man dann sagen, sie hätten keinerlei Bedeutung mehr? Und wenn sie noch eine Bedeutung haben, worin besteht sie?2
Seit Jahren sammle ich Material zu diesem Thema, das nicht nur endlose Debatten ausgelöst, sondern auch unterschiedlichste und widersprüchlichste Thesen hervorgebracht hat, auch wenn ich zugeben muss, dass die von mir zusammengetragenen Notizen nur wenige Tropfen in einem großen Ozean sind. Viele der jetzt veröffentlichten Seiten wurden schon vor langer Zeit geschrieben, doch nie publiziert, obwohl die darin vertretenen Anschauungen in Seminaren und öffentlichen Diskussionen vorgestellt worden sind.3 Zu der gegenwärtigen Verwirrung tritt zusätzlich das Paradox zweier Schlüsselwörter des politischen Diskurses, die oftmals und mit unterschiedlichen Argumenten geleugnet werden. Doch scheint man ohne sie auch nicht auskommen zu können: zwei Wörter, die noch heute mit einer derart gefühlsgeladenen Bedeutung befrachtet sind, dass sie die Gemüter so erhitzen, dass jedes der beiden Lager sie verwendet, um entweder die Großartigkeit der eigenen Seite herauszustellen oder die gegnerische zu diffamieren.
Im Verlauf der Arbeit habe ich deswegen versucht, mich nicht allzu sehr von wechselnden Meinungen beeinflussen zu lassen, die häufig ex tempore in einem Zeitungs- oder Zeitschriftenartikel erschienen und, wenn man ihnen Gehör schenkt, der Gefahr ausgesetzt sind, dass man weder das Fortdauern der Unterscheidung, trotz aller Widerlegungen, noch den Hass und die Bewunderung begreift, die sie am Leben halten.4 Ich habe nacheinander die Argumente für ein Pro und Contra (um einen gängigen Ausdruck zu verwenden: die »Phrasendreschereien«) untersucht, deren sich die gegnerischen Parteien bedient haben, die von Mal zu Mal vorgebrachten Gründe für den Tod oder für das Weiterleben der gegensätzlichen Anschauung, die von ihren Verteidigern angewandten Kriterien, wobei ich mich besonders auf jene Autoren konzentriere, die bei ihrer Formulierung eines Kriteriums ihre persönliche und dokumentierte Analyse mitgeliefert haben.
In den letzten beiden Kapiteln habe ich, in Form einer Zusammenfassung aus allen Lesarten und Beobachtungen, die ich nach und nach festgestellt oder gemacht habe, das beschrieben, was meiner Meinung nach der unverrückbare, unauflösbare und als solcher immer wieder aufblühende und zugleich ideale, historische und existentielle Kern dieser Dichotomie ist. Beim Betrachten der Dinge aus einem gewissen Abstand habe ich es mir nie zur Aufgabe gemacht, auch eine Wertung zu geben. Ich frage mich nicht, wer recht hat und wer unrecht, denn ich halte es nicht für hilfreich, das historische Urteil mit meinen persönlichen Ansichten zu vermengen, auch wenn ich letzten Endes keinen Hehl daraus mache, welcher der bei den Seiten ich nahestehe.
Turin, Frühjahr 1994
N. B.
I. Die angefochtene Unterscheidung
1. ›Rechts‹ und ›links‹ sind zwei antithetische Begriffe, die seit mehr als zwei Jahrhunderten allgemein zur Bezeichnung des in hohem Maß konfliktgeladenen Gegensatzes jener Ideologien und Bewegungen angewandt werden, in die das Universum unterteilt ist. Dieser Gegensatz bezieht sich sowohl auf das Denken als auch auf die politischen Aktionen. Als antithetische Begriffe sind sie, im Hinblick auf das Universum, auf das sich beide beziehen, ausschließlich, und gemeinsam sind sie erschöpfend: ausschließlich in dem Sinn, dass keine Doktrin, beziehungsweise keine Bewegung, gleichzeitig rechts und links sein kann; erschöpfend in dem Sinn, dass, zumindest in der klaren Bedeutung dieses Wortpaars, wie wir im Weiteren noch genauer sehen werden, eine Doktrin oder eine Bewegung entweder nur der Rechten oder nur der Linken zugehören kann.
Angesichts dessen, was ich die »großen Dichotomien« nannte, in die jeder Wissensbereich, auch der des antithetischen Wortpaars ›rechts‹ und ›links‹, aufgeteilt ist, habe ich schon öfters darauf hingewiesen, dass man einen deskriptiven, einen axiologischen und einen historischen Gebrauch davon machen kann: deskriptiv, um eine synthetische Darstellung der beiden in Konflikt befindlichen Parteien zu geben; axiologisch, um ein Urteil mit positiver oder negativer Wertung über die eine oder die andere Partei abzugeben; historisch, um den Übergang von einer Phase des politischen Lebens einer Nation zu einer anderen zu kennzeichnen, wobei der historische Gebrauch seinerseits wiederum deskriptiv oder axiologisch sein kann.
Der Gegensatz von ›rechts‹ und ›links‹ stellt ein typisches Denkmuster in Dyaden dar, die die verschiedensten Deutungen psychologischer, soziologischer, historischer und auch biologischer Art erfuhr. Beispiele dazu kennt man aus allen Bereichen des Wissens. Es gibt keine Disziplin, die nicht von irgendeiner allesumfassenden Dyade bestimmt wird: in der Soziologie Gesellschaft–Gemeinwesen; in der Ökonomie Markt–Plan; im Rechtswesen Privat–Öffentlichkeit; in der Ästhetik Klassik–Romantik; in der Philosophie Transzendenz–Immanenz. Im politischen Bereich ist ›rechts‹ und ›links‹ nicht die einzige, aber auf sie stößt man überall.
Es gibt Dyaden, bei denen die beiden Begriffe antithetisch sind, andere, bei denen sie komplementär sind. Die einen entstehen durch die Interpretation eines aus divergierenden und sich einander feindlich gegenüberstehenden Elementen zusammengesetzten Universums, die anderen aus der Interpretation eines harmonischen, aus konvergierenden Elementen zusammengesetzten Universums, welche dazu neigen, einander zu begegnen und gemeinsam eine höhere Einheit zu bilden. Das Wortpaar ›rechts–links‹ gehört zum ersten Typus. Da sich das Denken in Triaden oftmals aus dem Denken in Dyaden entwickelt und sozusagen dessen Weiterentwicklung darstellt, hängt der Übergang allerdings davon ab, ob man von einer Dyade antithetischer Begriffe oder von einer Dyade komplementärer Begriffe ausgeht. Im ersten Fall findet der Übergang durch dialektische Synthese statt oder durch Negation der Negation; im zweiten durch Zusammenfügung.
Die nachfolgenden Überlegungen entwickeln sich aus der in den letzten Jahren fast schon zum Gemeinplatz verkommenen Feststellung, dass die Unterscheidung zwischen ›rechts‹ und ›links‹, die über nahezu zwei Jahrhunderte, seit der Französischen Revolution, dazu gedient hat, die politische Welt in zwei einander gegenüberstehende Lager zu spalten, längst überholt sei. Zum Ritual gehört dann das Zitat Sartres, der wohl zu den Ersten zählte, die sagten, dass ›rechts‹ und ›links‹ zwei Worthülsen seien; sie hätten weder irgendeinen heuristischen, noch einen klassifizierenden und schon gar keinen axiologischen Wert. Geradezu mit Verdruss spricht man von der Unterscheidung als einer dieser zahlreichen sprachlichen Fallen, in die die politische Diskussion tappe.
2. Die Gründe für diese Anschauung, die sich immer mehr verbreitet und für die man tagtäglich unzählige Beispiele anführen könnte, sind unterschiedlich. Einige von ihnen wollen wir uns ansehen.
Grund und Anlass für die ersten Zweifel über das Verschwinden oder wenigstens über die verminderte Anziehungskraft der Unterscheidung sei die sogenannte Krise der Ideologien und die daraus resultierende Sinnlosigkeit ihrer Gegenüberstellung. Dagegen kann man einwenden, dass die Ideologien keineswegs verschwunden sind, im Gegenteil, dass sie so lebendig sind wie selten zuvor. An die Stelle der alten Ideologien sind lediglich andere getreten, neue oder solche, die sich als neu ausgeben. Grün ist der Ideologien goldner Baum. Zudem gibt es, wie auch schon mehrmals festgestellt worden ist, nichts Ideologischeres als die Behauptung, die Ideologien befänden sich in einer Krise. Dazu kommt, dass die Begriffe ›links‹ und ›rechts‹ ja nicht nur auf Ideologien verweisen. Sie lediglich als Ausdruck politischen Denkens verkürzt aufzufassen, wäre eine unangemessene Vereinfachung: Sie bezeichnen gegensätzliche Programme angesichts vieler Probleme, deren Lösung gemeinhin der politischen Tätigkeit zukommt, Gegensätze nicht nur von Ideen, sondern auch von Interessen und Wertungen über die Richtung, die der Gesellschaft gegeben werden soll, Gegensätze also, die es in jeder Gesellschaft gibt und die nicht einfach verschwinden. Natürlich ließe sich einwenden, dass es zwar Gegensätze gibt, dass sie aber nicht mehr die jener Epoche sind, in der die Unterscheidung aufkam, und dass sie sich während der gesamten Zeit ihres glückhaften Vorhandenseins dermaßen verändert haben, dass die alten Bezeichnungen anachronistisch sind und daher in die falsche Richtung weisen.
Kürzlich ist die Ansicht vertreten worden, dass – eben weil der Begriff ›links‹ seine Fähigkeit, in unterschiedlichen Zusammenhängen eine jeweils neue Bedeutung anzunehmen, in einem Maß verloren hat, dass der Hinweis, man gehöre zur Linken, heute eine der am wenigsten verifizierbaren Aussagen des politischen Sprachgebrauchs ist – das alte Wortpaar sinnvollerweise durch dieses neue ersetzt werden könne: Progressisten–Konservative. Doch es gab auch Stimmen, die in schroffer Form jede beharrlich dichotomische Vision ablehnten, indem sie die Ansicht vertraten, dass auch diese letzte Dichotomie nur ein weiterer Unsinn des Politkauderwelschs sei, von dem man sich freimachen müsse, um von nun an neue Gruppierungen zu finden, die sich nicht mehr nach Positionen formieren, sondern nach Problemen.
3. Zweitens wird behauptet, dass in einer immer komplexeren politischen Ordnung wie die der großen Gesellschaften, insbesondere die der großen demokratischen Gesellschaften – die die Existenz unterschiedlicher und miteinander konkurrierender Meinungs- und Interessensgruppen zulassen oder gar voraussetzen (bisweilen stehen sie im Gegensatz zueinander, bisweilen überlagern sie sich, an manchen Stellen verflechten sie sich miteinander, um sich dann wieder voneinander zu lösen, Gruppen, die bald aufeinander zugehen, bald, wie in einer großen tänzerischen Bewegung, sich den Rücken zukehren) – die allzu klare Trennung zwischen zwei gegensätzlichen Parteien immer unangemessener, die axiale Sicht der Politik immer unzureichender wird. Kurz ausgedrückt: Es wird der Einwand erhoben, dass man sich in einem Pluriversum wie dem der großen demokratischen Gesellschaften, in denen zahlreiche sowohl konvergierende wie divergierende Gruppen eine Rolle spielen und die vielfähigsten Kombinationen untereinander zulassen, die Fragen nicht mehr in antithetischer Form stellen kann, als aut–aut oder rechts und links oder: Ist es nicht rechts, dann ist es eben links und umgekehrt.
Der Einwand trifft ins Schwarze, ist aber dennoch unerheblich. Die Unterscheidung zwischen einer Rechten und einer Linken schließt auch in der allgemein gebräuchlichen Sprache keineswegs die Vorstellung von einer kontinuierlichen Linie aus, an der entlang sich zwischen der anfänglichen Linken und der endgültigen Rechten oder, was das Gleiche ist, der anfänglichen Rechten und der endgültigen Linken Zwischenpositionen einrichten, die den zentralen Raum zwischen den beiden Extremen besetzen. Dieser Raum wird als ›Mitte‹ bezeichnet und ist als solcher allseits bekannt. Wollte man mit der Sprache der Logik kokettieren, könnte man sagen: Während die dyadische oder axiale Vision der Politik als das ausgeschlossene Dritte definiert werden kann, derzufolge der politische Raum als lediglich in zwei Bereiche getrennt angesehen wird, von denen der eine den anderen nicht ausschließt und nichts sich zwischen sie drängt, kann die triadische Vision, die zwischen ›rechts‹ und ›links‹ einen Bereich einschließt, der weder rechts noch links, sondern in der Mitte zwischen beiden steht, als das eingeschlossene Dritte definiert werden. Im ersten Fall nennt man die beiden Begriffe, die sich zueinander wie ein »aut–aut« verhalten, widersprüchlich; im zweiten Fall, bei dem wir es mit einem Zwischenbereich zu tun haben, den man mit der Formel »weder–noch« verdeutlichen kann, nennt man sie gegensätzlich. Das ist nicht weiter schlimm: Zwischen Weiß und Schwarz kann Grau stehen; zwischen dem Tag und der Nacht steht die Dämmerung. Doch das Grau nimmt dem Unterschied zwischen Weiß und Schwarz keinen Schimmer, noch die Dämmerung dem zwischen Tag und Nacht.
4. Dass allerdings in vielen demokratischen Systemen mit deutlich pluralistischer Struktur das eingeschlossene Dritte dazu tendiert, so übermäßig zu werden, dass es den breitesten Raum innerhalb des politischen Systems einnimmt und die Rechte wie die Linke an den Rand drängt, widerspricht der ursprünglichen These in keiner Weise, weil die Mitte, eben weil sie sich weder als rechts noch als links definiert und sich nicht anders definieren kann, sie voraussetzt und aus ihrer Existenz die eigene Daseinsberechtigung herleitet. Je nach Jahreszeit und Breitengrad kann die Dämmerung mehr oder weniger lange dauern, doch ihre längere oder kürzere Dauer ändert nichts daran, dass ihre Definition von der Definition Tag und der Definition Nacht abhängt.