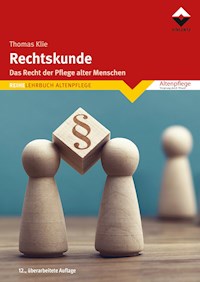
45,90 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Vincentz Network
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Neuauflage erscheint Ende Oktober - jetzt vorbestellen! Rechtskundig im besten Sinne des Wortes macht dieses Lehrbuch. Fallorientiert und verständlich sind Rechte der Pflegebedürftigen und der in der Pflege Beschäftigten dargestellt. Rechte kennen, wahrnehmen, verteidigen. Die eigenen, wie die Rechte der Pflegebedürftigen. Mit diesem Handbuch vom Rechtsexperten Thomas Klie gelingt es. Die 12., überarbeitete und erweiterte Auflage berücksichtigt alle gesetzlichen Neuregelungen. Das Lehrbuch orientiert sich an den Inhalten des Rahmenlehrplans zur generalistischen Ausbildung. Aus aktuellem Anlass werden eine Reihe von Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fallbezogen aufgegriffen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 681
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Thomas Klie
Rechtskunde
Das Recht der Pflege alter Menschen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Sämtliche Angaben und Darstellungen in diesem Buch entsprechen dem aktuellen Stand des Wissens und sind bestmöglich aufbereitet.
Der Verlag und der Autor können jedoch trotzdem keine Haftung für Schäden übernehmen, die im Zusammenhang mit Inhalten dieses Buches entstehen.
© VINCENTZ NETWORK, Hannover 2021, 12. überarbeitete Auflage
Besuchen Sie uns im Internet: www.altenpflege-online.net
Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar.
Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Warenbezeichnungen und Handelsnamen in diesem Buch berechtigt nicht zu der Annahme, dass solche Namen ohne Weiteres von jedermann benutzt werden dürfen. Vielmehr handelt es sich häufig um geschützte, eingetragene Warenzeichen.
Titel: AdobeStock, fotomowo
E-Book-Herstellung und Auslieferung: readbox publishing, Dortmund, www.readbox.net
E-Book ISBN 978-3-7486-0415-0
Thomas Klie
Rechtskunde
Das Recht der Pflege alter Menschen
VINCENTZ NETWORK
Inhalt
Inhalt
Vorwort
Aus dem Vorwort zur 11. Auflage
Aus dem Vorwort zur 10. Auflage
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Einführung
Recht ist …
1 Subjektives und objektives Recht
2 Rechtsquellen
3 Altersstufen im Recht
4 Öffentliches Recht und Privatrecht
Staatsbürgerkunde
1 Staatsform der Bundesrepublik
2 Staatsorgane
3 Grundrechte
4 Exkurs: Grundrechtsgeltung in Heimen und die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
5 Europäische Union
6 Exkurs: Wahlen im Pflegeheim
Haftungsrecht
1 Einführung in das Haftungsrecht
1.1 Rechtliche Anknüpfungspunkte
1.2 Die rechtliche Haftungsprüfung
1.3 Grundzüge der strafrechtlichen Haftung
1.3.1 Grundsätze
1.3.2 Wichtige Delikte
1.3.2.1 Vermögensdelikte
1.3.2.2 Nichtvermögensdelikte
1.4 Grundzüge der zivilrechtlichen Schadensersatzhaftung
2 Delegation ärztlicher Tätigkeiten an Pflegekräfte
2.1 Voraussetzungen
2.2 An welche Pflegekräfte darf delegiert werden?
2.3 Welche ärztlichen Tätigkeiten dürfen delegiert werden?
2.4 Verordnungs- und Handlungs-verantwortung
2.5 Auswahl, Anleitung und Überwachung der Pflegekräfte
2.6 Checkliste: Fehlerquellen in der Kooperation Pflegeeinrichtung – Arzt
3 Pflegefehler
4 Risikomanagement
5 Rechtsprechung zum Sturzrisiko
6 Geschäftsführung ohne Auftrag
7 Schutz der Privatsphäre – Datenschutz
7.1 Schweigepflicht
7.2 Verschwiegenheitspflicht
7.3 Datenschutz
7.4 Sozialdatenschutz
8 Sterbehilfe
9 Versicherungen
9.1 Haftpflichtversicherungen
9.2 Weitere Versicherungen
Betreuungsrecht und das Rechtdes demenziell undpsychisch kranken alten Menschen
1 Einführung
2 Freiheitsrechte psychisch Kranker
3 Verabreichung von Psychopharmaka
4 Achtsamkeit und »Aufsichtspflicht«
5 Betreuungsrecht
5.1 Allgemeines
5.2 Errichtung einer »Betreuung«
5.3 Bestellung des Betreuers
5.4 Aufgaben des Betreuers
5.5 Einzelfragen der Betreuung
6 Unterbringungsrecht
6.1 Freiheitsentziehung
6.3 Unterbringung nach den Landesunterbringungsgesetzen
6.4 Freiheitsentziehende Maßnahmen bei Quarantäne
6.5 Verfahren bei Unterbringung und unterbringungsähnlichen Maßnahmen
6.5 Übersicht zum Unterbringungsverfahren
7 Betreuung psychisch Kranker in der eigenen Häuslichkeit
Sozialrecht
1 Einführung
2 Sozialversicherungen
3 Krankenversicherung
3.1 Aufgabe, Träger, Versicherte
3.2 Das Leistungssystem der Krankenversicherung
3.3 Leistungen bei Krankheit
3.3.1 Ärztliche und zahnärztliche Behandlung
3.3.2 Arzneimittel
3.3.3 Heilmittel: Rehabilitation zu Hause
3.3.4 Hilfsmittel
3.3.5 Zahnersatz
3.3.7 Hospize
3.3.8 Häusliche Krankenpflege
3.3.9 Soziotherapie
3.3.10 Spezialisierte ambulante Palliativversorgung SAPV
3.3.11 Haushaltshilfe
3.3.12 Fahrtkosten
3.3.13 Härtefälle
3.4 Integrierte Versorgung und weitere Innovationen
4 Rentenversicherung
4.1 Formen der Alterssicherung
4.2 Die gesetzliche Rentenversicherung
5 Pflegeversicherung
5.1 Zur Geschichte
5.2 Grundsätze und Ziele der Pflegeversicherung
5.3 Die gesetzlichen Grundlagen
5.4 Pflegebedürftigkeitsbegriff
5.4.1 Definition Pflegebedürftigkeit
5.4.2 Die Module
5.4.3 Feststellung des MD(K)
5.5 Grade der Pflegebedürftigkeit
5.6 Die Leistungen
5.6.1 Leistungen bei häuslicher Pflege
5.6.2 Leistungen der Verhinderungspflege
5.6.3 Pflegehilfsmittel und technische Hilfen
5.6.4 Tages- und Nachtpflege
5.6.5 Entlastungsbetrag
5.6.6 Leistungen für Pflegebedürftige in ambulant betreuten Wohngemeinschaften und -gruppen
5.6.7 Leistungen für Pflegepersonen
5.6.8 Familienpflegezeit
5.6.9 Pflegeunterstützungsgeld
5.6.10 Kurzzeitpflege
5.6.11 Heimpflege (stationäre Pflege)
5.7 Pflegeberatung und Pflegestützpunkte
5.8 Wettbewerb und Qualität
5.9 Vergütung
5.10 Osteuropäische Pflegekräfte
5.11 Zukunft der Pflege
6 Unfallversicherung
7 Soziales Entschädigungsrecht
8 Wohngeld
9 Sozialhilfe und Grundsicherung
9.1 Einführung
9.2 Übersicht
9.3 Grundlagen der Sozialhilfe
9.4 Leistungen
9.4.1 Überblick
9.4.2 Grundsicherung im Alter
9.4.3 Hilfen zum Lebensunterhalt
9.4.4 Hilfe zum Lebensunterhalt in Heimen
9.4.5 Leistungen in »besonderen Lebenslagen«
9.4.6 Hilfe zur Pflege
9.4.7 Hilfe zur Weiterführung des Haushaltes
9.4.8 Altenhilfe
9.4.9 Sozialhilfe in Heimen
9.4.9.1 Heimkosten
9.4.9.2 Barbetrag
9.4.10 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten gem § 72 SGB XII
9.5 Einsatz von Einkommen und Vermögen
9.5.1 Einkommen
9.5.2 Vermögen
9.5.3 Heranziehung Unterhaltspflichtiger
9.5.4 Erbenhaftung
10 Teilhabe und Eingliederungshilfe
10.1 Eingliederungshilfe
10.2 Vergünstigungen für Menschen mit Schwerbehinderung
11 Steuererleichterungen
12 Beihilfen für Beamte
13 Exkurs: Altenteilverträge
14 Verfahrens- und Rechtsschutzfragen
14.1 Rechtsschutz in der Sozialversicherung
14.2 Rechtsschutz in der Sozialhilfe
Qualitätssicherung und Verbraucherschutz
1 Menschen mit Pflegebedarf und ihr Schutzbedürfnis
2 Qualitätssicherung
3 Das Heimrecht
3.1 Geschichte und Zielsetzung
3.2 Heim oder nicht Heim
3.3 Mindestanforderungen
3.4 Die Heimmitwirkung
3.5 Geringwertige Aufmerksamkeiten
3.6 Die »Heimaufsicht«
4 Qualitätssicherung und MDK
5 Heimvertrag und Verbraucherschutz
5.1 Verbraucherschutzrecht
5.2 Heimvertrag
5.3 Heimentgelt
5.4 Pflegevertrag
6 Anti-Folter-Stelle
7 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz
8 Auswahl eines Heimes
Mietrecht
1 Bedeutung des Mietrechts für alte Menschen
2 Probleme während des Mietverhältnisses
2.1 Miethöhe
2.2 Modernisierung
2.3 Untervermietung
2.4 Tierhaltung
2.5 Schneefegen
2.6 Umbaumaßnahmen des*der Mieter*in
3 Beendigung des Mietverhältnisses
3.1 Kündigung
3.2 Tod des*der Mieter*in
4 Beratung für Mieter
Gesundheitsschutzrecht
1 Einleitung
2 Arzneimittelrecht
2.1 Arzneimittelgesetz
2.2 Apothekengesetz
2.3 Betäubungsmittelgesetz
3 Infektionsschutz
4 Lebensmittelrecht
5 Medizinprodukterecht
Erbrecht
1 Grundsätze
2 Die gesetzliche Erbfolge
2.1 Gesetzliche Erbfolge bei Verwandten
2.2 Erbrecht der Ehegatten
2.3 Erbrecht des nichtehelichen Kindes
3 Pflichtteil
4 Testament
4.1 Inhalt von Testamenten
4.2 Widerruf von Testamenten und Testierfähigkeit
5 Was ist bei Todesfällen zu beachten?
6 Erbschaftssteuer
Arbeitsrecht
1 Einleitung
2 Arbeitsvertrag
3 Tarifvertrag
4 Betriebliche Beteiligung
5 Vergütung
5.1 TVöD
5.2 Mindestlohn in der Pflege
6 Urlaub und Arbeitsbefreiung
7 Entgeltfortzahlung im Krankheitsfall
8 Beendigung des Arbeitsverhältnisses
9 Arbeitszeugnis
10 Direktionsrecht
11 Arbeitsschutz
11.1 Die wichtigsten Arbeitsschutzregelungen
11.2 Arbeitszeit und Zeitzuschläge
11.3 Mutterschutz und Elternzeit
11.4 Jugendarbeitsschutz
11.5 Unfallverhütung
11.6 Arbeitsunfall
Berufsrecht
1 Entstehung des Berufs »Altenpfleger*in«
2 Berufsbild
3. Pflegeberufegesetz
4 Pflege- und Berufsverständnis
5 Ausbildungsziel
6 Ausbildungsabschlüsse und Aufstiegsmöglichkeiten
7 Perspektiven der Pflegeberufe
Literaturverzeichnis
Web-Adressen
Abkürzungsverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Autorenvita
Jetzt Code scannen und mehr bekommen …
http://www.altenpflege-online.net/bonus
Ihr exklusiver Bonus an Informationen!
Ergänzend zu diesem Buch bietet Ihnen Altenpflege Bonus-Material zum Download an. Scannen Sie den QR-Code oder geben Sie den Buch-Code unter www.altenpflege-online.net/bonus ein und erhalten Sie Zugang zu Ihren persönlichen kostenfreien Materialien!
Buch-Code: AH1048
Vorwort
Die Corona-Pandemie hat die gesellschaftliche Bedeutung der Pflege in aller Deutlichkeit heraustreten lassen. Pflege ist systemrelevant. Das hat inzwischen die Politik verstanden. Auch in der Gesellschaft ist das Ansehen der Pflegeberufe nochmals deutlich gestiegen. Und es hat sich auch gezeigt: Die Eigenverantwortung der Pflegefachpersonen, sie gewinnt immer mehr an Bedeutung. Pflegefachkräfte müssen häufig allein Entscheidungen treffen oder sie vorbereiten: Das verlangt von ihnen Professionalität aber auch Rechtskenntnisse, die in diesem Buch vermittelt werden. Und Pflegefachkräfte sind Garanten von Menschenrechten für auf Pflege angewiesene Menschen. Diese waren und sind durch die Corona-Krise im hohen Maße bedroht. Kontaktsperren, Quarantäne, Aufnahmeverbote: Das was auf kurze Zeit unabweisbar ist als Schutz vor Infektionen kann und darf dauerhaft das Leben von auf Pflege angewiesenen Menschen nicht bestimmen.
In der 12. Auflage der »Rechtskunde – Das Recht der Pflege alter Menschen« gilt es mehrerlei zu berücksichtigen und in eine Überarbeitung einzubeziehen: Das Pflegeberufegesetz ist in Kraft und damit die generalistische Ausbildung gestartet – allerdings mit einigen Ausnahmen. Es wurde ein Rahmenlehrplan verabschiedet, der in seinen Inhalten und seinen didaktischen Überlegungen in den Kapiteln berücksichtigt wird. Und es gilt eine ganze Reihe von gesetzlichen Änderungen zu berücksichtigen – solche, die sich auf die Corona-Pandemie beziehen, aber auch solche, die unabhängig von ihr zu veränderten Rahmenbedingungen in der professionellen Pflege beigetragen haben.
Aus aktuellem Anlass werden in der 12. Auflage eine Reihe von Rechtsfragen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie fallbezogen aufgegriffen. Die Erfahrung aus der Hotline der Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB), die über Wochen täglich neue Anfragen an den Verfasser herantrug, tragen mit zur Aktualität des Buches unter dem Vorzeichen von COVID-19 bei.
Ich wünsche, dass die Leser*innen, ob Schüler*innen oder Verantwortliche in der Langzeitpflege, durch die Lektüre rechtlich gestärkt werden. Zu danken habe ich Stefanie Oyoyo für die verlässliche Arbeit am Manuskript, Sabrina Schwierk für Recherche Arbeiten und dem Verlag für die vertrauensvolle und geduldige Zusammenarbeit.
RA Prof. Dr. Thomas Klie
Tutzing, Berlin, Freiburg
Aus dem Vorwort zur 11. Auflage
Die 18. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages hat eine Reihe von Änderungen im Pflegerecht zustande gebracht. Ein neuer Pflegebedürftigkeitsbegriff wurde eingeführt, die Leistungen der Pflegeversicherung zum Teil erweitert, das Pflegeberufegesetz wurde verabschiedet. Das Altenpflegerecht ist wieder in Bewegung. Dazu haben aber auch andere gesetzgeberische Aktivitäten beigetragen: Das Hospiz- und Palliativgesetz etwa, das die palliative Versorgung auch in Pflegeheimen vorschreibt, und die Patient*innenverfügung um die Behandlungsplanung erweitert. Cannabis gibt es inzwischen für bestimmte Patient*innengruppen auf Rezept und die Krankenhausvermeidungspflege wurde mit neuem Leben erfüllt. Mit lauter »Stärkungsgesetzen« hat der Bundesgesetzgeber das Pflege- und Gesundheitswesen versorgt: Pflegestärkungsgesetz I, II, III; Versorgungsstärkungsgesetz im Gesundheitswesen, Betreuungsstärkungsgesetz im Betreuungsrecht. Nun wollen wir hoffen, dass diese Stärkungsgesetze in ihren Wirkungen nicht homöopathisch bleiben, sondern etwas in der Pflege bewegen und vor allen Dingen die beruflich in der Altenpflege Beschäftigten in ihrer Berufsausübung unterstützen.
Aus dem Vorwort zur 10. Auflage
30 Jahre Rechtskunde, 30 Jahre das Recht der Pflege alter Menschen: Diesen Rückblick erlaubt die 10. Auflage der Rechtskunde im Jahre 2013. Hat sich viel getan, hat sich wenig verändert? Beides ist richtig. 1983 war eine Pflegeversicherung noch in weiter Ferne, man kannte den Altenpflegeberuf noch nicht als Heilberuf, von einer einheitlichen Ausbildung für die Pflege war man noch weit entfernt. Das Vormundschaftsrecht war noch in Kraft und Entmündigungen standen auf der Tagesordnung. Das Heimgesetz war 10 Jahre alt. Es gab nur wenige Juristen, die sich mit dem Pflegerecht beschäftigten. Von einem offenen Markt für Pflegeheime und Pflegedienste war noch nicht die Rede. Der demografische Wandel war absehbar aber doch noch in weiter Ferne und vom Fachkräftemangel in der Pflege war damals noch wenig zu spüren.
Heute bestimmt die Pflegeversicherung das Geschehen in der Altenpflege – im Guten, wie im Schlechten. Rechtsfragen haben in der Altenpflege an Bedeutung gewonnen. Die Fachdiskussion kann sich auf Expertenstandards beziehen und es gibt (theoretisch) gute und schlechte Noten für die Pflege. Wir haben ein modernes Betreuungsrecht und eine Behindertenrechtskonvention, die auch für pflegebedürftige Menschen ihre Geltung beansprucht.
Viele, bereits 1983 aufgeworfene Rechtsfragen, haben ihre Bedeutung keineswegs eingebüßt. Dazu gehören Fragen der Fixierung. Sie nahm bereits 1983 in der ersten Auflage breiten Raum ein. Was gute Qualität in der Pflege heißt, wie Qualitätssicherung betrieben werden kann, auch das war auch schon vor 30 Jahren Thema – wie die Frage, wie man wirksam Missständen begegnen kann und die Rechte der Altenpfleger*innen als Arbeitnehmer*innen geschützt werden können.
Die menschenrechtlichen Grundfragen in der Pflege, sie sind die Gleichen geblieben. Zum Teil stellen Sie sich deutlicher dar als vor 30 Jahren. Damals gab es noch zahlreiche Altenheime und Altenwohnheime. Die Diskussion war nicht allein auf die ambulanten Dienste und Pflegeheime konzentriert. Wohngemeinschaften und Wohngruppen gab es schon damals, aber nur wenige.
Freiburg, im Juli 2013
Aus dem Vorwort zur 1. Auflage
Im vorliegenden Buch werden möglichst verständlich und praxisnah die verschiedenen Rechtsgebiete dargestellt, die in der Altenpflege von Bedeutung sind. Dabei wird Altenpflege nicht nur als medizinisch-pflegerische Tätigkeit, sondern im Sinne ganzheitlicher Pflege als sehr viel umfassendere Aufgabe verstanden. Es werden daher beispielsweise nicht nur Haftungsfragen etwa bei Tätigkeiten aus dem pflegerischen und ärztlichen Aufgabenbereich besprochen. Vielmehr nehmen auch sozialrechtliche Themen einen weiteren Raum ein, da Altenpflegekräfte in der Praxis auch eine gewisse sozialpädagogische Kompetenz benötigen.
Ein Anliegen des Buches ist es weiterhin, die Rechte des alten, pflegebedürftigen Menschen herauszuarbeiten, sei es beim Thema Heimgesetz im Hinblick auf Heimbewohner oder beim Thema »Recht der psychisch Kranken« für den Umgang mit »Verwirrten«.
Schließlich wird neben weiteren Gebieten das Arbeits- und Berufsrecht der in der Altenpflege Beschäftigten ausführlich dargestellt. Dies scheint u. a. auch deshalb angezeigt, da das Berufsbild staatlich anerkannte*r Altenpfleger*in vielerorts noch unbekannt ist, und Altenpflegekräfte nicht immer ihrer Qualifikation entsprechend eingesetzt werden.
Das Buch ist aus dem Unterricht in der Altenpflegeausbildung entstanden und primär auch für Unterricht und Fortbildung konzipiert. Es ist also zunächst ein Lernbuch. Entsprechend sind die einzelnen Abschnitte kurz gehalten, um ein Nacharbeiten zu erleichtern. Wiederholungsfragen, Fallbeispiele und Übersichten unterstreichen diesen Charakter.
Das Buch soll aber auch als Handbuch für die Praxis dienen, in dem präzise Antworten auf Rechtsfragen aus dem Alltag der ambulanten und stationären Altenpflege gegeben werden. Ein recht umfangreiches Stichwortregister soll den Gebrauchswert als Nachschlagewerk erhöhen.
Die meisten Menschen nehmen die Gesetze, nach denen sie leben, im Alltag kaum wahr. Rechtsfragen sind lästig. Recht ist kompliziert und unübersichtlich. Dieser Haltung begegnet man auch in der Praxis der Altenpflege. Gern wird an den Experten verwiesen. Dabei ist Recht ein wesentlicher Bestandteil unserer Wirklichkeit.
Nehmen wir Recht aber nicht wahr, so nehmen wir auch unsere eigenen und die Rechte anderer nicht wahr. Wie leicht kommt es in der pflegerischen Praxis zu an sich rechtlich unzulässigem Verhalten Betreuten gegenüber, wie viele sozialrechtliche Ansprüche werden älteren Menschen vorenthalten, obwohl sie ihnen trotz aller Kürzungen zustehen, wie oft werden arbeitsschutzrechtliche Vorschriften nicht beachtet. Die Rechtskenntnisse sind daher wichtig, um älteren Menschen »gerecht« zu werden. Ähnliches gilt auch für die in der Altenpflege Beschäftigten, die ihre Rechte und Pflichten kennen sollten.
Gesetze machen Menschen nicht satt. Erst dadurch, dass Rechte verteidigt werden, existieren diese Rechte überhaupt. In diesem Sinne möchte diese Rechtskunde auch dazu ermutigen, die eigenen und die Rechte anderer vermehrt wahrzunehmen und zu verteidigen.
Hamburg, 1983
1
Staatsbürgerkunde
Das Ziel ist,
die staatsbürgerschaftliche Bedeutung der Profession der Pflege deutlich zu machen,
die wichtigsten Institutionen des Staates in ihrer Funktion und rechtlichen Ausgestaltung vorzustellen,
die Staatsform in der Bundesrepublik zu erklären,
die Grundrechte in ihrer Bedeutung für die Pflege herauszuarbeiten,
die Europäische Union und ihre Institutionen vorzustellen und ihre Bedeutung für die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Pflege herauszuarbeiten,.
die Professionellen der Pflege beteiligen sich an der systematischen Wissensentwicklung in der Pflege, in einigen Bundesländern verwalten sie ihre Angelegenheiten selbst, sei es über Pflegekammern oder die Vereinigung der Pflegenden in Bayern (VdPB). Der Pflegebeauftragte der Bundesregierung dokumentiert die Bedeutung der Pflege für die Politik. Gewerkschaften setzen sich für die Rechte der Pflegenden ein und immer mehr Bundes- und Landtagsabgeordnete stammen aus der Pflege. Die Bedeutung der Staatsbürgerkunde zeigt sich zunehmend für ein politisches Verständnis von Pflege. Auch dies zu vermitteln ist Ziel des Rahmenlehrplans.
BEZUG ZUM RAHMENLEHRPLAN
Im Kapitel Staatsbürgerkunde werden knapp und eher stichwortartig die Grundlagen und Grundbegriffe des deutschen Staats- sowie des Europarechts, soweit sie für das Verständnis von Zusammenhängen sowie für Prüfungen von Bedeutung sind, und die Grundrechte des Grundgesetzes dargestellt.
1 Staatsform der Bundesrepublik
Die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat (Art. 20 GG).
Das Grundgesetz (GG) – die Verfassung der Bundesrepublik – enthält das Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit. Ausdruck der Rechtsstaatlichkeit ist im Wesentlichen:
BINDUNG AN RECHT UND GESETZ.
Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, Verwaltung und Rechtsprechung, an Recht und Gesetz gebunden. Sie soll nicht nur gesetzkonform, sondern auch »gerecht« handeln.
FREIHEIT DES*DER BÜRGER*IN.
Der Rechtsstaat hat dem*der einzelnen Bürgerin einen Bereich persönlicher Freiheit zu sichern. Ausdruck der Freiheitsrechte des*der Bürger*in sind die Grundrechte.
KONTROLLE DER STAATSGEWALT.
Durch unabhängige Gerichte soll garantiert werden, dass staatliches Handeln stets kontrolliert und auf seine Rechtmäßigkeit hin überprüft werden kann (Art. 19 Abs. 4 GG).
Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus (Art. 20 Abs. 2 GG). Die Bundesrepublik ist i. W. eine repräsentative Demokratie, d. h. das Volk entscheidet nicht unmittelbar über politische Fragen, sondern gewählte Volksvertreter werden »für das Volk« tätig. Wesentlicher Bestandteil des Demokratiegebotes ist das Wahlrecht. Das Volk muss in allgemeinen, unmittelbaren, gleichen, freien und geheimen Wahlen Abgeordnete für die Parlamente wählen können.
Das Demokratiegebot erschöpft sich nicht in den Wahlen zu den Parlamenten (Bundestag, Landesparlamente, Kommunalparlamente). Zunehmend werden Formen sog. »direkter Demokratie« eingeführt: Volks- oder Bürger*innenbegehren und -entscheide, die inzwischen in (fast) allen Bundesländern vorgesehen sind. Daneben verlangt das Demokratiegebot danach, dass die wichtigsten Lebensbereiche ebenfalls demokratisiert werden, so die Arbeitswelt durch Mitbestimmung am Arbeitsplatz, so das Leben im Heim durch Mitwirkung der Heimbewohner in Heimbeiräten, so die Schulen und Universitäten durch Mitwirkung und Mitbestimmung der Schüler*innen und Studierenden. Kern der Demokratie ist die Berechtigung und Bereitschaft von Bürger*innen, sich für Angelegenheiten des Gemeinwesens zu engagieren (vom politischen bis zum bürgerschaftlichen Engagement).
Im Gegensatz zur Monarchie, in der ein (durch Erbfolge bestimmter) Monarch Staatsoberhaupt ist, wird in der Bundesrepublik die Stellung des Staatsoberhauptes von einem gewählten (Bundes-)Präsidenten eingenommen (Wahl durch Bundesversammlung).
Der Staat ist zur Herstellung sozialer Gerechtigkeit verpflichtet (Art. 20 Abs. 1 GG), insbesondere durch Fürsorge für Hilfsbedürftige oder sonst Benachteiligte, durch Ausgleich sozialer Gegensätze und Abbau von Abhängigkeitsverhältnissen.
Bund und Länder haben grundsätzlich gleichberechtigten Staatscharakter. Sie können für ihren jeweiligen Bereich Gesetze erlassen (Art. 70 ff. GG) und Hoheitsrechte ausüben.
Wiederholungsfragen
1. Welche Staatsform hat die Bundesrepublik Deutschland?
2. Was versteht man unter Rechtsstaatlichkeit?
3. Was bedeutet Demokratie?
2 Staatsorgane
Die staatlichen Aufgaben sind auf drei »Gewalten« verteilt – die Legislative (Parlamente), die Exekutive (Verwaltung, Regierung) und die Judikative (Gerichte). Die Organe sollen unabhängig voneinander ihre Aufgaben durchführen und sich gegenseitig kontrollieren.
Die Organe der Gesetzgebung sind die Parlamente (Bundestag, Landesparlamente). In den Art. 70 ff. GG sind die Gesetzgebungsbefugnisse geregelt. Danach haben grundsätzlich die Länder das Recht, Gesetze zu erlassen, soweit das Grundgesetz nichts anderes bestimmt. In Art. 73 GG ist festgelegt, für welche Bereiche der Bund die alleinige Gesetzgebungsbefugnis hat, in Art. 74 GG was der konkurrierenden Gesetzgebung unterfällt. Bei letzterer haben die Länder solange die Gesetzgebungsbefugnis, wie der Bund von seinem Recht keinen Gebrauch gemacht hat. Die sog. Rahmengesetzgebung (ehemals Art. 75 GG) wurde im Zuge der Föderalismusreform im Jahre 2006 abgeschafft. Bisher erlassene Rahmenvorschriften gelten jedoch solange weiter, wie keine neuen Regelungen der jeweiligen Materie vorgenommen wurden.
Das Gesetzgebungsverfahren – für Bundesgesetze – schreibt eine Beteiligung des Bundesrates vor, der die Interessen der Länder vertritt.
Bundespräsident, Bundesregierung und Landesregierungen sowie die öffentliche Verwaltung bilden die Exekutive. Aufgabe der Verwaltung ist die Ausführung von Bundes- und Landesgesetzen.
Die öffentliche Verwaltung als Teil der Exekutive ist in der Bundesrepublik in drei Hauptebenen untergliedert:
die Verwaltung des Bundes,
die Verwaltung der Länder,
die Kommunalverwaltung.
Jede Verwaltungsebene hat einen genau abgegrenzten Aufgabenbereich und ist, wie die Übersicht zeigt, in sich gegliedert.
Die Bundesregierung und die Landesregierungen können als Teil der Exekutive in engen Grenzen auch Rechtssätze – Rechtsverordnungen – erlassen (z. B. die Rechtsverordnungen zum SGB IX). Hierzu muss die Exekutive gesetzlich ermächtigt worden sein, da hierdurch die Gewaltenteilung durchbrochen wird (Art. 80 GG).
Der Bundespräsident (Art. 59 GG) vertritt die Bundesrepublik Deutschland nach außen hin. Er wird von der Bundesversammlung (Vertreter des Bundes- und der Landtage) auf 5 Jahre gewählt (Art. 54 GG).
Die Bundesregierung wird geführt und gebildet vom Bundeskanzler, der die Richtlinien der Politik bestimmt und die Minister beruft (Art. 65 GG). In den Bundesländern werden die Regierungen je nach Landesverfassung auf unterschiedliche Weise gebildet.
Die Entscheidung von Rechtsfragen im Streitfalle erfolgt durch die Gerichte. Die Rechtsprechung ist in ein System unterschiedlicher Gerichtszweige und Instanzen gegliedert.
Wiederholungsfragen
1. Was versteht man unter Gewaltenteilung?
2. Kann die Exekutive Rechtssätze erlassen?
3. Welche unterschiedlichen Gerichtszweige gibt es?
3 Grundrechte
Im Grundgesetz sind Grundrechte der Bürger*innen formuliert. Diese Grundrechte sollen dem*der einzelnen Bürger*in einen persönlichen Freiheitsraum sichern (Freiheitsrechte), Gleichbehandlung gewährleisten (Gleichheitsrechte) und bestimmte Verfahrensrechte garantieren (Rechtsschutz durch unabhängige Gerichte) sowie den Bestand gesellschaftlicher Institutionen gewährleisten, z. B. freie Presse. Die Grundrechte gelten grundsätzlich nur zwischen Staat und Bürger*innen (s. u.).
Fall 1:
Ein Berufsverband für Pflegeberufe ruft zu einer Kundgebung und Demonstration auf, um einen Flächentarifvertrag für die Langzeitpflege einzufordern. Hunderte von Pflegefachpersonen ziehen durch die Innenstadt. Sie nehmen ihr Recht auf freie Meinungsäußerung aus Art. 5 und das Versammlungsrecht aus Art. 8 GG wahr.
Neben der Bedeutung der Grundrechte als subjektives Recht jede*n Bürger*in kommt den Grundrechten eine wesentliche Bedeutung als »objektives« Recht zu: Gesetze, Urteile und Verwaltungshandeln, die im Widerspruch zu Grundrechten stehen, sind rechtswidrig.
Das Bundesverfassungsgericht hat die Finanzierung der Pflegeversicherung in Teilen für verfassungswidrig erklärt. Familien mit Kindern werden nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichtes übermäßig belastet, sowohl durch die Kindererziehung als auch durch die Pflege und Pflegeaufwendungen.3 Als Reaktion auf das Urteil wurde 2004 durch die damalige rot-grüne Bundesregierung ein »Kinderlosenzuschlag« für die Beiträge zur Pflegeversicherung in Höhe von derzeit 0.25 Beitragssatzpunkten gesetzlich verankert, § 55 Abs. 3 SGB XI.
Schutz der Menschenwürde (Art. 1 GG)
Art. 1 GG schützt den Menschen als eigenverantwortliche Persönlichkeit und gebietet Achtung vor jedwedem Menschen, unabhängig von seiner Lebenssituation und seinen geistigen und körperlichen Fähigkeiten. Der Schutz der Menschenwürde beinhaltet den Schutz vor Vernichtung und gänzlicher Abhängigkeit. Bei dem Schutz der Menschenwürde handelt es sich nicht um ein Grundrecht, sondern um eine verbindliche anthropologische Orientierung für die in Art. 2 ff. GG folgenden Grundrechte.4
Unvereinbar mit dem Schutz der Menschenwürde ist es, Hochbetagten auf Pflege angewiesenen Menschen und Menschen mit Demenz wegen ihrer begrenzten Lebensperspektive und ihres Alters den Zugang zur gesundheitlichen Versorgung zu verwehren. Das gilt auch dann wie bei der COVID-19-Pandemie, wenn nur eine begrenzte Zahl von Intensivbehandlungskapazitäten in Krankenhäusern zur Verfügung steht.
»Im alltäglichen pflegerischen Handeln bedeutet die Respektierung der Menschenwürde nichts anderes als die Einhaltung der in unserem Kulturkreis üblichen Verhaltensregeln für die Anrede, den Schutz der Intim- und Privatsphäre und die Respektierung des ›Eigensinns‹ der Bewohner*innen.«
(Braun/Halisch, S. 12)
Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2 Abs. 1 GG)
Aus Art. 2 Abs. 1 GG wird ein Anspruch auf freie Arztwahl abgeleitet.5 Die zwangsweise Unterbringung alter Menschen in Altenheimen durch die »Fürsorgebehörde« wurde als Verstoß gegen Art. 2 Abs. 1 GG angesehen.6
Das Recht auf freie Entfaltung soll dem*der einzelnen Bürger*in einen autonomen Bereich privater Lebensgestaltung sichern.
Leben und körperliche Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 GG)
Unter besonderem Schutz stehen das Leben und die körperliche Unversehrtheit der Person. Dieses Grundrecht kennt zwei Seiten: Einmal geht es um die Erhaltung von Leben und Gesundheit auch mit Mitteln des Sozialstaates, zum anderen um das Verbot, das Leben und die Gesundheit der Bürger*innen zu verletzen.
»Die Forderung, sich an den Bedürfnissen und Gewohnheiten zu orientieren und Pflege als Unterstützung zur Erlangung größtmöglicher Selbstbestimmung der Bewohner*innen zu verstehen, ist in der Altenpflege elementar.«
(Braun/Halisch, S. 13)
Freiheit der Person (Art. 2 Abs. 2 GG)
Das Recht auf Freiheit der Person schützt vor Beschränkung in der körperlichen Bewegungsfreiheit. Art. 2 Abs. 2 GG garantiert das Recht, einen beliebigen Ort aufzusuchen und sich dort aufzuhalten. Die Einschränkung der Bewegungsfreiheit ist nur aufgrund eines Gesetzes möglich. Über die Zulässigkeit und die Fortdauer von Freiheitsentziehungen hat allein der*die Richter*in zu entscheiden (Art. 104 GG). Auch in Zeiten der COVID-19-Pandemie dürfen Eingriffe in Freiheitsrechte nur auf der Grundlage eines richterlichen Beschlusses erfolgen und nicht etwa durch das Gesundheitsamt veranlasst werden (vgl. Alltagsgeschichte S. 17).
Gleichheitsgrundsatz (Art. 3 GG)
Art. 3 GG verbietet eine ungerechtfertigte Ungleichbehandlung. Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen und seiner Behinderung benachteiligt oder bevorzugt werden. Durch die 1994 vorgenommene Grundgesetzänderung wurde der Staat zur Förderung der tatsächlichen Durchsetzung der Gleichberechtigung von Männern und Frauen verpflichtet, Art. 3 Abs. 2 S. 2 GG.
Verstoß: Geringere Entlohnung von Frauen unter Hinweis auf die zu ihren Gunsten geltenden Schutzgesetze.7
Ebenso enthält Art. 3 GG ein Benachteiligungsverbot für Menschen mit Behinderungen.
Glaubens- und Gewissensfreiheit (Art. 4 GG)
Kein Land der Europäischen Union darf seine Bürgerinnen und Bürger an einer freien Religionsausübung und Glaubensentfaltung behindern. Auch die deutsche Verfassung schützt Glaubens- und Gewissensfreiheit völlig ohne Ansehen der Religion und Glaubensrichtung. Begrenzungen werden allerdings bei bestimmten Sekten gemacht, die ihre Mitglieder in Abhängigkeit zu sich bringen und deren Grundrechte bedrohen. Besonders problematisch sind radikale Strömungen in bestimmten Religionsrichtungen, die ihre religiösen Vorstellungen mit Gewalt durchsetzen wollen. In der Pflege leitet man zunächst aus Art. 4 GG die Toleranz gegenüber den unterschiedlichen Glaubensweisen ab.8
Vereinigungs- und Koalitionsfreiheit (Art. 9 GG)
Art. 9 GG schützt die Freiheit, Vereinigungen zu bilden. Insbesondere wird der Zusammenschluss von Arbeitnehmern in Gewerkschaften gewährleistet.
Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis (Art. 10 GG)
Jede schriftliche Nachricht von Person zu Person, d. h. neben Briefen auch Telegramme, Postkarten, Drucksachen, Postwurfsendungen, unterliegt dem Briefgeheimnis. In gleicher Weise geschützt ist der ungestörte Postverkehr mitsamt der direkten Zustellung der Post an den Empfänger. Verstoß: Abgabe der Post für Bewohner*innen in Altenwohnheimen und Altenheimen an Heimmitarbeiter.
Unverletzlichkeit der Wohnung (Art. 13 GG)
Sinn des Art. 13 GG ist der Schutz eines räumlichen Bereichs, in dem der Einzelne ungestört und unbeobachtet tun und lassen darf, was ihm beliebt.9 »Unverletzlich« sind nicht nur Wohnungen im engeren Sinn, sondern auch Hotelzimmer, Gästezimmer, Büroräume und auch: die Zimmer von Bewohner*innen in Alten- und Pflegeheimen.10
Wiederholungsfragen
1. Worin liegt die Bedeutung der Grundrechte?
2. Nennen Sie einige wichtige Grundrechte!
4 Exkurs: Grundrechtsgeltung in Heimen und die Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger Menschen
Grundsätzlich gelten die Grundrechte nur zwischen Staat und Bürger*innen. Der Staat hat die Grundrechte des*der Bürger*in zu respektieren und darf sie nicht unverhältnismäßig einschränken.
Zwischen Bürger*innen haben Grundrechte grundsätzlich keine unmittelbare Geltung. So kann die Tochter von ihren Eltern nicht unter Hinweis auf Art. 3 GG – Gleichbehandlung – die gleiche finanzielle Unterstützung während der Ausbildung verlangen, wie sie ihrem Bruder großzügig gewährt wird. Ebenso wenig kann der verlassene Ehemann seiner abtrünnigen Ehefrau die neue Liaison mit Hinweis auf Art. 6 GG – Schutz der Ehe – verbieten oder ein Arbeitsloser ein Recht auf Einstellung bei VW aus Art. 3 GG oder Art. 12 – Berufsfreiheit – ableiten. Sie alle sind auf die allgemeinen Zivil- oder Strafgesetze verwiesen.
Fall 2:
In einer Heimordnung wird dem Heimpersonal das Recht eingeräumt, jederzeit die Zimmer und Wohnungen der Bewohner*innen zu betreten.
In Heimen gelten Grundrechte zum Schutz der Bewohner*innen nicht unmittelbar. Sie gelten aber mittelbar, da die Bestimmungen des Heimgesetzes, bzw. der jeweiligen bereits in Kraft getretenen Landesheimgesetze, so ausgelegt werden müssen, dass die Grundrechte der Bewohner*innen zur Geltung kommen. Das Heimgesetz dient dem Schutz der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner vor Beeinträchtigungen. Beeinträchtigungen stellen gerade Eingriffe in Grundrechte der Bewohner*innen dar. Daher sind bevormundende und entrechtende Regelungen in Heimordnungen und Heimverträgen wegen Grundrechtsverstoßes rechtswidrig. Dies gilt vor allem angesichts der Abhängigkeit der Heimbewohner von der Institution, in der sie leben, und ihren Mitarbeitern.
Grundrechtsverstöße im Heim
Jederzeitiges Eintrittsrecht in Pflegeheimzimmer, s. Fall 2; Art. 13 GG
Überwachung der Bewohner*innen im Zimmer durch Monitor, Art. 1 i. V. m. Art. 2 Abs. 1 GG
einengende, kurze Besuchszeiten, Art. 2 Abs. 1, Art. 6 GG
Ausgehverbot, Art. 2 Abs. 1 GG
Verbot, Gäste zu beherbergen (im Altenheim), Art. 2 Abs. 1 GG
Verbot, Kleintiere und Zierfische im Alten- und Altenwohnheim zu halten, Art. 2 Abs. 1 GG.11
Heimverträge, in denen die pauschale Einwilligung in Fixierungsmaßnahmen im »Bedarfsfall« verlangt wird, Art. 2 Abs. 2, Art. 104 GG12 oder dem Heim ein »Verlegungsrecht« zusteht.13
Dokumentation aller pflegerischen Maßnahmen ohne Einwilligung des*der Bewohners*in Art. 1,2 Abs. 2 GG
In Zeiten der Corona-Pandemie sind Grundrechtseingriffe zur Sicherstellung des Infektionsschutzes auch in Heimen gesetzlich und über Verordnungen der Länder geregelt worden. Sie müssen auch unter dem Vorzeichen von der Corona-Pandemie und den in diesen Zeiten auftretenden Infektionsschutzrisiken sich streng an die Eignung, die Erforderlichkeit und Verhältnismäßigkeit halten. Dauerhafte Eingriffe in die Grund- und Menschenrechte von Bewohner*innen im Pflegeheim ohne Beachtung der Besonderheiten des Einzelfalls sind verfassungsrechtlich nicht zulässig.14
Wiederholungsfragen
1. Gelten Grundrechte auch unmittelbar zwischen Bürger*innen?
2. Welche Grundrechte spielen im pflegerischen Alltag eine besondere Rolle?
Die Grund- und Menschenrechte pflegebedürftiger Menschen wurden in der Charta der Rechte Pflegebedürftiger in eine verständlichere Sprache übersetzt und sollen als eine Art Leitlinie für die Altenpflege dienen. Die Tatsache, dass man eine Charta erstellt hat oder erstellen musste, zeigt wie wenig selbstverständlich die Beachtung von Grund- und Menschenrechten in Heimen war. Mit der Charta wird der Versuch unternommen, ihre Verbindlichkeit für die Pflege zu unterstreichen und zu verbreitern.
CHARTA DER RECHTE HILFE- UND PFLEGEBEDÜRFTIGER MENSCHEN
ARTIKEL 1:SELBSTBESTIMMUNG UND HILFE ZUR SELBSTHILFE
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf Hilfe zur Selbsthilfe sowie auf Unterstützung, um ein möglichst selbstbestimmtes und selbstständiges Leben führen zu können.
ARTIKEL 2:KÖRPERLICHE UND SEELISCHE UNVERSEHRTHEIT, FREIHEIT UND SICHERHEIT
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, vor Gefahren für Leib und Seele geschützt zu werden.
ARTIKEL 3: PRIVATHEIT
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf Wahrung und Schutz seiner Privat- und Intimsphäre.
ARTIKEL 4:PFLEGE, BETREUUNG UND BEHANDLUNG
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf eine an seinem persönlichen Bedarf ausgerichtete, gesundheitsfördernde und qualifizierte Pflege, Betreuung und Behandlung.
ARTIKEL 5:INFORMATION, BERATUNG UND AUFKLÄRUNG
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf umfassende Informationen über Möglichkeiten und Angebote der Beratung, der Hilfe, der Pflege sowie der Behandlung.
ARTIKEL 6:KOMMUNIKATION, WERTSCHÄTZUNG UND TEILHABE AN DER GESELLSCHAFT
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht auf Wertschätzung, Austausch mit anderen Menschen und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben.
ARTIKEL 7:RELIGION, KULTUR UND WELTANSCHAUUNG
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, seiner Kultur und Weltanschauung entsprechend zu leben und seine Religion auszuüben.
ARTIKEL 8:PALLIATIVE BEGLEITUNG, STERBEN UND TOD
Jeder hilfe- und pflegebedürftige Mensch hat das Recht, in Würde zu sterben.
Die Behindertenrechtskonvention
AUSZUG AUS DER BEHINDERTENRECHTSKONVENTION (IN EINFACHER SPRACHE)
WOHNEN
Behinderte Menschen sollen selbst entscheiden:
Wo möchte ich wohnen.
Mit wem möchte ich wohnen.
Behinderte Menschen haben die Wahl.
Sie können ihre Wohn-Form aussuchen.
In der eigenen Wohnung oder einem Wohn-Heim.
Alleine oder in einer Wohn-Gemeinschaft.
Oder mit dem Partner oder der Partnerin.
In der Stadt oder auf dem Land.
Und sie bekommen die nötige Hilfe da, wo sie wohnen.
Niemand muss in ein Heim ziehen, nur weil er oder sie Unterstützung braucht. Die Unterstützung soll zu der Person kommen. Alle Menschen haben ein Recht auf Privatsphäre.
Auch behinderte Menschen – egal, wo sie wohnen: Das heißt:
Niemand darf in die Wohnung oder das Zimmer kommen, ohne zu fragen.
Niemand darf die Post lesen, ohne zu fragen.
Auch auf Pflege angewiesene Menschen sind im rechtlichen Sinne Menschen mit Behinderung. Nicht jede*r Behinderte ist pflegebedürftig aber jed*r Pflegebedürftige behindert i.S.d. § 2 SGB IX: Er ist in seiner Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aufgrund seiner körperlichen oder geistigen Funktionseinbußen behindert. In der UN-Konvention für die Menschenrechte für Behinderte wurde 2006 festgelegt, dass Menschen mit Behinderung egal welchen Alters nicht diskriminiert werden dürfen, dass sie in ihrer gleichberechtigten Teilhabe am Leben der Gemeinschaft gefördert werden müssen und ihre Menschenrechte wirksam zu schützen sind. Insbesondere vor Gewalt, Misshandlung und Freiheitsentziehungen sind sie zu schützen. Im März 2009 wurde die UN-Behindertenrechtskonvention von Deutschland ratifiziert.15 Sie ist nun von allen staatlichen Instanzen zu beachten und in den deutschen Gesetzen umzusetzen. Wie der Auszug aus der BRK in leichter Sprache unterstreicht, ist auch die freie Wahl des Wohnortes in der BRK garantiert. Grundsätzlich hat jeder Mensch, auch der pflegebedürftige ein Recht auf die Wahl seines Wohnortes.
Wiederholungsfragen
1. Gilt die Behindertenrechtskonvention auch für Menschen mit Demenz?
2. Was sind die wesentlichen Rechte, die in der BRK verankert sind?
COVID 19 UND GRUNDRECHTE
Auch unter der Geltung von Coronaverordnungen gelten Grund- und Menschenrechte im Heim. Bewohner*innen sind erwachsene Menschen, die selbst auf die Einhaltung des Infektionsschutzes achten müssen. Ohne richterlichen Beschluss dürfen an Demenz erkrankte Bewohner*innen nicht im Heim festgehalten werden. Quarantäne darf nicht mit Hilfe von Zwang und Freheitsentziehenden Maßnahmen durchgesetzt werden – es sei denn, die wurden richterlich genehmigt.
5 Europäische Union
Fall 3:
Die teilzeitbeschäftigte Hausfrau Marianne, die in einer Sozialstation jobbt, verlangt Urlaubsgeld und Zeitzuschläge ebenso wie ihre Vollzeit-Kolleg*innen und beruft sich dabei auf das Geschlechterdiskriminierungsverbot aus Art. 119 EWG Vertrag.
Die Bedeutung der Europäischen Union in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht wächst. Nicht nur die sogenannte »Migration« von Arbeitnehmer*innen nimmt zu, auch Rentner verbringen ihren Lebensabend z. T. im europäischen Ausland. Viele Pflegekräfte aus dem Ausland arbeiten inzwischen in Deutschland, und es stellt sich die Frage, inwieweit ihre Ausbildungsabschlüsse anerkannt werden. Entsprechende Fragen stellen sich, wenn etwa Altenpfleger*innen im europäischen Ausland arbeiten wollen. Das Recht auf Freizügigkeit wird allen Bürger*innen der Europäischen Union inzwischen garantiert. Gerade in der Pflege fehlt es aber noch an einheitlichen Standards der Ausbildungsgänge. Die europäischen Institutionen gewinnen bis in den Alltag der Pflege hinein an Bedeutung. Von daher ist es wichtig, die wichtigsten Institutionen der Europäischen Union zu kennen.
Der Europäische Rat ist das höchste Gremium der Europäischen Union. Er setzt sich aus den Regierungschefs der Mitglieder zusammen und tagt mindestens zweimal pro Jahr. Die Präsidentschaft im Rat wird turnusmäßig alle 6 Monate gewechselt. Der Europäische Rat tagt zumeist in dem Land, das die Präsidentschaft innehat. Der Europäische Rat entscheidet über die Rahmenbedingungen und über Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union.
Der Ministerrat ist mit je einem*eines weisungsgebundenen Fachminister*in aus den Mitgliedsländern besetzt. Zusammen mit der Kommission ist er an der Gesetzgebung der Europäischen Union beteiligt und entscheidet durch Mehrheitsbeschluss über die Annahme von Verordnungen und Gesetzen, vergleichbar mit nationalen Parlamenten, mit Sitz in Brüssel.
Die Kommission ist die Exekutive der Europäischen Union. Sie setzt sich aus unabhängigen Kommissaren zusammen, deren Anteil sich aus vorstehender Übersicht ergibt. Die Kommissionsmitglieder werden für vier Jahre von den nationalen Regierungen ernannt. Die Kommission hat ein Vorschlags- und Initiativrecht für die Gesetzes- und Verordnungsvorschläge und steht den europäischen Behörden als oberstes Gremium (vergleichbar einer Regierung) vor. Sitz ist in Brüssel.
Das Europäische Parlament setzt sich aus Abgeordneten aller Mitgliedstaaten zusammen, die für fünf Jahre gewählt werden. Das Wahlverfahren ist in den Mitgliedsländern noch unterschiedlich. Hauptaufgabe des Europäischen Parlaments ist die Kontrolle der Kommission, die sie mit 2/3 ihrer Stimmen zum Rücktritt zwingen kann. Wichtigstes Recht ist ihre Mitbestimmung in Haushaltsfragen. Sitz in Straßburg.
Die Aufgabe des Europäischen Gerichtshofs ist es, Streitfälle bei der Auslegung und Ausführung von Richtlinien und Verordnungen der Europäischen Union zu klären. Er ist sowohl zuständig für Streitfälle zwischen den Mitgliedsstaaten als auch für Klagen von Bürger*innen wegen Verletzungen europäischer Rechtsnormen, so in Fall 3, wo der Klägerin Recht gegeben und wegen der typischerweise Frauen betreffenden Teilzeitarbeit ein Anspruch auf Gleichbehandlung mit Vollzeitbeschäftigten eingeräumt wurde.
Auch die Frage der »Export«-fähigkeit von Sozialleistungen, etwa den Pflegegeldern, hat den EuGH beschäftigt: Sie wurde, jedenfalls für Geldleistungen, bejaht.16
Weitere wichtige Institutionen der Europäischen Union sind der Europäische Rechnungshof sowie die Europäische Zentralbank.
Das Konzept der Europäischen Union ist das einer politischen und wirtschaftlichen Union der europäischen Länder. In ihnen soll freier Wettbewerb gelten, der auch für den Bereich des Sozialen Konsequenzen hat: Harmonisierung der sozialen Sicherungssysteme, Niederlassungsfreiheit für EU-Bürger*innen, »freier Markt«, auch im Bereich des Sozialen und der Pflege.17
Ein weiterer wichtiger Schritt war die Einführung der gemeinsamen Währung Euro für einen Teil der Mitglieder der EU 2001. Im Jahr 2005 fanden in einer ganzen Reihe von europäischen Mitgliedsländern Referenden zur Annahme der Europäischen Verfassung statt, in der die Kompetenzen der Institution der europäischen Union transparenter festgelegt und die Rechte der Bürgerinnen und Bürger verbindlicher als bisher geregelt werden sollten. So wurde der Vertrag von Lissabon 2007 geschlossen, der eine etwas »abgespeckte« Verfassungsregelung enthält. Hat die Europäische Union für einige Mitgliedländer an Attraktivität verloren. Im Jahre 2016 hat so Großbritannien in einem Referendum entschieden, aus der Europäischen Union auszuscheiden, der sogenannte Brexit.
Wiederholungsfrage
Nennen Sie die wichtigsten Institutionen der Europäischen Union.
6 Exkurs: Wahlen im Pflegeheim
Grundsätzlich sind alle Bürger*innen über 18 Jahre wahlberechtigt. Bis 2020 waren vom Wahlrecht die Bewohner*innen ausgeschlossen, die einen Betreuer für alle Angelegenheiten hatten. Auch sie können jetzt wählen, etwa bei der Bundestagswahl 2021.
Heimbewohner*innen nehmen genau wie alle anderen Bürger*innen an den Wahlen teil. Die Heimleitung hat die Bewohner*innen dabei zu unterstützen, z. B. bei Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheines, Briefwahl, Korrektur des Wählerverzeichnisses. Kann ein*eine Heimbewohner*in aufgrund körperlicher Gebrechen oder Krankheit das Wahllokal nicht aufsuchen, kann er*sie auf dem Weg der Briefwahl von seinem*ihrem Wahlrecht Gebrauch machen.
DÜRFEN PFLEGEHEIMBEWOHNER NICHT WÄHLEN?
»Wahl-Panne im Altersheim« stand über einer der zahlreichen Zeitungsmeldungen, die wenige Tage vor der Bundestagswahl darüber berichteten, dass in der Stadt Wuppertal die Wahlbenachrichtigungen für rund 1000 ältere Heimbewohner wieder zurückgezogen worden waren, »ohne sie über die Rechtslage des Wahlrechts aufzuklären«. Diese böse Panne der Verwaltung wurde durch eine Panne in der Berichterstattung noch übertroffen: Zitiert wurde in den Zeitungsberichten (und in der zugrundeliegenden Agenturmeldung) ein Mitarbeiter aus dem Amt des Düsseldorfer Landeswahlleiters mit der Erklärung, Pflegeheimbewohner erhielten zunächst keine Wahlbenachrichtigung, es sei denn, sie wiesen nach, dass sie geschäftsfähig sind.
Ob ein »Versprecher« auf der einen oder ein »Hörfehler« auf der anderen Seite den Ausschlag gab, konnten wir nicht mehr ganz klären. Auf jeden Fall war der medizinische Begriff der Pflegebedürftigkeit mit dem juristischen Begriff der Pflegschaft fälschlicherweise gleichgesetzt worden.
Aus: KDA Info Dienst 1/87 S. 13.
In größeren Heimen kann ein Sonderwahlbezirk für die Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen eingerichtet werden, wenn ein besonderes Bedürfnis dafür besteht, etwa: sehr viele immobile Bewohner*innen, ungünstige Lage des nächsten Wahllokals. In kleineren Heimen können Filialen von Wahllokalen gebildet werden, für die ein beweglicher Wahlvorstand gebildet wird. Die Heimleitung kann Entsprechendes beim örtlichen Wahlleiter beantragen.19
Sind Heimbewohner*innen nicht selbst in der Lage, den Stimmzettel auszufüllen, können sie eine Person ihres Vertrauens bestimmen, die ihnen bei der Stimmabgabe behilflich ist. Dies können sein: Verwandte, Mitbewohner*innen, Pflegepersonal, Heimleiter*in oder auch ein Mitglied des Wahlvorstandes.
Der Hilfeleistende hat sich zu beschränken auf: Vorlesen des Stimmzettels, Bezeichnung der Stelle, an der der Stimmzettel zu kennzeichnen ist, Vornahme der Kennzeichnung entsprechend der Weisung des Wählers.
Jede Beeinflussung, Verfälschung oder Bekanntgabe des Wählerwillens ist unter Strafe gestellt (§§ 107 – 108 a StGB).
Wiederholungsfragen
1. Wer ist vom Wahlrecht ausgeschlossen?
2. Was sind Sonderwahlbezirke?
3. Was ist zu tun, wenn ein*eine Heimbewohner*in Hilfe bei der Stimmabgabe benötigt?
3 Vgl. BVerfG, Beschluss vom 03. 04. 2001, Az 1BvR 1629/94.
4 Vgl. Klie, Menschenwürde als ethischer Leitbegriff in: Blonski, Harald (Hg.), Ethik in der Gerontologie und Altenpflege, Hagen 1998.
5 Vgl. v. Münch/Niemöhlmann Art. 2 Rz 19; BVerfGE 16, S. 303.
6 Vgl. v. Münch a. a. O.
7 BAGE 1, S. 258
8





























