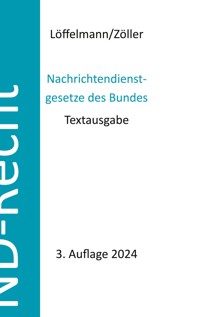5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Rechtspolitik
- Sprache: Deutsch
Die Publikation versammelt Beiträge zu rechtspolitischen Themen des Jahres 2016 aus dem unabhängigen Forum für gute Rechtspolitik recht + politik (www.recht-politik.de). Ein Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf strafrechtlichen Themen. In einem den Band abschließenden - vorläufigen - Resümee zur Rechtspolitik der 18. Legislaturperiode werden nochmals Beiträge aus den vergangenen Jahren zusammengeführt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 195
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
INHALT
Verschärfung des Ausweisungsrechts
Strafbarkeit des Sportwettbetrugs
Neues vom Afrikanischen Menschenrechtsgerichtshof
Verbesserung des Schutzes der sexuellen Selbstbestimmung
Novellierung des Bayerischen Verfassungsschutzgesetzes
Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung
Reform des Sexualstrafrechts
Regelung der Ausland-Ausland-Fernmeldeaufklärung
Verrat von Staatsgeheimnissen
Gesetz für ein effizienteres und praxistauglicheres Strafverfahren
Bayerisches Integrationsgesetz
Rechtspolitik der 18. Legislatur – ein vorläufiges Resümee
Verschärfung des Ausweisungsrechts
Die massiven Ausschreitungen in der Silvesternacht in Köln und Hamburg, das mutmaßliche Versagen der Polizei, das nachfolgende Durcheinander von Schuldzuweisungen und widersprüchlichen Informationen haben in der Bevölkerung für große Verunsicherung gesorgt. Nur wenige Tage nach den Vorfällen haben die Bundesminister für Inneres und für Justiz einen Vorschlag für eine Gesetzänderung zur Erleichterung der Ausweisung und Abschiebung straffällig gewordener Ausländer vorgelegt. Von manchen wurde der Vorschlag begrüßt, von anderen als „Aktionismus“ abgelehnt. Zugleich wurde von zwei ehemaligen renommierten Richtern des Bundesverfassungsgerichts die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung massiv kritisiert und eine existenzielle Bedrohung des Rechtsstaats ausgemacht. Wie bedrohlich ist die Situation tatsächlich?
Die Ereignisse der Silvesternacht von Köln und Hamburg scheinen ein in der Bevölkerung verbreitetes Unbehagen über einen gefühlten Zusammenhang von Flüchtlingsströmen und Kriminalität zu bestätigen, doch man muss sich vor Vereinfachungen hüten. Einige Zahlen: In Deutschland lebten Ende 2014 rund 8,1 Mio. Ausländer, das waren etwa 10 % der Gesamtbevölkerung (Quelle: Ausländerzentralregister). Nach der Polizeilichen Kriminalstatistik (PKS) für dasselbe Jahr wurden von rund 2,15 Mio. Straftaten etwa 617.000 oder knapp 29 % von nichtdeutschen Tatverdächtigen verübt. In einigen Kriminalitätsbereichen gibt es dabei signifikant überdurchschnittliche Befunde, etwa bei Prostitutionsdelikten (~ 60 %), Zwangsheirat (~ 75 %), Menschenhandel (~ 75 %) oder schwerem Taschendiebstahl (~ 90 %). Die Zahlen der PKS sind bekanntlich mit Vorsicht zu genießen, denn sie bilden nicht das Anzeigeverhalten, Dunkelfelder und auch nicht den Ausgang der Strafverfahren ab. Eine Tendenz lassen sie dennoch erkennen, die sich auch mit den Erfahrungswerten von Justizpraktikern deckt. Ein – nicht repräsentatives – Beispiel: In der schwerpunktmäßig auf dem Gebiet der Betäubungsmitteldelikte tätigen Großen Strafkammer, der der Verfasser angehört, waren von 44 im Jahr 2015 verurteilten Personen 24 nichtdeutsche Staatsangehörige, darunter 12 aus den Balkanstaaten und 7 aus der Türkei. Nimmt man die deutschen Staatsangehörigen mit einem entsprechenden Migrationshintergrund hinzu, erhöht sich der Anteil auf mehr als zwei Drittel. Auch im Zeitverlauf kann man Veränderungen erkennen: Der Anteil nichtdeutscher Tatverdächtiger betrug laut PKS 1993 rund ein Drittel, nahm dann kontinuierlich ab und pendelte sich Ende der 2000er Jahren bei etwas über einem Fünftel ein, bevor Anfang der 2010er Jahre ein erneuter Anstieg zu verzeichnen war, zuletzt 2014 um einen Rekordwert von 14,7 %, ohne aber die früheren prozentualen Höchstwerte zu erreichen.
Man sollte aus derlei Beobachtungen keine vorschnellen Schlussfolgerungen ziehen, aber auch nicht die Augen davor verschließen, dass kriminogene Faktoren wie ein niedriger ökonomischer und sozialer Status, Bildungsferne oder auch ungünstige kriminalgeografische Umstände in Bevölkerungsgruppen mit Migrationshintergrund allgemein verstärkt auftreten. Eine andere Frage ist, ob und wie solche statistischen Erkenntnisse sich in einen Zusammenhang mit dem aktuellen Zustrom von Flüchtlingen bringen lassen. Die PKS (Tabelle 61) weist immerhin in den vergangenen Jahren bei einer moderaten Zunahme der Gesamtzahl der Tatverdächtigen einen zuletzt deutlichen Anstieg der tatverdächtigen Asylbewerber von 23.661 (2012) über 32.495 (2013) bis auf 53.890 (2014) aus. Das entspricht einer Zunahme von 1,13 über 1,55 auf rund 2,51 %. Das sind keine Größen, die in der Gesamtschau Anlass zu Sorge geben müssten, zumal diese Gruppe gerade nicht im Bereich „typischer“ Ausländerdelikte auffällig geworden ist, sondern eher durch sog. Rohheits-, Körperverletzungs- und einfache Eigentumsdelikte. Die Zahlen können aber durchaus als ein Indiz für eine durch den Zustrom von Flüchtlingen ausgelöste Kriminalitätszunahme im niedrigen Prozentbereich angesehen werden, eine – wenig überraschende – Entwicklung, die verdient, beobachtet zu werden. Die Zahlen zeigen andererseits, dass es verfehlt wäre, Kriminalität nichtdeutscher Tatverdächtiger mit der von Flüchtlingen verübten gleichzusetzen. Und hier muss man den Bogen zu den Ereignissen von Köln und den darauf folgenden politischen Reaktionen schlagen.
Der gemeinsame Vorschlag von BMI und BMJV
Der am 12. Januar 2016 der Öffentlichkeit präsentierte gemeinsame Vorschlag des Bundesinnen- und des Bundesjustizministeriums zieht Änderungen im Aufenthaltsgesetz (AufenthG) in Erwägung, um die Ausweisung krimineller Ausländer „weiter zu erleichtern“. Eine gewisse Ironie liegt dabei in der jüngeren Historie der entsprechende Regelungen: Erst mit Gesetz vom 27. Juli 2015 wurde die Systematik der §§ 53 ff. AufenthG, die die Ausweisung von Ausländern betreffen, grundlegend geändert. Sahen § 53 und § 54 AufenthG a. F. noch ein relativ rigides mehrstufiges System von zwingenden Ausweisungen und Ausweisungen im Regelfall vor, wurde durch die Neuregelung ein „weiches“ Modell geschaffen, das in jedem Einzelfall eine detaillierte Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Ausweisung und dem Bleibeinteresse des Betroffenen gebietet. So war nach § 53 AufenthG a. F. eine Ausweisung u. a. zwingend geboten, wenn ein Ausländer zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe von mindestens drei Jahren oder wegen eines Betäubungsmitteldelikts zu einer nicht zur Bewährung ausgesetzten Freiheitsstrafe verurteilt wurde. Nach § 54 AufenthG a. F. war die Ausweisung im Regelfall unter noch niedrigeren Voraussetzungen anzuordnen, z. B. bei einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz oder bei Verurteilung zu einer zu vollstreckenden Freiheitsstrafe. Demgegenüber gebietet § 53 AufenthG nun eine „unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls“ vorzunehmende Abwägung, bei der insbesondere die Dauer des Aufenthalts des Ausländers in Deutschland, seine persönlichen, wirtschaftlichen und sonstigen Bindungen im Bundesgebiet und im Herkunftsstaat oder einem anderen zur Aufnahme bereiten Staat sowie die Folgen der Ausweisung für Familienangehörige und Lebenspartner zu berücksichtigen sind. §§ 54 und 55 AufenthG enthalten nunmehr exemplarische Aufzählungen von schwer und besonders schwer wiegenden Ausweisungs- und Bleibeinteressen. Zu den Ausweisungsinteressen zählen dabei auch Verurteilungen zu Freiheits- und Jugendstrafen. Das neue Gesetz ist am 01. Januar 2016, gewissermaßen also koinzidierend mit den Vorfällen von Köln und Hamburg, in Kraft getreten.
Der gemeinsame Vorschlag von BMI und BMJV sieht nun vor, die Abwägungskriterien um den Gesichtspunkt zu ergänzen, „ob sich der Ausländer rechtstreu verhalten hat“. Außerdem soll die Liste der schwer und besonders schwer wiegenden Ausweisungsinteressen dahin erweitert werden, dass Straftaten gegen das Leben, die körperliche Unversehrtheit, die sexuelle Selbstbestimmung, das Eigentum oder des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, „sofern diese Straftaten mit Gewalt oder unter Anwendung von Drohungen mit Gefahr für Leib oder Leben oder mit List begangen sind“ und wegen dieser Straftaten eine Verurteilung zu einer Freiheits- oder Jugendstrafe erfolgte, eine stärkere Gewichtung erfahren. Für „seriell begangene Straftaten gegen das Eigentum“ soll dies unabhängig davon gelten, ob diese mit Gewalt, unter Anwendung von Drohung oder mit List begangen wurden. Außerdem weist der Vorschlag auf geplante Verschärfungen im Sexualstrafrecht hin, die sich bereits im Gesetzgebungsverfahren befinden. Völlig ausgereift dürfte der Vorschlag in technischer Hinsicht noch nicht sein. Irritierend ist namentlich die Gleichsetzung von Straftaten gegen ganz unterschiedliche Rechtsgüter wie einerseits Leben und körperliche Unversehrtheit, andererseits die Autorität staatlicher Vollstreckungsakte.
„Der Verwaltungsgerichtshof durfte (…) von Verfassungs wegen nicht darauf verzichten, das besondere Interesse an der sofortigen Vollziehbarkeit der angefochtenen Ausweisungsverfügung zu untersuchen und gegebenenfalls mit den Aufschubinteressen des Beschwerdeführers abzuwägen (…). (…) Der Verwaltungsgerichtshof hat sich mit diesem Schutzgehalt des Art. 8 EMRK nicht gesondert und mit der Vorschrift insgesamt nur unter dem Aspekt einer notwendigen Befristung der Ausweisung und damit verkürzt befasst. Das Recht auf Achtung des Privatlebens umfasst die Summe der persönlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Beziehungen, die für das Privatleben eines jeden Menschen konstitutiv sind (...) und denen angesichts der zentralen Bedeutung dieser Bindungen für die Entfaltung der Persönlichkeit eines Menschen bei fortschreitender Dauer des Aufenthalts wachsende Bedeutung zukommt (...). Ein Eingriff in die Rechte aus Art. 8 Abs. 1 EMRK muss gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK eine in einer demokratischen Gesellschaft notwendige Maßnahme darstellen, die durch ein dringendes soziales Bedürfnis gerechtfertigt und mit Blick auf das verfolgte legitime Ziel auch im engeren Sinne verhältnismäßig ist (...).“
BVerfG, Beschluss vom 10.05.2007, 2 BvR 304/07, Rn. 30, 33.
Auch gibt es logische Inkonsistenzen, etwa dergestalt, dass Straftaten gegen das Leben oder die körperliche Unversehrtheit nicht ohne Anwendung von Gewalt aber auch kaum unter Anwendung von List denkbar sind. Sprachlich ist der, bislang im Strafrecht so nicht vorkommende, Begriff der „seriell begangenen Straftaten“ zumindest gewöhnungsbedürftig. Da der Vorschlag keine konkreten Straftatbestände nennt, würden sich in der Rechtsanwendung ferner Auslegungsprobleme ergeben, z. B. dahin, ob zu den Straftaten gegen das Eigentum nur Vermögensdelikte oder auch Sachbeschädigungen zählen oder unter die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung Beleidigungen und Drohungen mit sexuellem Hintergrund fallen. Im Grundsatz zeigt der Vorschlag aber durchaus einen gangbaren Weg auf, das Ausweisungsrecht moderat zu verschärfen.
Dass eine derartige Gesetzesänderung nicht zu einer substanziellen Steigerung der Anzahl ausgewiesener Ausländer führen dürfte, drängt sich dennoch auf. Denn auch bei Vorliegen der beabsichtigten stärkeren Gewichtung bestimmten delinquenten Verhaltens ist die Ausweisung kein Automatismus, sondern bedarf einer aufwändigen Abwägung im Einzelfall, die zudem, im Falle eines Rechtsmittels, umfassend gerichtlich überprüft werden muss. Wie viel Ressourcen eine gut begründete Abwägungsentscheidung unter Berücksichtigung zahlreicher individueller Parameter bindet, weiß jeder, der damit beruflich zu tun hat. Hinsichtlich der am 1. Januar in Kraft getretenen „Aufweichung“ des Ausweisungsrechts, die die nunmehr beabsichtigte moderate „Verschärfung“ in einem anderen Licht erscheinen lässt, ist dem Gesetzgeber übrigens kein Vorwurf zu machen. Im Gegenteil. Das Änderungsgesetz setzt – das sei hier ausdrücklich hervorgehoben – in geradezu vorbildlicher Weise Vorgaben der höchstrichterlichen Rechtsprechung um, namentlich des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zu Art. 8 EMRK, des Bundesverfassungsgerichts und des Bundesverwaltungsgerichts (vgl. vgl. EGMR, Urteil vom 28.06.2007, Nr. 31753/02, Kaya/Deutschland; BVerfG, Beschluss vom 10.05.2007, 2 BvR 304/07, Beschluss vom 10.08.2007, 2 BvR 535/06; BVerwG, Urteil vom 14.02.2012, 1 C 7.11, Urteil vom 02.09.2009, 1 C 2/09, Urteil vom 14.10.2008, 10 C 48/07, Urteil vom 23.10.2007, 1 C 10/07; jew. m. zahlr. w. N.; BT-Drs. 18/4097, S. 49). Die Gesetzgebungstechnik, schon auf Ebene der Gesetzgebung Abwägungsmaßstäbe festzulegen und dadurch der Rechtsanwendung konkrete Abwägungskriterien an die Hand zu geben, verdient uneingeschränkt Zustimmung (vgl. näher zur Güterabwägung als Aufgabe guter Gesetzgebung recht + politik 4/2015). Die Gesetzgebungshistorie und die aktuellen politischen Bemühungen um eine Verschärfung des Ausweisungsrechts offenbaren allerdings ein grundsätzliches, ein strukturelles Dilemma: das, in dem sich der Rechtsstaat befindet, wenn von ihm ein pragmatisches, „beherztes“ Handeln erwartet wird, und er diese Erwartung nur unter Aufgabe seiner Grundsätze einlösen könnte.
Noch deutlicher wird dies im Hinblick auf die Behandlung von Flüchtlingen und Asylberechtigten. Deren Ausweisung ist nach § 53 Abs. 3 AufenthG nur zulässig, „wenn das persönliche Verhalten des Betroffenen gegenwärtig eine schwerwiegende Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellt, die ein Grundinteresse der Gesellschaft berührt und die Ausweisung für die Wahrung dieses Interesses unerlässlich ist.“ Hinter diesen sehr hohen Anforderungen, die nur in extremen Ausnahmefällen erfüllt sein werden, steht das Grund- und Menschenrecht auf Asyl nach Art. 16a GG, das auch in der Menschenwürde wurzelt (vgl. BVerfGE 54, 341, 357; 94, 49, 103). Vergegenwärtigt man sich die gravierenden Gefahren für Leib, Leben und Freiheit, vor denen politisch Verfolgte im Asyl Schutz suchen, ist das konsequent, denn seiner Menschenwürde kann nach den Grundwerten unserer Verfassung selbst der nicht verlustig gehen, der sich schwerste Verfehlungen hat zuschulden kommen lassen (BVerfGE 64, 261, 284). Anders als durch die Konnotation der Ausweisungsproblematik mit der Flüchtlingskrise in der Öffentlichkeit suggeriert, eignet sich die Ausweisung mithin von vornherein nicht als Mittel zur Kompensation hoher Flüchtlingszahlen. Hinzu kommt, dass Rechtsfolge der Ausweisung zunächst nur das befristete Erlöschen des Aufenthaltsrechts ist und Betroffene innerhalb einer bestimmten Frist ausreisen müssen. Das bedeutet nicht, dass sie das tatsächlich tun. Die Zahl der – alle Ausländer einschließenden – zwangsweisen Abschiebungen ist mit rund 10.000 jährlich (vgl. BT-Drs. 18/4025) im Verhältnis zur Größe der Migrationsströme (2014: rund 1,4 Mio. Zuwanderungen und etwa 900.000 Abwanderungen, Quelle: Migrationsbericht 2014) eher gering.
Der erodierende Rechtsstaat?
Was also ist zu tun, um die Quadratur des Kreises in Fragen der Flüchtlings-, Migrations- und Asylpolitik herzustellen? Wie kann der vielfach konstatierte ungeregelte Zustrom von Ausländern mit rechtsstaatlichen Mitteln begrenzt werden? Dass dies erforderlich sei, darüber gibt es einen breiten politischen und gesellschaftlichen Konsens. Falls es nicht gelänge, was wären die Konsequenzen? Manche, wie die früheren Richter des Bundesverfassungsgerichts Hans-Jürgen Papier und Udo Di Fabio sehen schon heute aufgrund der Flüchtlingskrise den Rechtsstaat in existenzieller Gefahr. In einem Interview mit dem „Handelsblatt“ von vorvergangener Woche monierte Papier, die „engen Leitplanken des deutschen und europäischen Asylrechts (seien) gesprengt worden“, es bestünden „rechtsfreie Räume bei der Sicherung der Außengrenzen“, der Staat habe als „Garant von Freiheit und Sicherheit gegenüber seinen Bürgern“ versagt, eine Bedrohung der staatlichen Integrität sei zu befürchten. Di Fabio erklärt in seinem im Auftrag des Freistaats Bayern erstellten Gutachten „Migrationskrise als föderales Verfassungsproblem“ vom 8. Januar 2016 (S. 52): „Kann ein Staat die massenhafte Einreise von Menschen in sein Territorium nicht mehr kontrollieren, ist (…) seine Staatlichkeit in Gefahr, schon weil das Staatsvolk und seine für es handelnden Organe (…) Gefahr laufen, ihre personelle und territoriale Schutzverantwortung zu überspannen und die Funktionsfähigkeit als sozialer Rechtsstaat zu verlieren.“ Die Menschenwürde, so Di Fabio, gebiete geradezu eine wirksame Grenzkontrolle, denn (S. 102, 103) „auch das Grundgesetz setzt die Beherrschbarkeit der Grenzen und die Kontrolle über die auf dem Staatsgebiet befindlichen Personen voraus. Das Grundgesetz garantiert jedem Menschen, der sich auf dem Gebiet der Bundesrepublik Deutschland befindet und ihrer Herrschaftsgewalt unterworfen ist, eine menschenwürdige Behandlung. (…) Auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland kann der Schutz der Würde des Menschen nur dann wirksam gewährleistet sein, wenn die Kontrolle über die Einreise in das Staatsgebiet nicht verloren geht.“
Soziale und rechtsstaatliche Verfasstheit als völkerrechtliche Voraussetzung von Staatlichkeit überhaupt?
Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen als ein Gebot des Schutzes der Menschenwürde?
Verlust der Kontrolle über die Staatsgrenzen durch einen humanitären und außenpolitischen Erwägungen folgenden Verzicht auf ihre Schließung?
Aufgabe der Kontrolle über das Staatsvolk aufgrund von Vollzugsdefiziten bei der Registrierung von Flüchtlingen, die gar nicht zum Staatsvolk gehören?
Das Schreckensszenario, das hier gemalt wird, und seine rechtswissenschaftliche Grundierung erscheinen reichlich grell und verzerrt. Dass die Flüchtlingskrise den Staat vor große Herausforderungen stellt und es in der Vergangenheit Versäumnisse zu beklagen gibt, wird von niemandem in Abrede gestellt. Von einer Erosion des Rechtsstaats und dem Verlust der staatlichen Integrität zu sprechen kann aber auch bei pessimistischer Betrachtung nur eine Übertreibung sein. Im Übrigen kann man auf Herausforderungen stets in zweierlei Richtungen reagieren: Man kann sich ihnen stellen und vermehrte Anstrengungen unternehmen, um sie zu meistern; oder sie ablehnen. Diejenigen, die sich eher von Ängsten leiten lassen und mit Verunsicherung in die Zukunft blicken, die keine Risiken eingehen wollen und denen es in erster Linie um das Wahren von Beständen geht, wird es immer geben. Sie sind – hoffentlich – für Deutschland in seiner Gesamtheit nicht charakteristisch. Die Flüchtlinge, die mit Mut und Verzweiflung das Risiko eines Neubeginns wagen, könnten uns darin als Vorbild dienen. In einem gewissen Sinne sollten wir ihnen dankbar sein: Sie schenken uns die Gelegenheit, unsere Humanität, unser Organisationsvermögen, unsere Rechtsstaatlichkeit und Verfassungswerte unter Beweis zu stellen, wir profitieren von ihnen, nicht nur langfristig in demografischer und ökonomischer Hinsicht, sondern ganz aktuell als starkes Land in Europa und in der Welt.
Was also ist zu tun? Besonnenheit. Differenzierungsvermögen. Diplomatie. Überfüllte Flüchtlingsunterkünfte, überforderte Registrierungszentren und kriminelle Übergriffe durch Ausländer sollten, so bedauerlich sie sind, nicht dazu führen, in Hysterie und Aktionismus zu verfallen. Wir sollten uns bewusst machen, dass diejenigen, die fordern, nicht „lange zu fackeln“ und straffällig gewordene Ausländer möglichst ohne strafrechtliches Verfahren abzuschieben, den Rechtsstaat nicht schützen, sondern preisgeben. Auch sollte man weniger leichtfertig von einer „Verwirkung“ des Aufenthalts- oder Asylrechts straffällig gewordener Ausländer sprechen. Die Verwirkung eines Grundrechts festzustellen obliegt unter sehr engen Voraussetzungen nach Art. 18 GG ausschließlich dem BVerfG, und das hat es bislang noch nie getan. Was wir tatsächlich benötigen, ist eine bessere Durchsetzung rechtsstaatlicher Standards bei der Bewältigung der Flüchtlingskrise. Die Stärkung personeller Ressourcen in der Justiz und Verwaltung ist dabei – das ist nicht neu und bedarf eines gewissen Vorlaufs – oberstes Gebot. Auf gesetzlicher Ebene brauchen wir differenzierte materielle und verfahrensrechtliche Regelungen für Flüchtlinge, Asylbewerber und andere Migranten und nicht eine Einheitslösung, wie sie in Grenzschließungen und Einreiseobergrenzen gesehen wird. Nur so kann ein uneingeschränkter Schutz von Asylsuchenden, eine nach humanitären Gesichtspunkten gebotene Unterstützung von anderen Flüchtlingen und eine bedarfsorientierte Einreise von Zuwanderungswilligen aus wirtschaftlichen Gründen gewährleistet und verarbeitet werden. Das gilt auch für die europäische Ebene, wo, sollte sich das endgültige Scheitern der dortigen Verteilungsmechanismen erweisen, neue Instrumente geschaffen werden müssen. Und nicht zuletzt – mit langfristiger Perspektive – ein ungebrochenes Engagement in den Herkunftsstaaten und -kontinenten der Flüchtlinge. Das alles ist sehr anspruchsvoll und viel leichter gesagt als getan. Aber Deutschland ist auf einem guten Weg.
Strafbarkeit des Sportwettbetrugs
Unsichtbar im Rahmen von Rennfahrrädern verbaute Elektromotoren, heimliches Verwenden von Computern beim Schach, mit Kontaktgebern präparierte Degen und Fechtwesten, erhitzte Rennrodelkufen, manipulierte Boxhandschuhe, unerlaubte Gewichte im Motorsport, unzulässige Rennanzüge - die Möglichkeiten, sich auf unlautere Weise Vorteile im sportlichen Wettbewerb zu verschaffen, sind vielfältig. Auch die Manipulation von Wetten betrifft längst nicht mehr nur Sportarten mit großer Breitenwirkung wie Fußball, sondern ebenso Tennis, Handball, Basketball, Volleyball, Wrestling, Boxen, Cricket, Badminton, sogar Snooker-Billard und Dartsport. Mit derlei Untaten soll demnächst in Deutschland Schluss sein: Das Bundesministerium der Justiz hat einen Gesetzentwurf zur Strafbarkeit von Wettbetrug und Manipulationen in berufssportlichen Wettbewerben vorgelegt.
„Doping und Spielmanipulationen zerstören die ethischmoralischen Werte des Sports, gefährden die Gesundheit der Sportlerinnen und Sportler, täuschen und schädigen die Konkurrenten im Wettkampf sowie die Veranstalter. Deshalb werden wir weitergehende strafrechtliche Regelungen beim Kampf gegen Doping und Spielmanipulation schaffen. Dazu kommen auch Vorschriften zur uneingeschränkten Besitzstrafbarkeit von Dopingmitteln zum Zweck des Dopings im Sport sowie zum Schutz der Integrität des sportlichen Wettbewerbs in Betracht. Dabei müssen die Grundsätze der Bestimmtheit von Straftatbeständen und die Verhältnismäßigkeit einer strafrechtlichen Sanktion gewährleistet sein. Eine gesetzliche Regelung darf weder die verfassungsrechtlich garantierte Autonomie des Sports unzulässig einschränken, noch die Funktionsfähigkeit der Sportgerichtsbarkeit beeinträchtigen.“
Koalitionsvertrag, 18. Legislaturperiode, S. 96.
Unrechtsvereinbarung beim Sportwettbetrug
Der Straftatbestand des § 265c StGB-E orientiert sich ausdrücklich an dem des § 299 StGB, wodurch besonders der Bedeutung des organisierten Sports als Wirtschaftsfaktor Rechnung getragen werden soll. Die Unrechtsvereinbarung als Kernelement des Straftatbestands ist bei § 299 StGB vergleichsweise einfach strukturiert: Leistung ist dort ein wie auch immer gearteter, über sozialadäquate Zuwendungen hinausgehender Vorteil für den Vorteilsempfänger, Gegenleistung die unlautere Bevorzugung eines anderen im wirtschaftlichen Wettbewerb. Demgegenüber ist die Unrechtsvereinbarung bei § 265c StGB-E ungleich komplexer, denn sie erfordert über die Bevorzugung des Wettbewerbsgegners hinaus im Sinne einer subjektiven Bedingung der Strafbarkeit ein Bewusstsein des Normadressaten, dass
1. ein Vermögensvorteil durch eine auf den betreffenden Wettbewerb bezogene Sportwette erlangt werde,
2. dieser Vorteil rechtswidrig sei und
3. zwischen der Beeinflussung des Wettbewerbs und dem Erlangen des
Vermögensvorteils eine kausale Beziehung bestehe („infolgedessen“).
§ 265c Abs. 1 StGB-E setze, wie der Gesetzentwurf zutreffend ausführt, voraus, „dass die Erlangung eines rechtswidrigen Vermögensvorteils durch eine auf den manipulierten Wettbewerb bezogene Sportwette Teil der Unrechtsvereinbarung ist.“ Der Normadressat müsse „zumindest damit rechnen und es billigend in Kauf nehmen, dass seine Manipulationshandlung für eine betrügerische Wettsetzung genutzt werden soll“ (S. 14). Indem der Gesetzentwurf auf diese Weise Elemente des Betrugs in den Bestechungstatbestand integriert, wird der Tatnachweis entsprechend erschwert. Worin die angestrebte Vereinfachung gegenüber dem Nachweis einer nach geltendem Recht bereits strafbaren Beihilfe zum (Wett-)Betrug liegen soll (S. 8 o.), ist nicht erkennbar. Die Strafnorm eröffnet vielmehr Raum für eine Vielzahl denkbarer Schutzbehauptungen, die in der Praxis der Rechtsanwendung kaum widerlegt werden können. Durch die beabsichtigte (S. 9) Vorverlagerung der Strafbarkeit auf Handlungen im Vorfeld des Betrugs folgt der Gesetzentwurf einer für die Rechtsanwendungspraxis problematischen jüngeren Tendenz in der Strafgesetzgebung zur „Subjektivierung“ von Straftatbeständen. Gute Strafgesetzgebung bestimmt einen Unrechtsgehalt verkörpernde Handlungsweisen, aus deren objektivem Nachweis zumindest teilweise auf die subjektive Tatseite geschlossen werden kann. Stark subjektiv überschießende Tatbestände wie hier stellen die Strafverfolgungspraxis erfahrungsgemäß vor enorme und verfahrensaufwändige Nachweisschwierigkeiten.
Verhältnismäßigkeit der Strafbarkeit von Manipulationen
Bei § 265d StGB-E ist die Unrechtsvereinbarung – entsprechend der bei § 299 StGB – einfacher konstruiert. Erforderlich ist als Gegenleistung lediglich eine wettkampfwidrige Beeinflussung des Wettbewerbs zugunsten des Gegners. Als Maßstab für die Wettkampfwidrigkeit kann dabei auf die einschlägigen Regelwerke des Sports zurückgegriffen werden. Nachweisprobleme entstehen hier nicht in derselben Weise wie bei § 265c StGB-E. Die größere Weite des § 265d StGB-E führt allerdings dazu, dass dieser Tatbestand unter Verhältnismäßigkeitsgesichtspunkten kritisch zu betrachten ist. Strafnormen dienen nach verfassungsrechtlichen Maßstäben dem Schutz elementarer Werte des Gemeinschaftslebens, der Sicherung der Grundlagen einer geordneten Gesellschaft und der Bewahrung wichtiger Gemeinschaftsbelange. Der Gesetzgeber ist deshalb bei der Wahl des Strafrechts als Steuerungsinstrument nicht vollkommen frei, sondern darf es nur einsetzen, „wenn das inkriminierte Verhalten über sein Verbotensein hinaus in besonderer Weise sozialschädlich und für das Zusammenleben der Menschen unerträglich, wenn seine Verhinderung besonders dringlich ist“ (BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 26.2.2008, 2 BvR 392/07, Z. 77 m. w. N.). Hier dient das Strafrecht letzten Endes der Durchsetzung eines nichtstaatlich gesetzten Regelungsregimes, nämlich der Spiel- und Wettkampfregeln des Sports. Sogar im Bereich des Sportrechts werden diese überwiegend – anders als z. B. das Dopingverbot – als nicht justiziabel angesehen. Das „Verbotensein“ bestimmter Verhaltensweisen als Anknüpfungspunkt für die Pönalisierung der Normverletzung entspringt hier mithin nicht einer hoheitlichen, sondern einer privaten Entscheidung. Vor diesem Hintergrund ergeben sich zwei Probleme:
1. Das Tatbestandsmerkmal der Wettkampfwidrigkeit der Beeinflussung des Wettbewerbs müsste nach dem verfassungsrechtlichen Wesentlichkeitsgrundsatz (vgl. BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 6.7.1999, 2 BvF 3/90, Z. 125 m. w. N.) durch den Gesetzgeber selbst definiert werden, da es entscheidend die Strafwürdigkeit des pönalisierten Verhaltens determiniert. Andernfalls könnten vom Gesetzgeber nicht verantwortete Änderungen in den Spiel- und Wettkampfregeln des Sports auch nachträglich noch den Bereich strafbaren Verhaltens verändern. Mit anderen Worten müssten die privat gesetzten Spiel- und Wettkampfregeln des Sports zunächst in öffentliches Recht transformiert werden. Dasselbe gilt für das Merkmal der