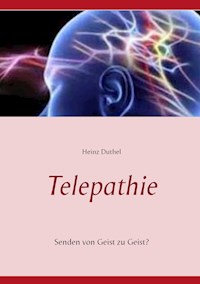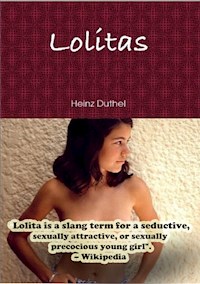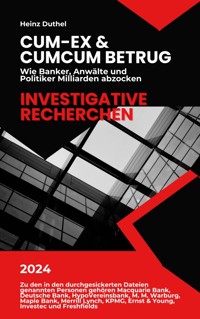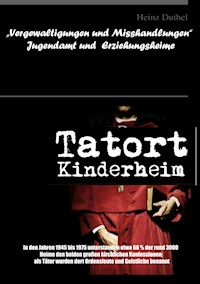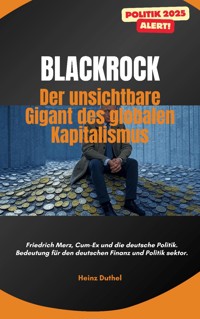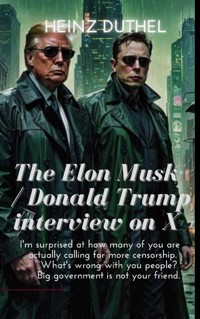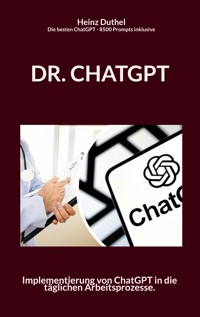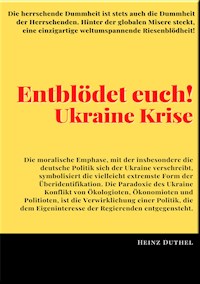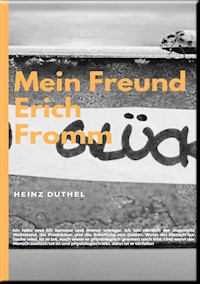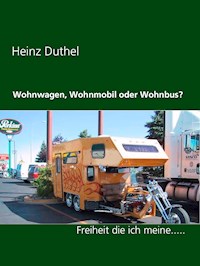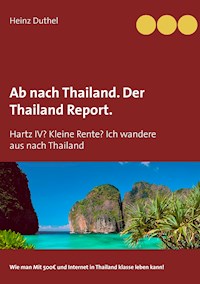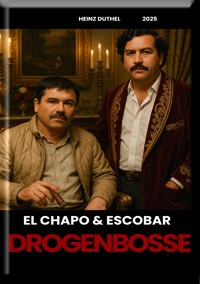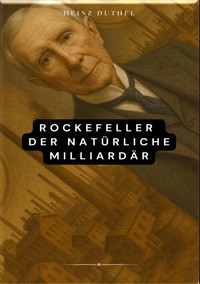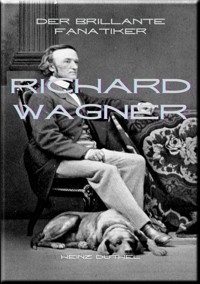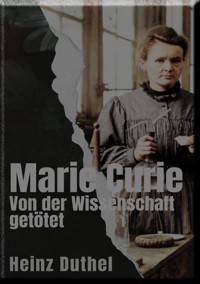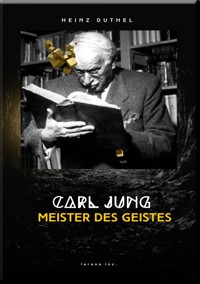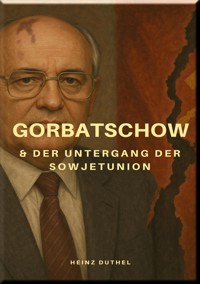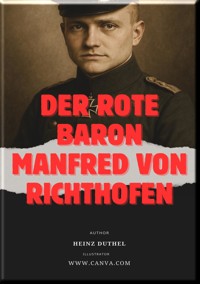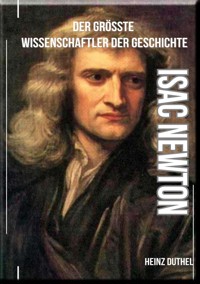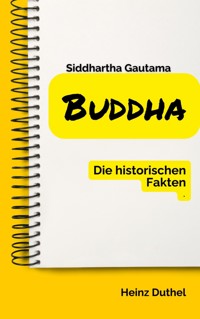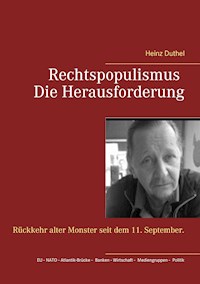
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die herrschende Politik, der gestiegene Wettbewerbsdruck und eine strukturell verfestigte Massenarbeitslosigkeit setzen seit Jahren eine soziale Unterbietungskonkurrenz in Gang, in der Arbeitnehmer- und Gewerkschaftsrechte grundlegend in Frage gestellt sind. Unter den Slogans "Hauptsache Arbeit" oder "Sozial ist, was Arbeit schafft" sollen die verteilungspolitischen und arbeitsinhaltlichen Ansprüche zum nicht mehr vertretbaren Luxus erklärt werden. Auf diese Weise geraten sämtliche Standards guter Arbeit unter Druck. (Siehe Opel, VW, Deutsche Bank usw.) Arbeitszeiten werden ausgeweitet, Leistungsbedingungen verschärft und vielerorts ist ein Rollback bisheriger humanisierungspolitischer Errungenschaften zu beobachten. "Die USA sind ein radikales Regime"; Fakten einer tugendhaften Nation. Eine lange Geschichte der 'ethnischen Säuberungen', Sklaverei, Rassismus und Segregation sind nicht Geschichte. Durch die Atlantik Brücke in Deutschland, der NATO in Europa ist die US Politik hier zuhause. Politiker in der EU und Nationale Regierungen sind nicht mehr als tanzende US Spielpuppen und die Quelle aller Rechtspopulistischen Bewegungen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 494
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Ich vertrete die These, dass der 11. September den Übergang in eine neue Etappe im Rahmen jenes größeren epochalen Umbruchs markiert, der in den Letzen beide Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts eingesetzt hat. Eric Hobsbawm (1998: 503ff.) bezeichnete diese Entwicklungen als "Erdrutsch". Sie umschließen den Übergang zu einer neuen Formation des globalen High-Tech-Kapitalismus sowie eine grundlegende Veränderung der weltpolitischen Machtverhältnisse
Der Mensch ist das religiöse Tier. Er ist das einzige Tier, das seinen Nächsten wie sich selber liebt und, wenn dessen Theologie nicht stimmt, ihm die Kehle abschneidet.
Heinz Duthel
This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, resold, hired out or otherwise circulated without the publisher’s prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser.
Dieses Buch widme ich meinen Kindern, welche nie ein friedvolles Deutschland wie ich von 1950 bis 1998 erleben werden.
Die großen Fortschrittsleistungen des 20. Jahrhunderts sind bedroht: die Demokratie und der Sozialstaat. Die seit fast drei Jahrzehnten andauernde Massenarbeitslosigkeit hat die Fundamente sozialer Sicherheit unterspült. Zukunftsängste breiten sich aus. Unter der Herrschaft des Neoliberalismus wurde die Gesellschaft einem engstirnigen betriebswirtschaftlichen Effizienzdenken und damit den Verwertungsinteressen des Kapitals unterworfen. Sozialdemokratische Mehrheiten in Europa waren nicht mehr als eine kurze Episode. Die Politik des "Dritten Weges" und der "neuen Mitte" scheiterte, weil sie ökonomische Entwicklungen und Interessen zu unabänderlichen Sachzwängen erklärte und damit vor der Aufgabe des Abbaus der Massenarbeitslosigkeit kapitulierte. Die politische Rechte hat Europa zurückerobert - in zahlreichen Ländern im Bündnis mit rechtspopulistischen / rechtsextremen Parteien.
Konservative und reaktionäre Kräfte haben ihren Einfluss auf Politik, Medien und Wissenschaft in einem Ausmaß verstärkt, das die soziale und kulturelle Freiheit einengt. Enorme Finanzmittel werden in die ideologischen Denkfabriken des Neoliberalismus investiert. Wissenschaft wird durch privatkapitalistische Finanzierung geködert und korrumpiert. In den staatlichen Institutionen und internationalen Organisationen herrscht ein reaktionäres Einheitsdenken, das den Umbau der gesellschaftlichen und internationalen Ordnung im Interesse der Machteliten vorantreibt und legitimiert.
Kapitalismuskritische Analysen von Wirtschaft und Gesellschaft werden ausgegrenzt. Sie drohen aus den gesellschaftlichen Institutionen und der Öffentlichkeit zu verschwinden. Denn gegenwärtig scheidet eine ganze Generation als Träger kritischer Theorie (verkürzt: 68er) aus dem Berufsleben aus. Die Stellen z.B. an den Hochschulen werden entweder gestrichen oder gemäß dem herrschenden "Zeitgeist" neu besetzt. Gerade in einer Zeit, in der sich der Protest gegen die negativen Folgen kapitalistischer Globalisierung neu formiert, soll der "Siegeszug des Marktes" vollendet werden.
Ignacio Ramonet hat in Le Monde Diplomatique (Dezember 2001: 1) die Auffassung vertreten, dass mit dem 11. September und der Kriegserklärung des US-amerikanischen Präsidenten George W. Bush an den "Terrorismus" in der ganzen Welt "ein neuer historischer Abschnitt begonnen hat. Er schließt zugleich eine Entwicklung ab, die mit dem Fall der Berliner Mauer angestoßen wurde".
Das Verbrechen vom 11. September hat gewiss eigene Dimensionen. Dennoch muss – wie Peter Gowan (2002) betont hat – unterschieden werden zwischen der völlig legitimen Forderung nach der Ergreifung und Bestrafung der Täter, nach präventiven Maßnahmen, die solche Megaverbrechen ausschließen, und der Reaktion der US-amerikanischen Regierung. Diese hat dem "Bösen" den Krieg erklärt – einen Krieg, der in der ganzen Welt stattfinden kann und der kein Ende hat. Er begann in Afghanistan mit Flächenbombardements – wie im Golfkrieg und im Kosovo-Krieg – mit Tausenden unschuldiger Opfer, ohne dass das zunächst proklamierte Ziel (Ben Laden fangen; Al Qaida zerschlagen) erreicht worden wäre.
Mit dieser Kriegserklärung sind zugleich weiterreichende geostrategische und geopolitische Interessen (in der Region wie in der ganzen Welt) in den Vordergrund getreten. Sie schließt nicht nur ein extrem reduktionistisches Freund-Feind-Denken (das schon deshalb wenig glaubwürdig ist, weil die Feinde der USA meist bis vor kurzem ihre Freunde waren), sondern auch die Drohung an alle ein, die sich nicht den USA unterwerfen wollen: "Wer nicht für uns ist, ist gegen uns, sagte der Kalte Krieger John Forster Dulles. Nicht anders sagt es heute Bush junior" (so Theo Sommer in der "Zeit"). Daraus ergibt sich schon eine erste Schlussfolgerung: Wir müssen den Mut haben, Diskurse "zwischen den Fronten" und gegen das Denken nach Maßgabe der Freund-Feind-Polarität fortzuführen. Das heißt auch, den Primat der Sicherheitspolitik – Krieg nach außen und innen – zu kritisieren; denn dieser Primat verbaut – global wie national – jene vertrauensbildenden Maßnahmen, die notwendig wären, um dem Terrorismus den Boden zu entziehen, und er beschleunigt den Prozess der Erosion der Demokratie im eigenen Lande. Ein Innenminister Schily, der sich als Law-and-Order-Mann der SPD profilieren möchte, und der gleichzeitig mit dem italienischen Innenminister und seinen Carabinieri solidarisch ist, die in Genua mit faschistischen Methoden auf Demonstranten geschlagen und geschossen haben, personifiziert diese Krise der Demokratie und des Rechtsstaates im eigenen Lande.
II.
In seiner Rede an die Nation vom Januar 2002 hat George W. Bush keinen Zweifel daran gelassen, dass die Ziele und Motive der USA-Regierung weit über das Interesse an der Ergreifung und Bestrafung der Schuldigen des New Yorker Attentats hinausgehen. Sinngemäß sagte er: Wir führen Krieg, wir befinden uns mitten in einer Rezession und noch nie war die Nation so einig. Vor gut einem Jahr durch Wahlfälschung ins Amt gekommen, ist er nun so populär wie kein anderer seiner Vorgänger. Und gleichzeitig kündigte er im innenpolitischen Teil seiner Rede "den größten Anstieg der Rüstungsausgaben seit zwei Jahrzehnten an: ›Was immer es kostet, unser Land zu verteidigen, werden wir zahlen‹" (FR vom 31.1.2002).
Worin besteht die epochale (und natürlich auch symbolische) Bedeutung des 11. September? Ich vertrete die These, dass der 11. September den Übergang in eine neue Etappe (so auch Conert 2002) im Rahmen jenes größeren epochalen Umbruchs markiert, der in den letzen beiden Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts eingesetzt hat. Eric Hobsbawm (1998: 503ff.) bezeichnete diese Entwicklungen als "Erdrutsch". Sie umschließen den Übergang zu einer neuen Formation des globalen High-Tech-Kapitalismus sowie eine grundlegende Veränderung der weltpolitischen Machtverhältnisse. Eine erste Zäsur war mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion (1991), der Auflösung des "sozialistischen Lagers und der deutschen Wiedervereinigung erfolgt. Im gleichen Jahr begann der Golfkrieg, der von Bush sen. als Eintritt in die "Neue Weltordnung" bezeichnet wurde. Auf dem Balkan wurde zur gleichen Zeit (mit maßgeblicher Beteiligung der deutschen Regierung) die Zerschlagung von Jugoslawien ins Werk gesetzt, die die drei nachfolgenden Kriege auslöste.
Eine erste Antwort auf die Frage nach der Bedeutung des 11. September 2001 könnte also lauten: Diejenigen Konflikte und Widersprüche, die sowohl aus dem Ende der Systemkonkurrenz und des Ost-West-Gegensatzes als auch als dem universalen Herrschaftsprojekt des – von den USA dominierten – "globalen High-Tech-Kapitalismus" resultieren, nehmen immer mehr die Form gewaltsamer Eruptionen und neuer Formen der Kriegsführung und Gewalt an.[1] Die neuen Kriege sind durch Terror und Gegenterror, durch Entstaatlichung und Entgrenzung,[2] aber auch durch eine neue Logik der technologischen "Unantastbarkeit", die von den USA in Anspruch genommen wird, charakterisiert.
Das Charakteristikum der neuen Epoche – als endloser, universeller und permanenter Krieg gegen das Böse mit der Definitionsmacht des US-amerikanischen Präsidenten – wäre also darin zu sehen, dass das neoliberale Herrschaftsprojekt nunmehr – als "disziplinierender Neoliberalismus" (Stephen Gill 2000) – mit militärischer Gewalt geostrategisch neu abgesichert wird. Die Hegemonie wird – um einen Ausdruck Gramscis zu verwenden – mit Zwang gepanzert, wobei natürlich darüber zu diskutieren wäre, ob beim Einsatz militärischer Mittel noch von Hegemonie – im Sinne des Konsens zwischen Herrschenden und Beherrschten – gesprochen werden kann.
III.
Natürlich ist die Struktur dieser Konflikte (und ihre Entstehung ) äußerst komplex. Ich würde drei "Typen" solcher Konflikte unterscheiden, die auch auf die internationale Politik einwirken (nicht nur im Sinne von Gewaltexplosionen, sondern auch im Sinne der Strategieformulierung der relevanten Akteure):
Die Widersprüche und konfliktorischen Entwicklungen, die aus dem Zusammenbruch der Sowjetunion und von Jugoslawien, als sozialistischen Vielvölkerstaaten, aber auch aus den politischen und sozialökonomischen Krisenprozessen in den so genannten Transformationsgesellschaften Ost- und Südosteuropas hervorgehen.
Krisen- und Konfliktpotenziale vor allem auch in Ländern an der Peripherie oder Semiperipherie, die durch die Strukturen des Ost-West-Gegensatzes weitgehend unter Kontrolle gehalten wurden bzw. als ethnische oder religiöse Konflikte nicht dominant werden konnten. Der Ausbruch solcher Konflikte hat in der Regel den Zusammenbruch staatlicher Ordnungen zur Voraussetzung (vor allem in Afrika).
Das Herrschaftsprojekt des globalen High-Tech-Kapitalismus (verkürzt: "Neoliberalismus" genannt) reproduziert Widersprüche und (zwischenimperialistische) Machtkonflikte, die gewaltsam an die Oberfläche drängen. Die wichtigsten dieser Widersprüche sind mit der zunehmenden sozialen Polarisierung zwischen arm und reich, mit der Krise der alten nationalstaatlichen Regulierungsformen, der Zerstörung von sozialstaatlichen Institutionen, der Schwächung von (fordistischen) Solidargemeinschaften (wie z.B. der Gewerkschaften) u.a.m. verbunden. Dazu kommen zunehmende Konfliktpotenziale, die aus dem Kampf um die globale ökonomische und politische Machtverteilung zwischen den imperialistischen Zentren in Nordamerika, Europa und Ostasien resultieren. Ganz offensichtlich handelt es sich hierbei um die dominante Konfliktformation; denn sie ist maßgebend für die Strategieformulierung (und letztlich auch die Kriegserklärung) derjenigen Gruppen der globalen herrschenden Klassenfraktionen und Eliten sowie der Staatsapparate der entwickelten kapitalistischen Länder, die den Einsatz militärischer Gewalt als das adäquate Mittel des Kampfes gegen Terrorismus bestimmen und zugleich (in der Kooperation mit der Rüstungsindustrie) den Primat der inneren und äußeren Sicherheit über alle anderen Politikfelder durchzusetzen vermögen.
Dass diese Konfliktformationen (die vielfältige Verbindungen miteinander eingehen) in die Richtung einer zunehmenden Barbarisierung der Weltpolitik wirken, ist auch Ergebnis der Tatsache, dass seit Mitte der 1970er Jahre und mit der Herausbildung einer neuen Formation des Kapitalismus die traditionelle – aus der Arbeiterbewegung hervorgegangene – Linke (Sozialdemokratie, Kommunisten; Gewerkschaften), aber auch die antiimperialistischen Befreiungsbewegungen in der so genannten Dritten Welt tiefgreifende Niederlagen haben hinnehmen müssen. Deshalb sind sie als Widerstandspotenzial bzw. als Potenziale der "Zähmung" bzw. der "Zivilisierung" des Kapitalismus weitgehend ausgeschaltet.[3] Zu diesen Schwächen der Linken im Gefolge ihrer historischen Niederlagen über zwei Jahrzehnte gehört übrigens auch, dass die der heutigen Welt angemessene Bestimmung des Verhältnisses von lokaler, nationaler und transnationaler Politik eben auch für die Linke (theoretisch und praktisch) nach wie vor höchst unterentwickelt ist.
IV.
Durch die universelle Kriegserklärung des US-amerikanischen Staates – so die weitere These – wird eine Entwicklung zugespitzt, in der mit der Anwendung militärischer Gewalt die Möglichkeit zerstört bzw. immer mehr blockiert wird, jene Widersprüche zu überwinden, die den Prozess der Globalisierung (als einen Prozess der kapitalistischen Durchdringung der Welt) als einen fortschreitenden Prozess der Zerstörung von Weltzivilisation, der Erzeugung von Gewaltverhältnissen und der zunehmenden Entmachtung der Politik[4] – im Hinblick auf die Bearbeitung und Überwindung dieser Widersprüche und Gewaltverhältnisse – auszeichnen.
Samir Amin (1997: 137), unermüdlicher Kämpfer für eine humane Weltordnung und für die Interessen der Völker der "Dritten Welt", schrieb über diese Veränderungen im Zeichen der weltweiten Hegemonie des Neoliberalismus: "Mit der allmählichen Erosion der Kompromisse, die der kapitalistischen Expansion der Nachkriegszeit zugrunde lagen, begann eine neue Phase, in der das Kapital nun ungehindert versucht, die Utopie einer Verwaltung der Welt gemäß der einseitigen Logik seiner Finanzinteressen durchzusetzen. Nach dieser ersten Schlussfolgerung waren die beiden neuen Ziele der Strategie der dominanten Mächte zu identifizieren: Vertiefung der ökonomischen Globalisierung und Zerstörung der politischen Widerstandsfähigkeit der Staaten, Nationen und Völker. ›Die Welt wie einen Markt verwalten‹, verlangt die maximale Zersplitterung der politischen Kräfte, d.h. praktisch die Zerstörung der Staatsgewalten (legitimiert mit der Ideologie genereller Entstaatlichung), das Aufspalten der Nationen in infranationale Gemeinschaften (ethnischer, religiöser u.a. Art), ihre Schwächung zugunsten supranationaler ideologischer Bindungen (religiöse Integrismen usw.)."
V.
Nach dem 11. September werden Konturen einer Weltordnung nach dem Ende des Systemgegensatzes deutlich, die natürlich ihre Vorgeschichte haben. Nach wie vor und auch für die absehbare Zukunft gilt, dass wir uns in einer (chaotischen) Übergangsepoche befinden, in der die Strukturen und Machtverhältnissen der internationalen Ordnung und der Weltpolitik umkämpft sind. Der Prozess der Neubildung von stabilen Ordnungs- und Herrschaftsstrukturen (das gilt übrigens auch für die Innenpolitik bzw. für die sozialökonomische Entwicklung) ist noch längst nicht abgeschlossen. Die Reaktionen der US-Regierung auf den 11. September (und die Entscheidungen danach, bis hin zur Vorbereitung des Angriffs auf den Irak) signalisieren jedoch, dass die US-Regierung dabei ist, in der neuen Weltordnung eine alleinige Führungsrolle zu beanspruchen. Diese drückt sich u.a. darin aus, dass die USA ihr "Selbstverteidigungsrecht" dahingehend auslegen, dass sie "die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit eines Krieges weitgehend von der UN in New York nach Washington verlegen werden" (Nassauer 2002).
Welches sind zunächst einmal die wichtigsten Veränderungen innerhalb des Weltsystems, die sich im letzten Viertel des 20. Jahrhunderts vollzogen haben und die gegenwärtige Konstellation bestimmen?
Das Ende des Systemgegensatzes, der dominanten Konfliktkonstellation der Weltpolitik zwischen dem Ende des Zweiten Weltkrieges und dem Zusammenbruch der Sowjetunion in den Jahren 1990/91.
Die Schwächung von sozialen Kräften und Staaten, die sich außerhalb des "sozialistischen Lagers" als antiimperialistisch bzw. als kapitalismuskritisch verstanden haben, die das Kapital vor allem in Europa nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges – aufgrund der starken reformistischen Arbeiterbewegung und der eigenen Dynamik der sozialen Kämpfe seit den späten 1960er Jahren – zu einer Politik des "Klassenkompromisses" gezwungen hatten. Die Kapitalhegemonie wirkt über Politik und Ideologie des Neoliberalismus und sie vermittelt sich hauptsächlich über die "Standortlogik" bzw. die weitere "Vermarktlichung" aller sozialen Beziehungen unter der Vorherrschaft des internationalen Finanzkapitals und des Geschehens auf den internationalen Finanzmärkten. Pierre Bourdieu hat in diesem Zusammenhang von der "pensée unique" und vom notwendigen Kampf der Arbeiter, der Gewerkschaften und der Intellektuellen gegen die ungeteilte Herrschaft des Marktes und des Geldes gesprochen!
Die Rolle des Nationalstaates hat sich im Zuge der "Globalisierung" und der Veränderung der gesellschaftlichen und ideologischen Kräfteverhältnisse verändert. Ich halte die These vom "Niedergang der Souveränität der Nationalstaaten"[
6
] – wie sie jetzt auch von Negri und Hardt (2002: 10) vertreten wird – für falsch. Richtig daran ist, dass sich die Bedeutung des Nationalstaates als Adressat für politische und wirtschaftspolitische Alternativen jenseits des Neoliberalismus deutlich abgeschwächt hat – und daraus müsste die Linke auch Schlussfolgerungen ziehen. Wichtig ist aber gleichzeitig, dass sich die Rolle des Nationalstaates transformiert hat. Seine Funktion für die Organisierung von Klassenbeziehungen und - kompromissen (die dann auch die Demokratisierung der Systeme der Staatsapparate mit einschließen würde) ist deutlich reduziert zugunsten der nicht minder wichtigen Funktion der Anpassung der nationalen Gesellschaften und der nationalen Politik an die Anforderungen des globalen Wettbewerbs (Hirsch 2002; Hirsch/Jessop/Poulantzas 2001). Gleichzeitig vollzieht sich – im Kampf gegen den inneren und äußeren Feind – ein Ausbau der klassisch repressiven Staatsapparate, um einerseits das Projekt der imperialen Weltherrschaft gegen seine Widersprüche und gegen Widerstand in der ganzen Welt abzusichern, und andererseits nach innen jene Widerspruchspotenziale unter Kontrolle zu halten, die einerseits die zunehmende soziale Polarisierung, d.h. zunehmende "soziale Ungerechtigkeit", andererseits den Widerstand gegen Demokratieabbau artikulieren.
Die USA haben ihre Stellung als unumschränkt herrschende Weltmacht Nr. 1 in den 1990er Jahren noch weiter ausgebaut. Vorstellungen von einem "American Decline", wie sie in den späten 1980er Jahren im Anschluss an das Buch von Paul Kennedy ("Aufstieg und Niedergang der großen Mächte") – auch von mir in meinem Buch "Jenseits der Systemkonkurrenz. Überlegungen zur neuen Weltordnung" (1991) vertreten wurden, haben sich (als Kurzfristprognose[
7
]) als falsch herausgestellt. Vor allem der ökonomische Boom der zweiten Hälfte der 1990er Jahre hat die Position der USA noch einmal deutlich gestärkt: über a) ihre militärisch-technologische Vormacht, und b) über das "Dollar-Wall-Street"-Regime und den so genannten Washington Konsensus vom Ende der 1980er Jahre (Gowan 1998).[
8
] Die Vorherrschaft der USA hat schon seit der Reagan-Administration zu einer systematischen Demontage der UNO und damit des Systems des Multilateralismus geführt (Cox 1998: 87ff.). Im Gefolge des Krieges gegen Afghanistan (und andere Mächte auf der "Achse des Bösen") ist die NATO von der US-Regierung nach der Ausrufung des Bündnisfalles "völlig aus dem Spiel gedrängt worden ... Die Supermacht drängt auf ihre Handlungsfreiheit", so erneut Theo Sommer in der "Zeit" vom 28. Februar 2002!
In der Folge dieser Strukturveränderungen der Weltpolitik im Rahmen der neuen Weltordnung haben – um eine klassische Formulierung zu verwenden – die "zwischenimperialistischen Konflikte" für die internationale Politik erheblich an Bedeutung gewonnen. Die Linke ist dabei mit einer verwirrenden Komplexität von gemeinsamen und konkurrierenden Interessen, von Prozessen an der Oberfläche und tieferliegenden Machtverschiebungen konfrontiert. Dazu kommt, dass die weltpolitische Realität (vor allem auch in den Zeiten des Krieges) von immer weniger privaten Medienkonzernen (CNN, AOL u.a.) reproduziert und interpretiert, d.h. "konstruiert" wird und dabei ganz neue Fragen der Ideologiekritik als Teil des Kampfes um den "senso commune" (wie Gramsci das nannte) aufgeworfen werden. Dennoch sind auch die divergierenden Interessen der Regierungen – z.B. die von Russland, China und Indien im Bündnis gegen den Terrorismus, oder die unterschiedlichen Interessen der EU-Europäer oder auch einzelner Mitgliedstaaten der EU – leicht zu erkennen.[
10
] Sie unterstützen die USA, wollen dabei aber gleichzeitig eigene Interessen (sowohl Machtinteressen als auch ökonomische Interessen, z.B. hinsichtlich der Ölversorgung) optimieren, die langfristig die unumschränkte Vormacht der USA schwächen sollen.
Diese widersprüchliche Einheit von gemeinsamen und partikularen Interessen war schon während des Kosovo-Krieges bestimmend, in dem die Europäer schließlich der NATO – und d.h. den USA – zugestanden haben, die führende Rolle bei der Neuordnung der Machtverhältnisse auf dem Balkan, allgemeiner in Osteuropa, zu übernehmen.
VI.
Welche Ziele verfolgen die USA – und natürlich auch ihre Verbündeten – mit der universellen Kriegserklärung gegen den Terror, die mit dem Hinweis auf die "nationalen Interessen" begründet wird?
Sie wollen jedem Gegner die "Glaubwürdigkeit" ihrer Drohungen, damit zugleich ihre militärische Überlegenheit bzw. "Unbesiegbarkeit" demonstrieren.
Für ihre unipolare, globale Führungsposition zu kämpfen, bedeutet für die USA u.a., die Europäer in Schach und den Aufstieg Chinas zur Weltmacht in Ostasien bzw. im pazifischen Raum unter Kontrolle zu halten.
Die Sicherheitsinteressen der kapitalistischen Metropolen und der transnationalen Konzerne sind natürlich nicht allein militärischer und politischer Natur. Sie beinhalten auch die Frage nach einer funktionierenden (natürlich durch die Kapitalverwertungsinteressen definierten) Infrastruktur der Weltwirtschaft – also vor allem reibungslos funktionierende Verkehrs- und Kommunikationswege sowie eine optimale Rohstoffversorgung, wobei hier wiederum das Öl und das Erdgas eine entscheidende Rolle spielen. Geopolitik und Geostrategie bedeuten daher auch eine machtpolitische Neuordnung von Räumen in Mittelasien, wo nach dem Ende der Sowjetunion neue Zugänge (Kaspisches Meer), aber auch Machtvakua entstanden sind. Die Kontrolle und Beherrschung dieser Räume ist zum zentralen Ziel der internationalen Politik, genauer der Außenpolitik der USA geworden (vgl. u.a. Brzezinski 1997).
Die USA wie die kapitalistische Weltwirtschaft insgesamt befinden sich seit 2001 in einer – ziemlich tiefen – Rezession (Brenner 2002). Obwohl im Jahre 2002 das Wachstum sich zu erholen scheint, herrscht angesichts von Unternehmenszusammenbrüchen, kriminellen Machenschaften von Spitzenmanagern (Enron u.a., vgl. Schuhler 2002) sowie angesichts der Einbrüche an den Börsen nach wie vor ein Klima der Unsicherheit vor. Die besondere Bedeutung dieser Rezession besteht zunächst einmal darin, dass der Akkumulationszyklus aus der zweiten Hälfte der 1990er Jahre (mit extrem hohen Wachstumsraten) zum Stillstand gekommen ist, dass zahlreiche spekulative Blasen geplatzt sind und mit ihnen auch Illusionen und falsche Versprechen über das "Zeitalter" der New Economy und des Shareholder-Kapitalismus. Zusammen mit der stagnativen Entwicklung in Japan (seit Anfang der 1990er Jahre) und der Rezession in Europa im gleichen Zeitraum verweist die USA-Krise darauf, dass die kapitalistische Weltwirtschaft ihre stagnative Grundtendenz immer noch nicht überwunden hat, während sich gleichzeitig an der Peripherie geradezu dramatische ökonomische und monetäre Krisenprozesse vollziehen. Dabei zeigt sich immer wieder, dass das grundlegende Problem der kapitalistischen Weltwirtschaft, nämlich die strukturelle Überakkumulation, nicht gelöst ist. Die Strategie der Globalisierung hat keinen neuen – sich selbst tragenden – Wachstumszyklus erzeugt. Sie erzeugt im Zentrum und an der Peripherie immer heftigere Krisen: die Finanzkrisen in Asien und die der Türkei sowie der Staatsbankrott in Argentinien (mit seinen Wirkungen auf Uruguay und Brasilien) als Folge der neoliberalen Politik sind nur die bekanntesten Beispiele aus der jüngsten Zeit.
Es wäre zumal für die wissenschaftliche Analyse der gegenwärtigen Epoche des Umbruchs und des Übergangs außerordentlich wichtig, Zusammenhänge zwischen ökonomischen Stagnations- und Krisenprozessen auf der einen und der zunehmenden Gewalt und Aggressivität in der Weltpolitik (sowohl in der Erschließung neuer Räume, in der Konkurrenz mit den anderen imperialistischen Mächten, als auch in der Durchsetzung eigener nationaler Sicherheitsinteressen) genauer zu untersuchen. Der Ökonom Karl Georg Zinn (1997: 145 ff.),[11] der sich in zahlreichen Publikationen mit den Strukturkrisen im Übergang von der Industriezur Dienstleistungsökonomie beschäftigt hat, hat schon vor dem 11. September 2001 die These zur Diskussion gestellt, dass 1. der Kapitalismus in seiner bisherigen Geschichte stets solche Formationskrisen durch Aufrüstung und Krieg gelöst habe (er bezieht sich dabei zunächst einmal auf den Zusammenhang von Weltwirtschaftskrise nach 1929, Massenarbeitslosigkeit, Faschismus und Weltkrieg), und dass 2. die Politik der USA seit dem Ende des Ost-West-Gegensatzes und seit dem Golfkrieg 1991 immer deutlicher in diese Richtung geht. Auch das nun von George W. Bush verkündete Hochrüstungsprogramm für die USA bestätigt diese Vermutung.
VII.
Die sozialistische und kommunistische Linke hat sich – historisch betrachtet – mit der internationalen Politik oft schwer getan, obwohl sie sich doch mit dem Hinweis auf die Schlusssätze des "Kommunistischen Manifests" (1848) und auf die Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation (1864) als authentischen Träger des Internationalismus bezeichnen durfte. Um so tiefer waren die Rückschläge, die mit dem Zerfall der Internationale im August 1914 hingenommen werden mussten. Für Teile der internationalistischen Linken ist zudem (spätestens) seit 1990/91 das Raster der Parteinahme in internationalen Konflikten zerbrochen – sowohl zwischen der NATO und dem Warschauer Pakt als auch zwischen dem US-Imperialismus nebst Verbündeten und den antiimperialistischen Befreiungsbewegungen.
Heute sieht es eher so aus, dass Internationalismus ("Globalismus") von den transnationalen Konzernen und der "globalen Klasse" (Sklair 1997; van der Pijl 1998; Dahrendorf 2000) sowie von der US-amerikanischen Regierung selbst als Selbstbeschreibung des Modells der amerikanischen Weltherrschaft vertreten wird (Anderson 2002). Die Reste der Arbeiterbewegungen hingegen vertreten einerseits die Notwendigkeit nationaler Regulierungen gegen die Übermacht der Weltmärkte; andererseits werden Teile der Arbeiterklasse, die sich in ihrer Existenz durch die Globalisierung (und die damit verbundenen Prozesse der transnationalen Migration sowie der Zerstörung von Rechten und Errungenschaften der Arbeiterbewegung) bedroht fühlen, zu Trägern des Nationalismus und z.T. auch des Rassismus, wie er von den rechtsextremen Parteien in Europa (z.B. durch den Front National von Le Pen in Frankreich) vertreten wird.
Allerdings sollte daraus nicht die Schlussfolgerung der Abstinenz von politischer Interventionsfähigkeit gezogen werde, die sich dann in linksradikalen Phrasen bzw. in Fundamentalkritik und Forderungen nach dem Sturz des Imperialismus selbst befriedigt.[12] Die Linke muss – im Bewusstsein, dass die eigenen Formen der Reorganisation als soziale und politische Bewegung noch in den Anfängen sich befinden, aber doch schon durchaus lebendig sind – auch die Frage nach der Anschlussfähigkeit linker Politik auf der Ebene von Realpolitik und der dort konfligierenden Interessen stellen.
Es kann nicht bedeutungslos für die Linke sein, dass es auch unter den regierenden Kräften in Europa durchaus relevante Positionen gibt, die nicht nur die US-Politik kritisieren, sondern die im Kampf gegen den Terrorismus auf eine Politik der Verständigung, des Multilateralismus und auch der materiellen Umverteilung zwischen Zentrum und Peripherie setzen. Die Kirchen spielen hier z.B. eine Rolle, die auf die Rückgewinnung moralischer Standards – auch in der internationalen Politik – gerichtet ist. Vertreter der Kirchen vertreten heute oftmals Positionen (Kritik des weltweiten Kapitalismus, des Skandals der Armut, der mangelnden sozialen Gerechtigkeit usw.), die weite Teile der Linken aufgegeben haben. Es gibt durchaus relevante Kräfte in der Europäischen Union, die auf eine stärkere Autonomie der Europäer und auch auf eine Verteidigung des "europäischen Gesellschaftsmodells" gegenüber dem US-amerikanischen Modell setzen. Natürlich ist das sehr widersprüchlich; denn die herrschenden Klassen in der EU verfolgen dabei ihre eigenen Interessen, die gewaltförmiges Handeln nach außen überhaupt nicht ausschließt (ich erinnere nur an die Militär- und Interventionspolitik der französischen Republik, auch unter einer sozialistisch-grün-kommunistischen Regierung, die inzwischen abgelöst ist). Dennoch erfordert Friedenspolitik – als Voraussetzung auch für die Schaffung von Räumen für antikapitalistische Strukturreformen – möglichst breite Bündnis- und Diskurskonstellationen. Deshalb muss die Linke hier stets auch danach fragen, ob und an welche Positionen sie anschlussfähig ist, wie sie einwirken kann auf den herrschenden Diskurs, ja sogar, ob sie zwischenimperialistische Widersprüche zugunsten progressiver Entwicklungen (dazu würde allemal die Verhinderung von weiteren Kriegsschlägen durch die USA gehören; dazu würde auch ein energisches Eingreifen in den Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern gehören) beeinflussen kann.
Eine solche Überlegung geht davon aus, dass andere Politikvarianten als die derzeit herrschenden möglich sind. Es gibt – so der amerikanische Soziologe und Politikwissenschaftler Michael Mann (2001) – Alternativen zur Politik des "Krieges gegen den Terror", wie er von der Neuen Rechten in den USA und den harten Neorealisten als unvermeidlich angesehen wird. Ausgangspunkt ist für ihn ebenfalls der widersprüchliche Prozess der Globalisierung, der bestehende Spaltungen (und Fragmentierungen) in der Welt verstärkt und neue erzeugt. Die meisten dieser Spannungen bringen keine bewaffneten Auseinandersetzungen hervor; sie können durch friedliche Verhandlungen gelöst werden. Es ist vor allem das Aufkommen religiöser Fundamentalismen, das diese Spannungen enorm zugespitzt hat. Allerdings sind diese auch eine Folge verfehlter politischer Strategien des Westens, die den "Zusammenstoß der Fundamentalismen" (Tariq Ali 2002) beschleunigt haben. Er fragt: War denn diese schreckliche Konfrontation überhaupt nicht vermeidbar? Dass die USA der Hauptfeind eines militanten Fundamentalismus geworden sind, resultierte aus den – zunächst unbeabsichtigten – Folgen von drei amerikanischen Politiken: gegenüber dem Kommunismus, gegenüber Israel und in Bezug auf das Öl.
– Im Kampf gegen den Kommunismus haben die USA (und ihre Verbündeten) nicht nur korrupte und autoritäre Regime unterstützt, sondern auch terroristische Bewegungen (Taleban, UCK usw.). Deren Führungsgruppen rekrutierten sich (in der Regel) aus den herrschenden Klassen der angeblich vom Kommunismus bedrohten Länder und Regionen. Heute richten sie die Waffen gegen den US-Imperialismus, weil dieser ihnen nach dem Sieg über den Kommunismus ihren (ökonomischen und politischen) Anteil an der Macht beschneidet.
– Die USA haben Israel auch dann noch unterstützt, als der Staat Israel weniger ein Opfer als vielmehr selbst ein Unterdrücker geworden ist.
– Die Ölinteressen haben die USA dazu gebracht, eine große Anzahl von Truppen in Saudi Arabien und in den Scheichtümern am Golf zu stationieren, und den Irak als einen "Schurkenstaat" anzugreifen – während sie z.B. die Annexion von Osttimor durch Indonesien stillschweigend akzeptiert haben. Immerhin hat die Armee von Indonesien dort ca. 100.000 Menschen massakriert. Die Schlussfolgerung von Michael Mann: Der Krieg zwischen dem islamischen Fundamentalismus und dem Imperialismus des Nordens ("Northern Imperialism") ist nicht notwendig und unvermeidbar; er könnte durch drei Maßnahmen unterbunden werden:
– eine Gleichbehandlung von Israelis und Arabern ("a more even-handed approach to Israel/Palestine");
– weniger militärische und mehr wirtschaftliche Hilfe für die arabischen Regime;
– eine fortschrittliche internationale Entwicklungsstrategie, mit Umverteilung und Wachstum als den beiden Hauptzielen.
Peter Gowan (2002: 28/29) schreibt am Ende seiner Analyse über "US-Hegemonie und globale Unordnung" nach dem 11. September: "Die einzig sichere Schlussfolgerung, die sich aus dieser Analyse ziehen lässt, lautet, dass die zehn ruhmreichen Jahre des triumphierend über den Globus marschierenden atlantischen Liberalismus endgültig vorbei sind. Es ergeben sich Spannungen jedweder Art: zwischen Nord und Süd, zwischen den USA und den anderen Hauptmächten und selbst innerhalb einzelner Staaten durch die Entstehung eines vom neuen Kapitalismus hervorgebrachten autoritären Populismus. Die Bush-Administration richtet sich ganz offensichtlich stärker denn je darauf ein, die weltweite US-Dominanz noch fester zu verankern – was die Überdehnung dieses Projektes gewiss weitertreiben wird. Und wenn die Vereinigten Staaten nicht dazu in der Lage sein sollten, ihre Verbündeten zuverlässiger als bisher auf dieses globale Projekt zu verpflichten, könnten die Spannungen in der Allianz auch zum Ausbruch kommen. Auf geopolitischer Ebene würde wahrscheinlich China am meisten von einer solchen Entwicklung profitieren, weil ihm dann mehr Zeit zur Verfügung stünde, um seine gesellschaftliche Transformation durchzuführen und zu konsolidieren. Russland und Vladimir Putin könnten ebenfalls zu den Gewinnern zählen. EU-Europa kommt vermutlich demnächst an eine Art Weggabelung, wo es sich zwischen einem engeren, gegen den US-amerikanischen Druck gerichteten politischen Block und einer lockeren Option entscheiden muss, die eventuell sogar zur Desintegration führen könnte. Aber natürlich kann nicht ausgeschlossen werden, dass US-Politiker oder andere signifikante Teile des US-Establishments neue programmatische Schlussfolgerungen für das weltweite Krisenmanagement ziehen wie zum Beispiel eine echte Politik der Entschuldung, Armutsbekämpfung und Regulierung der Finanzmärkte".
VIII.
In Porto Alegre (im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande del Sul, der von der "Arbeiterpartei" [PT] regiert wird) versammelten sich Ende Januar/Anfang Februar 2002 ca. 70.000 Menschen zum "Zweiten Weltsozialforum", das sich als Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsgipfel von Davos (der in diesem Jahr, auch um den Protesten auszuweichen, in New York stattfand) versteht (Grefe u.a. 2002: 173ff.). Die Zahl der TeilnehmerInnen hatte beträchtlich zugenommen und das gesamte Treffen war von einer optimistischen Stimmung getragen – nicht so sehr hinsichtlich der globalen politischen Entwicklung nach dem 11. September, sondern im Blick auf die Entwicklung und Konsolidierung einer neuen, globalen Sozialbewegung, die die Globalisierung als kapitalistisches (neoliberales) bzw. imperiales Herrschaftsprojekt kritisiert und eine Politik verlangt, die mit der Kontrolle der globalen Finanzmärkte, dem Kampf gegen Privatisierung und Deregulierung, gegen den Abbau von Sozialstaatlichkeit und Gewerkschaftsrechten, gegen Krieg und Terror verbunden ist.
Die Losung, in der sich die Intentionen der Kämpfe in den Zentren wie in der Peripherie zusammenfassen, lautete: "Eine andere Welt ist möglich! Widerstand dem Neoliberalismus, dem Militarismus und Krieg. Für Frieden und soziale Gerechtigkeit!" Vor dem 11. September standen die Auseinandersetzungen mit den sozialökonomischen und ökologischen Widersprüchen der neoliberalen Globalisierung im Zentrum. Nach dem 11. September, als Kommentatoren erwarteten, dass nunmehr der von den USA geführte weltweite "Kampf gegen den Terrorismus" alle anderen Themen aufsaugen und überlagern würde, nahm die globalisierungskritische Bewegung das Thema des Friedens als zentrales Thema auf.[13] Gleichzeitig stand in Porto Alegre die Analyse der Krise in Argentinien im Mittelpunkt. Was in Seattle begann – als Bündnis von Gewerkschaftern, Umwelt- und Menschenrechtsgruppen – hat sich in zahlreichen Großdemonstrationen – über Davos bis nach Genua 2001 – zur Sozialbewegung eines neuen Internationalismus entwickelt, den auch die herrschende Politik nicht länger zu ignorieren vermag (Seoane/Taddei 2002; Klas 2002: Green/Griffith 2002; Socialist Register 2002).
In Deutschland z.B. reflektiert sich dieser Prozess u.a. in der Ausstrahlung des Konstitutionsprozesses von Attac. Ganz offensichtlich steht auch der Prozess der Renaissance einer neuen Militanz von Teilen der westeuropäischen Gewerkschaften im Zusammenhang jener Ansätze von kapitalismuskritischen Sozialbewegungen, die sich in Porto Alegre manifestierten. Die Generalstreikbewegungen in Italien und Spanien, die Massendemonstrationen bei den EU-Gipfeln von Barcelona und Sevilla, der "Summer of Discontent", den die britischen Gewerkschaften mit zahlreichen Streiks anheizen.[14] Es kommt jetzt darauf an, Vernetzungen zu sichern und auszubauen: zwischen der transnationalen Ebene und den unteren – d.h. nationalen und lokalen – Ebenen sowie zwischen den traditionellen Organisationen der Linken (Parteien, Gewerkschaften z.B.) und den Initiativen und Gruppen, die die Bewegung von unten tragen. Wirken wir daran mit, dass diese Bewegungen (in der ganzen Welt) nach dem 11. September noch stärker werden.
Literatur
Ali, Tariq (2002), The Clash of Fundamentalisms. Crusades, Jihads and Modernity, London/New York.
Amin, Samir (1997), Die Zukunft des Weltsystems. Herausforderungen der Globalisierung, Hamburg.
Anderson, Perry (2002), Internationalism: A Breviary, in: New Left Review, 14 (March/April 2002), S. 5-25.
Bourdieu, Pierre u.a. (1997), Perspektiven des Protests, Hamburg.
Brenner, Robert (2002), Die weltwirtschaftliche Rezession beginnt. Eine Diagnose, in: Sozialismus, 2/2002, S. 11-19.
Brzezinski, Zbigniew K. (1997), Die einzige Weltmacht. Amerikas Strategie der Vorherrschaft, Weinheim.
Conert, Hansgeorg (2002), Das amerikanische Imperium. Der "Krieg" gegen den Terrorismus als Etappe der Neuen Weltordnung, Supplement der Zeitschrift Sozialismus, 6/2002.
Cox, Robert W. (1998), Multilateralismus und Weltordnung, in: ders., Weltordnung und Hegemonie, FEG-Studie Nr. 11, Marburg, S. 87ff.
Dahrendorf, Ralf (2000), Die globale Klasse und die neue soziale Ungleichheit, in: Merkur, Jg. 54 (11), S. 1057-1068.
Deppe, Frank (1991), Jenseits der Systemkonkurrenz. Überlegungen zur "Neuen Weltordnung", Marburg.
Gill, Stephen (2000), Theoretische Grundlagen einer neogramscianischen Analyse der europäischen Integration, in: Hans-Jürgen Bieling/Jochen Steinhilber (Hrsg.), Die Konfiguration Europas. Dimensionen einer kritischen Integrationstheorie, Münster, S. 23-50.
Gowan, Peter (1998), The Global Gamble. Washington’s Faustian Bid for World Dominance, London/New York.
Gowan, Peter (2002), US-Hegemonie und globale Unordnung, Supplement der Zeitschrift Sozialismus, 5/2002.
Green, Duncan/Griffith, Metthew (2002), Globalization and its Discontent, in: International Affairs 78, 1(2002), S. 49-68.
Grefe, Christiane u.a. (2002), attac. Was wollen die Globalisierungskritiker? Berlin.
Hardt, Michael/Negri, Antonio (2002), Empire. Die neue Weltordnung, Frankfurt/New York.
Hirsch, Joachim (2001), Globalisierung und Terror, in Prokla 125, 31. Jg., Nr. 4, Dezember 2001, S. 511-521.
Hirsch, Joachim (2002), Herrschaft, Hegemonie und politische Alternativen, Hamburg.
Hirsch, Joachim/Jessop, Bob/Poulantzas, Nicos (2001), Die Zukunft des Staates, Hamburg.
Hobsbawm, Eric (1998), Das Zeitalter der Extreme. Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts, München.
Hoffmann, Stanley (2001), Vom neuen Kriege. Amerika braucht Partner, nicht nur Alliierte gegen den Terror, in: Die Zeit vom 11. Oktober 2002, S. 3.
Kagan, Robert (2002), Mission Ewiger Friede. Die Europäer sind schwach. Deshalb können sie Amerikas Macht nicht begreifen, in: Die Zeit vom 11. Juli 2002, S. 9.
Kaldor, Mary (2000), Neue und alte Kriege. Organisierte Gewalt im Zeitalter der Globalisierung, Frankfurt/Main.
Kennedy, Paul (1989), Aufstieg und Niedergang der großen Mächte. Frankfurt/Main.
Klas, Gerhard (2002), Bewährungsprobe bestanden. Ein Überblick über die neuen Bewegungen, ihre Akteure und Ideen, in: SoZ 1-2002, S. 3-10.
Mann, Michael (2001), Globalization and September 11, in: New Left Review, 12, November/December 2001, S. 51-72.
Matzner, Egon (2000), Monopolare Weltordnung. Zur Sozioökonomie der US-Dominanz, Marburg.
Nassauer, Otfried (2002), Eine neue militärische Aufteilung der Welt, Frankfurter Rundschau vom 15.7.2002, S. 6.
van der Pijl, Kees (1998), Transnational Classes and International Relations, London/New York.
Schuhler, Conrad (2002), Enron. Pleite von Walls Street und Washington. Institut für sozialökologische Wirtschaftsforschung, München, Spezial Nr. 16, Mai 2002.
Seoane, José/Taddei, Emilio (2002), From Seattle to Porto Alegre: The Anti-Neoliberal Globalization Movement, in: Current Sociology, January 2002, Vol. 50 (1), S. 99-122.
Sklair, Leslie (1997), Social movements for global capitalism: the transnational capitalist class in action, in: Review of International Political Economy, 4:3, Autumn 1997, S. 514-538.
Socialist Register (2002), ed. by Leo Panitch and Colin Ley: A World of Contradictions, London/New York.
Sommer, Theo (2002), Die Achse der Betonköpfe, in: Die Zeit vom 28.2.2002, S. 4.
von Weizsäcker, Christian (1999), Logik der Globalisierung, Göttingen.
Zinn, Karl Georg (1997), Jenseits der Markt-Mythen. Wirtschaftskrisen: Ursachen und Auswege, Hamburg.
Anmerkungen
[1] Vgl. dazu das Schwerpunktheft der Zeitschrift PROKLA (Nr. 125, Dezember 2001); dort vor allem den Artikel von Joachim Hirsch: Globalisierung und Terror, S. 511-521.
[2] Mary Kaldor (2000: 22/23) bezeichnet die neuen Kriege als "Mischgebilde aus Krieg, Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen". Diese beschränken sich keineswegs auf die Peripherie des Südens: "Die genannten Aspekte neuer Kriege finden sich auch in Nordamerika und Westeuropa ... Die Gewalt, die sich in den westeuropäischen und nordamerikanischen Innenstädten beobachten lässt, weist etliche Analogien mit den neuen Kriegen auf".
[3] Dieser These scheint zu widersprechen, dass in der zweiten Hälfte der 1990er Jahre – nach dem Wahlsieg von New Labour unter Tony Blair in Großbritannien – die europäische Sozialdemokratie in fast allen Ländern der EU in die Regierungen gewählt wurde. In ihrer Außenpolitik haben sich diese Regierungen aber fast vollständig den USA unterworfen. Traditionelle Positionen der Linken – Abrüstung, Entwicklungspolitik, Stärkung der UNO u.a. – kamen dabei kaum zur Geltung. Tony Blair hat sich sogar im eigenen Lande dem Gespött der Presse aussetzen müssen, weil er die Rolle als Schoßhund von George W. Bush noch überzog. Inzwischen deutet sich im Ergebnis der neueren Wahlen ein drastisches Ende des "Dritten Weges" an.
[4] Der neoliberale Radikalismus definiert die "Logik der Globalisierung" (von Weizsäcker 1999: 123) wie folgt: "Die wettbewerbliche Wirtschaft ist die Kraft der Veränderung, die Politik, sei sie demokratisch oder nicht, ist die Kraft der Beharrung und Bewahrung. Die Weltprobleme werden dadurch gelöst, dass man der Wirtschaft die Führungsrolle vor der Politik überlässt. Wenn unter dem Primat der Politik eine weitgehende Politisierung des Wirtschaftsgeschehens verstanden sein soll, dann kann dies nur in Stagnation, also letztlich in der Katastrophe enden".
[5] "Die Länder Europas stehen heute an einem Wendepunkt ihrer Geschichte, und es hängt alles davon ab, was sie tun werden. Sie können in Wiederanknüpfung an die Tradition der Aufklärung ... die Zivilisation auf eine neue Grundlage stellen. Und sie können ... in der Barbarei versinken ..." (Bourdieu u.a. 1997: 11).
[6] Aus ihrer These, dass der "Imperialismus ... vorbei" sei, folgt: "Die Vereinigten Staaten bilden nicht das Zentrum eines imperialistischen Projekts, ... tatsächlich ist dazu heute kein Nationalstaat in der Lage" (Negri/Hardt 2002: 12).
[7] Anders Immanuel Wallerstein (2002: 10): "Nach 500 Jahren seines Bestehens ist das kapitalistische Weltsystem erstmals in einer echten systemischen Krise und wir befinden uns in einer Zeit des Übergangs".
[8] Der Ökonom Egon Matzner hat in seinem Buch "Monopolare Weltordnung. Zur Sozioökonomie der US-Dominanz" (Marburg 2000) die Ergebnisse seiner Untersuchungen wie folgt zusammengefasst: "Das Verschwinden der Sowjetunion und das Erlahmen der bipolaren Systemkonkurrenz hatten nicht nur positive Folgen, wie das Ende der kommunistischen Diktaturen oder des (vorläufigen?) Rückgangs atomaren Wettrüstens ... Mit dem Ende der Systemalternative zur kapitalistischen Marktwirtschaft verschwanden auch Notwendigkeit und Anreiz, sich um Anliegen zu bemühen, die zuvor als öffentliche Aufgaben einen hohen Stellenwert einnahmen: Vollbeschäftigung, Einkommensgerechtigkeit, Chancengleichheit bei Erziehung, Gesundheit und Kultur. Dazu kam im internationalen Bereich die Abkehr vom Bestreben, Konflikte im Rahmen der UNO unter Anwendung friedlicher Verfahren auszutragen und, wenn möglich, friedlich beizulegen. Auch wenn diese Bemühungen in den nationalen und internationalen Arenen nicht immer erfolgreich gewesen sind, so waren die Ergebnisse zweifellos besser als jene, die durch Laisser-faire erreichbar gewesen sind. In den Jahren, die seit dem Fall der Mauer vergangen sind, ist das neue Muster, das an die Stelle der Bipolarität getreten ist, mehr und mehr erkennbar geworden. In diesem dominiert eindeutig die USA mit Hilfe anlassbezogener, flexibler Allianzen. Ich nenne sie deshalb die monopolare Weltordnung ... diese Ordnung bringt einem kleinen Teil der Weltbevölkerung bedeutsame, vor allem materielle Vorteile. Die negativen Folgen für den größeren Teil sind jedoch mindestens ebenso wichtig" (S. 19).
[9] In den USA gab (und gibt) es immer verschiedene "Schulen" hinsichtlich der Ausgestaltung des Verhältnisses von nationaler Interessen- und Machtpolitik und internationaler Bündnispolitik. In der Regierung Bush dominiert die "Neue Rechte", die eine harte Linie des Unilateralismus vertritt und eher verächtlich auf die Europäer (auf deren geringe militärische Macht sowie auf ihren "Pazifismus" und ihre Vorstellungen von Recht und Zivilität) herabschaut (vgl. dazu als Beispiel Kagan 2002). Eine andere Linie warnt vor den Folgen eines Unilateralismus, der neue Feinde erzeugt und alte Freunde abstößt. So warnte z.B. der Politikwissenschaftler Stanley Hoffmann (2001) kurz nach dem 11. September vor unbedachten Reaktion der US-Führung: "Das nationale Interesse gebietet es vielmehr, Partner zu suchen in dem gemeinsamen Streben nach Leben, Freiheit und Glück in einer aus den Fugen geratenen Welt".
[10] Bei der Parade zu den Revolutionsfeierlichkeiten in Paris (14. Juli 2002) war auch ein Wagen der New Yorker Feuerwehr sowie eine Truppe US-amerikanischer Soldaten in historischen Uniformen zugegen. Gleichzeitig erklärte der alte und neu gewählte Staatspräsident Chirac (nun mit einer konservativen Regierungsmehrheit im Rücken), dass Frankreich seine Rüstungsausgaben erhöhen werde, und dass er dies auch den EU-Partnern empfehle. Regierungen von Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien konkurrieren heute darum, als privilegierte Bündnispartner der USA anerkannt zu werden, um auf diese Weise ihr Positionen in den EU-Verhandlungen zu stärken, in denen seit "Nizza" (Ende 2000) die intergouvernementale Achse enorm gestärkt worden ist. Eine vergleichbare symbolische Bedeutung haben natürlich auch die Zärtlichkeiten, die der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder inzwischen mit dem russischen Staatspräsidenten Putin austauscht.
[11] "Die Weltkriege und eine Vielzahl anderer Kriege – insbesondere die Folge von "Stellvertreterkriegen", die mit dem Korea-Krieg (1950-53) begann – hatten ... belebende Wirkung auf die kapitalistische Akkumulation. Rüstungsökonomie eröffnet der kapitalistischen Akkumulation besonders günstige Pespektiven, weil es auf Kosten (fast) gar nicht ankommt ... Ganz unabhängig von der moralischen Einstellung der natürlichen Personen, die die kapitalistische Klasse bilden, besteht also zwischen Rüstungsökonomie bzw. Krieg und Kapitalismus eine Symbiose" (Zinn 1997: 145).
[12] Ein absoluter Tiefpunkt ist dort erreicht, wo (in den Binnendiskursen eines pseudolinken Journalismus) die Kritik an der Macht und der Politik der USA als Antiamerikanismus oder gar (unter Einschluss von Apologien der Politik Scharons in Israel) als Antisemitismus denunziert wird. Ich kann Kritik akzeptieren, die darauf aufmerksam macht, dass es eben nicht allein die USA, sondern auch die "Europäer" – und auch die Sozialdemokraten im eigenen Lande – sind, die sich bedingungslos an die Seite der USA stellen und die eben auch eigene imperialistische Ziele verfolgen. Dennoch sollte dabei nicht vergessen werden, dass die USA eine dominante Macht sind, dass sie objektiv eine Führungsrolle in der Welt spielen und dass sie diese auch subjektiv – bewusst und strategisch – bewahren und ausbauen wollen ("America First"). Und es sollte auch nicht vergessen werden, welche Rolle die USA in der Periode des Kalten Krieges gegen alle Bewegungen und Regierungen gespielt haben, die sich aus der Vorherrschaft des Imperialismus befreien wollten, die eine wirkliche Emanzipation für die breiten Volksmassen – im ökonomischen, sozialen, kulturellen, aber auch im Sinne politischer Partizipation von unten – durchsetzen wollten und dabei die Herrschaft der alten Eliten zu beseitigen hatten. Die USA haben überall – direkt oder indirekt – brutal zugeschlagen. Sie haben die blutigen Militärdiktaturen in Lateinamerika (vor allem in den 1970er Jahren) unterstützt und ausgerüstet. Sie haben den Tod, die Ermordung zehntausender Menschen billigend in Kauf genommen, wenn es darum ging, "Contras" gegen Regime auszurüsten, die sie als Bedrohung ihrer Macht in der Welt oder in der Region angesehen haben. Das Buch mit dem Titel "Die Akte Kissinger", das gerade von einem amerikanischen Journalisten verfasst wurde, mag illustrieren, was ich meine. Nach der Lektüre ist um so besser zu verstehen, warum die politische Klasse der USA sich (fast einmütig) strikt weigert, den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag anzuerkennen.
[13] In der Abschlusserklärung des Weltsozialforums 2002 in Porto Alegre heißt es in der These 4: "Der 11. September bezeichnete eine dramatische Wende. Nach den terroristischen Anschlägen, die wir entschieden verurteilen, so wie wir alle Anschläge auf Zivilisten in jedem Teil der Welt verurteilen, haben die Vereinigten Staaten mit ihren Alliierten eine gewaltige Militäroperation begonnen. Im Namen des ›Krieges gegen den Terrorismus‹ werden in der ganzen Welt zivile und politische Rechte verletzt. Mit dem Krieg gegen Afghanistan, in dem ebenfalls terroristische Methoden angewandt wurden, und mit den zukünftigen, bereits vorbereiteten Kriegen, befinden wir uns in einem permanenten, globalen Krieg. Seine Ausweitung wurde durch die Regierung der USA und ihre Alliierten entfesselt, um ihre Herrschaft zu festigen. Dieser Krieg enthüllt das brutalste und nicht akzeptable Gesicht des Neoliberalismus. Der Islam wird dämonisiert, während Rassismus und Xenophobie ihre ungehinderte Verbreitung finden. Information und Massenmedien beteiligen sich aktiv an dieser Kriegskampagne, die die Welt in ›gut‹ und ›böse‹ einteilt. Die Opposition gegen den Krieg ist eines der konstitutiven Elemente unserer Bewegungen".
[14] Bedeutsam ist dabei vor allem, dass die TUC-Gewerkschaften nach einer langen Phase des Niedergangs, der Schwächung und der Defensive, die mit sozialpartnerschaftlicher Anpassung verbunden war, nunmehr auch die New-Labour-Regierung von Tony Blair mit Streiks und zugleich die Labour Party mit der Zurückhaltung ihrer Mitgliederbeiträge unter Druck setzen. Außerdem haben sich in einigen Gewerkschaften bei Vorstandswahlen Vertreter des radikalen, linken Flügels gegen die alten – Blairfreundlichen – Vorsitzenden durchgesetzt.
Die großen Fortschrittsleistungen des 20. Jahrhunderts sind bedroht: die Demokratie und der Sozialstaat. Die seit fast drei Jahrzehnten andauernde Massenarbeitslosigkeit hat die Fundamente sozialer Sicherheit unterspült. Zukunftsängste breiten sich aus. Unter der Herrschaft des Neoliberalismus wurde die Gesellschaft einem engstirnigen betriebswirtschaftlichen Effizienzdenken und damit den Verwertungsinteressen des Kapitals unterworfen. Sozialdemokratische Mehrheiten in Europa waren nicht mehr als eine kurze Episode. Die Politik des "Dritten Weges" und der "neuen Mitte" scheiterte, weil sie ökonomische Entwicklungen und Interessen zu unabänderlichen Sachzwängen erklärte und damit vor der Aufgabe des Abbaus der Massenarbeitslosigkeit kapitulierte. Die politische Rechte hat Europa zurückerobert - in zahlreichen Ländern im Bündnis mit rechtspopulistischen / rechtsextremen Parteien.
Konservative und reaktionäre Kräfte haben ihren Einfluss auf Politik, Medien und Wissenschaft in einem Ausmaß verstärkt, das die soziale und kulturelle Freiheit einengt. Enorme Finanzmittel werden in die ideologischen Denkfabriken des Neoliberalismus investiert. Wissenschaft wird durch privatkapitalistische Finanzierung geködert und korrumpiert. In den staatlichen Institutionen und internationalen Organisationen herrscht ein reaktionäres Einheitsdenken, das den Umbau der gesellschaftlichen und internationalen Ordnung im Interesse der Machteliten vorantreibt und legitimiert.
Kapitalismuskritische Analysen von Wirtschaft und Gesellschaft werden ausgegrenzt. Sie drohen aus den gesellschaftlichen Institutionen und der Öffentlichkeit zu verschwinden. Denn gegenwärtig scheidet eine ganze Generation als Träger kritischer Theorie (verkürzt: 68er) aus dem Berufsleben aus. Die Stellen z.B. an den Hochschulen werden entweder gestrichen oder gemäß dem herrschenden "Zeitgeist" neu besetzt. Gerade in einer Zeit, in der sich der Protest gegen die negativen Folgen kapitalistischer Globalisierung neu formiert, soll der "Siegeszug des Marktes" vollendet werden.
Zur politischen Ökonomie rechtspopulistischer Wahlerfolge
Es zahlt sich zweifellos für rechte und radikale Parteien aus, die Karten von allgemeiner Unsicherheit und Überfremdung populistisch auszureizen. Sie können die vielfach geschürte Angst vor kriminellen Asylanten und Ausländern, die uns angeblich die raren Arbeitsplätze wegnehmen und ungerechtfertigt Sozialhilfe kassieren, mit steigender Tendenz in Wahlerfolge ummünzen. Dies verbindet rechtspopulistische Gruppierungen in Belgien und den Niederlanden, die bei den Kommunalwahlen in Antwerpen und Rotterdam jeweils ein Drittel der Stimmen erhielten; die Fortschrittspartei in Norwegen und die dänische Volkspartei, die ihre jeweiligen bürgerlichen Regierungen unterstützen; der Aufstieg der Freiheitlichen Partei in Österreich und der Volkspartei in Portugal, die beide Minister in ihren Regierungen stellen; schließlich die rechtsradikalen Koalitionäre Lega Nord und Alleanza Nazionale um Berlusconi in Italien und der Wahltriumpf der Front National von Le Pen in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen.
Rechtswendungen bei politischem Gestaltungsverzicht
Trotz aller Unterschiede in den einzelnen Ländern besteht ein allgemeiner polit-ökonomischer Zusammenhang, der den Mittel-Links-Regierungen von Italien über Frankreich bis nach Deutschland reihum Niederlagen beschert und konservative Parteien mit liberalen oder reaktionären Partnern wieder in den Sattel hilft. Diese waren noch vor ein paar Jahren wegen ihrer antisozialen und neoliberalen Politik abgewählt worden. Die Wähler wollten nicht mehr die Zeche für Standortstrategien zahlen, die mit Steuersenkungen und -umschichtungen, maßvollen Tarifabschlüssen und sinkenden Lohnnebenkosten den Unternehmern zwar steigende Gewinne und den Aktionären reichlich Dividenden, den abhängig Beschäftigten aber unsichere oder gar verschlechterte Arbeits- und Lebensbedingungen brachten.
Selbst Teile der alten und der neuen Mittelschichten hievten in fast allen Ländern der Europäischen Union gemäßigte Linke in Amt und Würden, versprachen diese doch wirtschaftliche Modernisierung mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden. Von den sozialdemokratischen Erben Margret Thatchers und Ronald Reagans erwarteten die Wähler in der Tat mehr sozialen Ausgleich. Die Protagonisten hierfür wurden jedoch von den eigenen Parteizentralen rasch ins zweite Glied zurück versetzt. So versiegten auch hierzulande mit Lafontaines Abgang arbeitnehmerfreundliche Maßnahmen; der Machtwechsel sollte nicht den erwarteten Politikwechsel und schon gar nicht ein verändertes gesellschaftliches Klima bringen.Schon bei Lohnforderungen, die sich verteilungsneutral nur am Produktivitätszuwachs und Inflationsausgleich orientieren, sehen einflussreiche Politiker, Manager und Verbandsvorsitzende die schwache Konjunktur gefährdet, hierbei sekundiert von einem anschwellenden Chor von Wissenschaftlern, Kommentatoren und Leitartiklern. Sie empfehlen den abhängig Beschäftigten jahrein und jahraus Zurückhaltung, während sich die Vorstände großer Unternehmen, aber auch die Vorsitzenden allerlei Verbände nach angelsächsischem Vorbild zunehmend ungenierter bedienen. Die exorbitanten Einkommenssteigerungen dieser Kreise sprechen allen Maßhalteappellen Hohn.
Der jahrzehntelange Trend der Polarisierung von Einkommen und Vermögen setzt sich daher überall ungebrochen fort, flankiert von arbeitsmarktpolitischen Deregulierungen und dem Einstieg in die Privatisierung sozialer Leistungen. So kann die um sich greifende allgemeine Verunsicherung auch nicht mehr durch einzelne, den Unternehmern abgetrotzte Konzessionen wie die 35 Stunden-Woche in Frankreich behoben werden. Denn insgesamt ergießt sich ein Füllhorn von angebotspolitischen Wohltaten auf die besser Verdienenden, in deren Glanze sich Teile der politischen Machtträger, vielfach gezeichnet von Korrumpierung und Korruption, so gerne sonnen. Wenn die einstigen Sachwalter für Solidarität aber die sozial Schwächeren mit Wasser abspeisen, selbst aber Wein mit den ökonomisch Stärkeren genießen, dann bleibt den von Arbeitslosigkeit bedrohten Arbeitern und Angestellten nicht viel Anderes mehr übrig, als gar nicht zur Wahl zu gehen oder den ehemaligen Genossen eine Abfuhr zu erteilen. Dies macht die jüngsten Wahlergebnisse in Frankreich und die Wahlprognosen in Deutschland durchaus vergleichbar.
Vor dem Hintergrund einer durchgängigen Diskreditierung sozialer Alternativen werden der Tendenz nach klassenbezogene Interpretationsmuster durch ethnische Vorurteile bis hin zu rassistischen Auswüchsen ersetzt. Statt in den asylsuchenden Flüchtlingen und einwandernden Ausländern noch stärker Benachteiligte als die inländischen Arbeitslosen und Sozialhilfeempfänger zu erkennen, stempelt man zunächst vor allem die fremden, aber dann auch zunehmend die eigenen Opfer weltwirtschaftlicher und weltpolitischer Verwerfungen zu den Schuldigen der sozialen Misere. Dabei tragen die rechtsopportunistischen Anpassungsmanöver etablierter Parteien insbesondere vor Wahlen trotz aller Distanzierungsversuche danach zum Aufbau aggressiver und gewaltbereiter Potenziale bei, die sich dann, gewissermaßen hoffähig gemacht, noch weiter rechts sammeln. Inwieweit dies in einzelnen europäischen Ländern gelingt, hängt von einer Vielzahl konkreter Bedingungen wie z.B. der Sogwirkung einer charismatischen Führerpersönlichkeit ab.Die Geschichte wiederholt sich zwar nicht in einfacher Form und auch nicht immer als Farce; aber sie bringt dann erneut reaktionäre und rechtsradikale Stimmungen, Gruppierungen und Parteiformationen hervor, wenn vergleichbare gesellschaftliche Krisen- und Kräftekonstellationen sich über eine längere Periode erstrecken. Angesichts eines permanenten Sozialabbaus und sich vertiefender öffentlicher Armut bei zugleich steigendem privaten Reichtum und sich verbreiternder neodarwinistischer Mentalitäten vermehrt sich auch die allgemeine gesellschaftliche Gewalttätigkeit mit individuellen Tabuverletzungen von den Straßen bis zu den Schulhöfen.
Hierdurch erfahren wiederum die massenpsychologisch wirksamen Rufe nach einer starken Führung und ordnenden Hand verstärkten Auftrieb. Von verschärften Sicherheits- und Zwangsmaßnahmen erwarten die verunsicherten und vereinzelten Individuen als Kehrseite der so hoch gepriesenen Individualisierung und Flexibilisierung mehr Schutz und Halt. Sie sollen in Zeiten des sich verbreiternden und vertiefenden Elends, aber auch des moralischen und kulturellen Verfalls endlich die Kriminellen und Korrupten hinter Schloss und Riegel bringen, aber auch Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängern Beine machen.
Darüber hinaus zeichnen die sich autoritär transformierenden Staatsapparate nicht nur durch sich verstärkende innere Repressionsdrohungen, sondern auch durch wieder erwachende kriegerische Interventionsgelüste aus. Das imperiale Gebaren der amerikanischen Hegemonialmacht, die sich keinerlei vertraglichen und völkerrechtlichen Bindungen unterwerfen will, soll an dieser Stelle nicht weiter erläutert werden, auch wenn die Bereitschaft zu einseitiger, ja gar präventiver Gewaltanwendung in den USA bedenkliche Ausmaße angenommen hat.
Aber auch die verbündeten europäischen Mächte möchten bei den inszenierten und angedrohten Strafexpeditionen in aller Welt wenigstens als Juniorpartner mitmischen - allen voran das einen Sonderstatus reklamierende Vereinigte Königreich, aber auch das wieder vereinigte Deutschland, das ebenfalls nach einem Platz an der Sonne drängelt. So treten wieder nationalistische und revanchistische Gespenster, wenn auch kleinformatig in einem veränderten weltpolitischem Arrangement, auf die europäische Bühne.
Die fatale Allianz von Macht- und Marktzwängen
Die NATO hat sich seit der Auflösung des Warschauer Paktes längst von einem regional beschränkten Verteidigungsbündnis zu einer weltweiten Interventionsmacht gewandelt, soweit sie von den USA überhaupt ins Kalkül gezogen wird. Sie erweitert nunmehr ihre Zielsetzung auf die Wahrnehmung strategischer Interessen, die sich in klassischer Manier auf die allgemeine Ressourcensicherung und hier insbesondere den Rohstoff Erdöl beziehen. Dies ist zugleich der vom Pentagon angeführte militärische Geleitschutz, der natürlich nur im Notfall offen in Erscheinung tritt, aber jeder Macht inner- und außerhalb des Bündnisses als präventive Abschreckung erkennbar bleibt, für einen Globalisierungsprozess der transnational agierenden Konzerne und der weltweit spekulierenden Finanzkapitale.Die imperial gestützte Durchsetzung des "Sachzwangs Weltmarkt", institutionell vermittelt über internationale Institutionen von der Europäischen Zentralbank bis zum Internationalen Währungsfonds, erklärt Funktionsverlust und Funktionsverschiebung der nationalen Regierungspolitiken, die auf neoliberale Macht- und Marktideologien eingeschworen werden. Sie unterscheiden sich daher in restriktiven Sozialausgaben und Haushaltsbudgets zugunsten von Standort- und Wettbewerbsförderung immer weniger voneinander. Dabei konvergieren traditionelle, sozialkulturell verankerte Links-Rechts-Alternativen in eine zunehmend diffuse Mittellage, die allenfalls noch an ihren milieubedingten Rändern weltanschaulich ausfranst.
So stehen die künstlich personalisierten Wahlkämpfe um den puren Machterhalt oder Machterwerb in einem direkten Verhältnis zur inhaltlichen Substanzlosigkeit, die mit einem richtungslosen Pragmatismus übertüncht wird. Es geht nicht mehr um politische Alternativen, die als unzeitgemäß abgelehnt werden, sondern nur noch darum, es irgendwie besser machen zu wollen und dies vor allem publikumswirksam zu präsentieren, auch wenn aus wahltaktischen Gründen zuweilen auf traditionelle Polarisierungen von der einen oder anderen Seite zurückgegriffen wird.
Ein entscheidendes Problem ist die gegenwärtige Verriegelung von gesellschaftlichen Alternativen angesichts der Nachwirkungen der realsozialistischen Implosion. Sie war nicht nur durch gigantische Rüstungswettläufe vorangetrieben, sondern auch von der kapitalistischen Entwicklungsdynamik beschleunigt worden. Während diese eine innovative Flexibilität in technologischen, organisatorischen und individuellen Formen freisetzte, zeichnete sich das sowjetische Imperium durch eine sklerotische Erstarrung der weitgehend nur verstaatlichten Produktionsverhältnisse aus. Sie wurden als bürokratische Fesseln, vor denen schon Lenin nach der Oktoberrevolution warnte, von den sich informationstechnologisch entfaltenden Produktivkräften gesprengt. Insofern handelte es sich ironischerweise um einen im marxistischen Sinne nahezu gesetzmäßigen Zusammenbruch, der durch die viel zu spät kommenden und machtpolitisch nicht ausbalancierten Reformversuche unter Gorbatschow nur noch beschleunigt wurde.
Das erleichterte die weitgehende Fixierung staatlicher und internationaler Entscheidungsträger auf die freien Marktkräfte als scheinbaren Endpunkt der Geschichte, ohne dass dieser ökonomische Totalitarismus in seinen potenziell autoritären Ausprägungen in Frage gestellt wurde. Das erfolgreiche Modell hierfür war zuvor schon die Einsetzung der chilenischen Pinochet-Diktatur und ihre Liaison mit den neoliberalen Chicago-Boys, die gegen das gelegentliche Blutbad für allzu demokratische Bestrebungen nichts einzuwenden hatten.
Wie sehr in den letzten Jahren der überkommene konstitutionelle Dreiklang aus Freiheits-, Gleichheits- und Solidaritätsprinzipien, aber auch die herausgearbeiteten allgemeinen Normen und schon praktizierten Standards des Völkerrechts ausgehebelt werden, zeigt sich zynischerweise besonders deutlich in der Menschenrechtsrhetorik gegenüber der arabischen Welt, mit der die Stärke des Rechts allenthalben zum Recht der Stärkeren transformiert wird.Die gewaltsamen Formen zivilisatorischer Rückbildung drohen zur Signatur einer ganzen Epoche zu werden - von ganz weit oben in den jeweiligen politisch-militärischen Machtzentren über eine breite Palette privater gesellschaftlicher Agenturen bis ganz nach unten in die psychische Verfassung der einzelnen Individuen. So sehr in den vielfältigen neuen Gewaltexplosionen auch untergründige archaische Seinsformen zum Vorschein kommen mögen, ihre potenzierte gesellschaftliche Freisetzung ist letztendlich auf einen entgrenzten Konkurrenzkampf aller gegen alle in der Shareholder-Value-Ökonomie zurückzuführen. Eine zwecks entfesselter Profitmacherei fortschreitende marktwirtschaftliche Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung unterwirft die ganze Welt bis zu den individuellen Genen der Lebewesen einer warenförmigen Transformation, in der die Erbschaft der sich entfaltenden Natur und Kultur vernutzt, verwertet und vernichtet wird.
Die hierbei beschleunigten gesellschaftlichen Forschungs- und Innovationsprozesse resultieren in permanenten Produktivitäts- und Profitsteigerungen, mit denen weltweit spekuliert wird. Investitionen erfolgen erst bei noch höheren Gewinnmargen in einem globalen Mix von möglichst niedrigen Kosten und hohen Leistungen. Entsprechend sinkende Anteile der Löhne, Sozialausgaben und Steuern an der gesellschaftlichen Wertschöpfung bewirken jene Nachfrageausfälle, die das Wachstum strangulieren und Unterbeschäftigung auf einem hohen Niveau garantieren, wodurch die Arbeits- und Lebensbedingungen allgemein weiter verunsichert und für wachsende Teile der Bevölkerung verschlechtert werden.Diese Abwärtsspirale einer perversen Ökonomie kommt am deutlichsten in steigenden Aktienkursen bei Massenentlassungen zum Ausdruck. Von arbeitslosen Aktienbesitzern kann aber keine Gesellschaft leben - ein Trugbild, das sich allerdings der Mainstream der etablierten Wirtschaftslehren als erkenntnisleitendes Interesse auserkoren hat.
Widerstand als demokratisch zu legitimierende Praxis Gegen die Zerstörung sozial-kultureller Errungenschaften und Traditionsbestände in aller Welt durch den Terror einer neoliberalen Ökonomie, mit dem sich die barbarischen Ausbeutungsformen des frühindustriellen Kapitalismus nunmehr im Weltmaßstab wiederholen, ist vor fünf Jahren der Chefredakteur von Le Monde Diplomatique, Ignazio Ramonet, mit der Losung "Die Finanzmärkte entwaffnen" aufgestanden. Inzwischen hat die globalisierungskritische Bewegung Attac die sich zuspitzenden ökologischen und sozialen Probleme weltweit von Seattle bis Genua auf die Tagesordnung gestellt. Sie vermittelt eine praktische Aufklärung über die realpolitische Alternative zwischen "neoliberalem Salto mortale oder sozial-ökologischer Utopie" (siehe FR Online zum Thema "Arbeit im Wandel" http://www.f-r.de/fr/spezial/arbeit2002/index.htm). Für ihre Realisierung sind konkrete Alternativvorschläge auf allen gesellschaftlichen Ebenen von unten nach oben und von Süd nach Nord zu entwickeln.
In diesem Zusammenhang müssen jedoch demokratische Regierungen, die gegenüber dem Souverän rechenschaftspflichtig sind, ihre Beteiligung an internationalen Entscheidungsprozessen offenlegen. Es ist unter verfassungspolitischen Gesichtspunkten ein andauernder Skandal, dass die imperialen Positionen des "Washingtoner Konsensus" als ultraliberaler Sachzwang wie das Evangelium von der Kanzel den Völkern verkündet und als immer neue Strukturanpassungsprogramme oder Spardiktate aufgebürdet werden - eine soziale Abwärtsspirale, die im Widerspruch zu der allgemeinen Steigerung des gesellschaftlichen Reichtums steht. Sie kommt erst dann zum Stehen, wenn der Widerstand größerer Volksmassen wie jüngst in Argentinien bedrohliche Ausmaße annimmt.
Gegenüber den vorherrschenden Kapitalverwertungs- und Spekulationsinteressen mit ihren katastrophalen Folgen für Mensch und Natur sind erweiterte und erneuerte Aktionsformen zu entwickeln, die traditionelle Solidarität und individuelle Kreativität in sich erweiternden Netzwerken von der lokalen bis zur internationalen Ebene zusammenknüpfen. Auf europäischer Ebene beginnen Gewerkschafter, Umweltaktivisten und Globalisierungskritiker gemeinsam gegen steuer-, sozial- und umweltpolitische Unterbietungswettläufe im Standortwettbewerb und für infrastrukturentwickelnde, existenzsichernde und beschäftigungsfördernde Maßnahmen einzutreten. Dazu gehören u.a. die Förderung von ökologisch und sozial orientierten Investitionen und öffentlichen Dienstleistungen, die staatliche Finanzierung von Bildungs-, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen sowie eine solidarische Gesundheits-, Arbeitslosen- und Rentenversorgung. Im Kontext der sozialen Existenzsicherung als Grundlage der Menschenwürde können weitere Arbeitszeitverkürzungen der Entfaltung individuell und gesellschaftlich sinnvoller Tätigkeiten dienen.
Diese Zielsetzungen müssen als konstitutive Bestandteile eines europäischen Gesellschaftsmodells über eine weitgehende Beteiligung, Mitwirkung und Selbstbestimmung der Beschäftigten und Bevölkerungen schrittweise in die marktwirtschaftlichen Steuerungskriterien und betriebswirtschaftlichen Rentabilitätskalküle eingehen. Ohne in diesem Sinne demokratisch legitimierte Regulierungsformen mit entsprechenden wirtschaftspolitischen Interventionen ist das europäische Sozial- und Kulturniveau in der angestrebten dynamische Wissensgesellschaft des frühen 21. Jahrhunderts nicht zu halten, geschweige denn weiter zu entwickeln. Hierbei könnte die selbst von Helmut Schmidt befürwortete Finanzaußenpolitik der Europäischen Union einen strategischen Flankenschutz gewähren. In diesem Sinne sind die gewählten europäischen Regierungsvertreter in den internationalen Institutionen zu mandatieren.
Das schließt eine klare Frontstellung gegen die von der Welthandelsorganisation (WTO) betriebene Privatisierung der öffentlichen Dienstleistungen nicht nur im Kommunikations- und Verkehrswesen, in der Energie- und Wasserversorgung, sondern vor allem auch in den sensiblen Sektoren von Bildung, Gesundheit und Renten ein. Es muss verhindert werden, dass die kollektive, auf Gegenseitigkeit beruhende Solidarität durch die individuelle Zahlungsfähigkeit zugunsten der Förderung neuer Kapitalmärkte ersetzt wird. Auf dem Weltsozialforum von Porto Alegre ist bereits darauf hingewiesen worden, dass die im Allgemeinen Abkommen des Handels mit Dienstleistungen (GATS) angestrebte Verallgemeinerung der Logik des Profits im Bildungs- und Gesundheitsbereich drastische Verschärfungen der sozialen und regionalen Ungleichheit mit ideologischen und kulturellen Gleichschaltungen im herrschenden Kapitalinteresse kombiniert.
Weitere klassen- und schichtspezifische Differenzierungen im Weltmaßstab sind durch gründlich reformierte internationale Institutionen zu verhindern, die mit Steuern, Kontrollen und Sanktionen die finanzkapitalistische Spekulation eindämmen und transnationale Kapitalbewegungen entwicklungsfördernd regulieren. Dazu gehören die viel diskutierte Tobin-Steuer auf den Devisenhandel, die schon länger thematisierten Kapitalverkehrskontrollen und die Auflösung der teilweise kriminellen Steuerparadiese bis hin zur vollständigen Streichung der Schulden der Entwicklungsländer.
International wirksame und demokratisch legitimierte Regulationsformen sind entscheidende Voraussetzungen für eine umfassende Realisierung von ökologischer Nachhaltigkeit, sozialem Ausgleich und kultureller Entfaltung. Sie können, so unterschiedlich diese Prozesse auch in den einzelnen Regionen der Welt verlaufen mögen, Ausbeutung und Unterdrückung, soziale Exklusion und erzwungene Migration, damit aber auch Fremdenfeindlichkeit und Ausländerhass, Rassismus und Diskriminierungen in den europäischen Ländern zurückdrängen. Hier sind soziale Inklusion und kulturelle Identitätsfindung im Unterschied zur totalitären Assimilation geeignet, eine soziale Integration in der kulturellen Differenz zu fördern.
Die sozial eingebettete, sich aus der Aufklärung speisende Multikulturalität stellt eine vernachlässigte europäische Erbschaft, aber auch eine politisch und ökonomisch voraussetzungsvolle Entwicklungsform dar. So ist die Ringparabel in Lessings "Nathan dem Weisen" immer wieder einzulösen. Sie wird im Maße ihrer Realisierung immer weniger von der neoliberalen Macht- und Marktdialektik geprägte Wahlergebnisse hervorbringen.
Es zahlt sich zweifellos für rechte und radikale Parteien aus, die Karten von allgemeiner Unsicherheit und Überfremdung populistisch auszureizen. Sie können die vielfach geschürte Angst vor kriminellen Asylanten und Ausländern, die uns angeblich die raren Arbeitsplätze wegnehmen und ungerechtfertigt Sozialhilfe kassieren, mit steigender Tendenz in Wahlerfolge ummünzen. Dies verbindet rechtspopulistische Gruppierungen in Belgien und den Niederlanden, die bei den Kommunalwahlen in Antwerpen und Rotterdam jeweils ein Drittel der Stimmen erhielten; die Fortschrittspartei in Norwegen und die dänische Volkspartei, die ihre jeweiligen bürgerlichen Regierungen unterstützen; der Aufstieg der Freiheitlichen Partei in Österreich und der Volkspartei in Portugal, die beide Minister in ihren Regierungen stellen; schließlich die rechtsradikalen Koalitionäre Lega Nord und Alleanza Nazionale um Berlusconi in Italien und der Wahltriumpf der Front National von Le Pen in der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahlen.
Rechtswendungen bei politischem Gestaltungsverzicht
Trotz aller Unterschiede in den einzelnen Ländern besteht ein allgemeiner polit-ökonomischer Zusammenhang, der den Mittel-Links-Regierungen von Italien über Frankreich bis nach Deutschland reihum Niederlagen beschert und konservative Parteien mit liberalen oder reaktionären Partnern wieder in den Sattel hilft. Diese waren noch vor ein paar Jahren wegen ihrer antisozialen und neoliberalen Politik abgewählt worden. Die Wähler wollten nicht mehr die Zeche für Standortstrategien zahlen, die mit Steuersenkungen und -umschichtungen, maßvollen Tarifabschlüssen und sinkenden Lohnnebenkosten den Unternehmern zwar steigende Gewinne und den Aktionären reichlich Dividenden, den abhängig Beschäftigten aber unsichere oder gar verschlechterte Arbeits- und Lebensbedingungen brachten.
Selbst Teile der alten und der neuen Mittelschichten hievten in fast allen Ländern der Europäischen Union gemäßigte Linke in Amt und Würden, versprachen diese doch wirtschaftliche Modernisierung mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden. Von den sozialdemokratischen Erben Margret Thatchers und Ronald Reagans erwarteten die Wähler in der Tat mehr sozialen Ausgleich. Die Protagonisten hierfür wurden jedoch von den eigenen Parteizentralen rasch ins zweite Glied zurück versetzt. So versiegten auch hierzulande mit Lafontaines Abgang arbeitnehmerfreundliche Maßnahmen; der Machtwechsel sollte nicht den erwarteten Politikwechsel und schon gar nicht ein verändertes gesellschaftliches Klima bringen.Schon bei Lohnforderungen, die sich verteilungsneutral nur am Produktivitätszuwachs und Inflationsausgleich orientieren, sehen einflussreiche Politiker, Manager und Verbandsvorsitzende die schwache Konjunktur gefährdet, hierbei sekundiert von einem anschwellenden Chor von Wissenschaftlern, Kommentatoren und Leitartiklern. Sie empfehlen den abhängig Beschäftigten jahrein und jahraus Zurückhaltung, während sich die Vorstände großer Unternehmen, aber auch die Vorsitzenden allerlei Verbände nach angelsächsischem Vorbild zunehmend ungenierter bedienen. Die exorbitanten Einkommenssteigerungen dieser Kreise sprechen allen Maßhalteappellen Hohn.