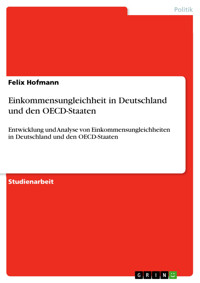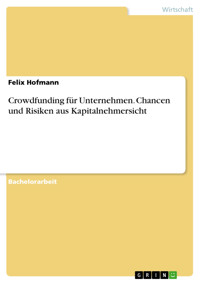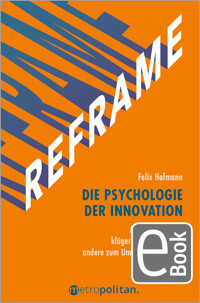
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Metropolitan
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Mutiger handeln, klüger entscheiden und andere zum Umdenken bewegen
Innovationsexperte, YouTuber und mehrfacher Gründer Felix Hofmann erklärt in diesem Buch, warum Führungskräfte, die für Innovation verantwortlich sind, meist kurzfristig denken und zu vorsichtig handeln.
Sie tun das nicht, weil sie feige oder rückständig sind, sondern weil es in der Natur des Menschen liegt, Risiken aus dem Weg zu gehen, Verluste vermeiden zu wollen und kurzfristige Erfolge anzustreben. Die Psychologie lehrt uns, dass Menschen einer Reihe von kognitiven Verzerrungen unterliegen, die dazu führen, oftmals irrational zu handeln.
Das führt zu einer paradoxen Situation: Zwar befürworten die meisten Menschen einer Organisation und insbesondere die Führungsetage Innovation, stellen sich ihr jedoch häufig bewusst oder unbewusst in den Weg.
Die Folge ist, dass mutiges und langfristiges Denken oftmals auf der Strecke bleibt, man sich lieber an der Konkurrenz orientiert, statt selbst visionär zu sein, und sich mit kleinen Verbesserungen zufriedengibt, statt große Innovationen umzusetzen.
Doch wie lässt sich diese Irrationalität nutzen, um kreativer, mutiger und langfristiger zu handeln? Der Schlüssel dafür heißt REFRAMING.
Reframing bedeutet, die Perspektive zu verändern. Dadurch kannst du Kreativität fördern, Referenzpunkte verändern und beeinflussen, was als Gewinn oder Verlust wahrgenommen wird. Reframing heißt, Psychologie zu nutzen, um mehr Innovation möglich zu machen.
- neue Fragen zu entwickeln, um auf kreativere Lösungen zu kommen.
- Priming einzusetzen, damit Menschen größer denken.
- schrittweise Courage aufzubauen.
- Techniken, um Ängste zu überwinden.
- Methoden, um mehr Mut und Klarheit bei risikoreichen Projekten zu haben.
- exponentielle Entwicklungen besser vorherzusehen.
- strategische Wendepunkte rechtzeitig zu erkennen.
- die Kunst, eine Kultur des langfristigen Denkens zu schaffen.
- das richtige Aufsetzen von Innovationsprojekten, damit sie langfristig erfolgreich sein können.
- verzögerte Intuition einzusetzen, um bessere Entscheidungen zu treffen.
- Techniken, um Rückschläge in Motivation zu verwandeln.
- Innovation in deiner Organisation zur Norm zu machen.
- das zu framen, was als Erfolg zählt und damit mutiges und innovatives Handeln zu treiben.
- das Framen von Veränderung, sodass andere bereit sind, sie zu unterstützen.
- andere zu überzeugen, mutiger zu handeln und mehr Innovation zu fördern.
Diese und viele weitere konkrete Ratschläge, Methoden und Tools aus den Verhaltenswissenschaften unterstützen die Geschäftsführung, das Innovationsmanagement und jeden, der in einer Organisation Innovation voranbringen will (z. B. Intrapreneure) dabei, mutiger, kreativer und langfristiger zu agieren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 239
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
1. Auflage
© WALHALLA Fachverlag, Regensburg
Dieses E-Book ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt. Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe oder Leihe an Dritte ist nicht erlaubt. Auch das Einspeisen des E-Books in ein Netzwerk (z. B. Behörden-, Bibliotheksserver, Unternehmens-Intranet) ist nicht erlaubt. Sollten Sie an einer Serverlösung interessiert sein, wenden Sie sich bitte an den WALHALLA-Kundenservice; wir bieten hierfür attraktive Lösungen an (Tel. 0941/5684-210).
Hinweis: Unsere Werke sind stets bemüht, Sie nach bestem Wissen zu informieren. Eine Haftung für technische oder inhaltliche Richtigkeit wird vom Verlag aber nicht übernommen. Verbindliche Auskünfte holen Sie gegebenenfalls bei Ihrem Rechtsanwalt ein.
Kontakt: Walhalla Fachverlag Haus an der Eisernen Brücke 93042 Regensburg Tel. (09 41) 56 84-0 Fax. (09 41) 56 84-111 E-Mail [email protected] Web
Kurzbeschreibung
Mutiger handeln, klüger entscheiden und andere zum Umdenken bewegen
Mehr Mut zu Innovation mit Reframing
Innovationsexperte, YouTuber und mehrfacher Gründer Felix Hofmann erklärt in diesem Buch, warum Führungskräfte, die für Innovation verantwortlich sind, meist kurzfristig denken und zu vorsichtig handeln.
Sie tun das nicht, weil sie feige oder rückständig sind, sondern weil es in der Natur des Menschen liegt, Risiken aus dem Weg zu gehen, Verluste vermeiden zu wollen und kurzfristige Erfolge anzustreben. Die Psychologie lehrt uns, dass Menschen einer Reihe von kognitiven Verzerrungen unterliegen, die dazu führen, oftmals irrational zu handeln.
Das führt zu einer paradoxen Situation: Zwar befürworten die meisten Menschen einer Organisation und insbesondere die Führungsetage Innovation, stellen sich ihr jedoch häufig bewusst oder unbewusst in den Weg.
Die Folge ist, dass mutiges und langfristiges Denken oftmals auf der Strecke bleibt, man sich lieber an der Konkurrenz orientiert, statt selbst visionär zu sein, und sich mit kleinen Verbesserungen zufriedengibt, statt große Innovationen umzusetzen.
Doch wie lässt sich diese Irrationalität nutzen, um kreativer, mutiger und langfristiger zu handeln? Der Schlüssel dafür heißt REFRAMING.
Reframing bedeutet, die Perspektive zu verändern. Dadurch kannst du Kreativität fördern, Referenzpunkte verändern und beeinflussen, was als Gewinn oder Verlust wahrgenommen wird. Reframing heißt, Psychologie zu nutzen, um mehr Innovation möglich zu machen.
In REFRAME – Die Psychologie der Innovation lernst du,
neue Fragen zu entwickeln, um auf kreativere Lösungen zu kommen.Priming einzusetzen, damit Menschen größer denken.schrittweise Courage aufzubauen.Techniken, um Ängste zu überwinden.Methoden, um mehr Mut und Klarheit bei risikoreichen Projekten zu haben.exponentielle Entwicklungen besser vorherzusehen.strategische Wendepunkte rechtzeitig zu erkennen.die Kunst, eine Kultur des langfristigen Denkens zu schaffen.das richtige Aufsetzen von Innovationsprojekten, damit sie langfristig erfolgreich sein können.verzögerte Intuition einzusetzen, um bessere Entscheidungen zu treffen.Techniken, um Rückschläge in Motivation zu verwandeln.Innovation in deiner Organisation zur Norm zu machen.das zu framen, was als Erfolg zählt und damit mutiges und innovatives Handeln zu treiben.das Framen von Veränderung, sodass andere bereit sind, sie zu unterstützen.andere zu überzeugen, mutiger zu handeln und mehr Innovation zu fördern.Diese und viele weitere konkrete Ratschläge, Methoden und Tools aus den Verhaltenswissenschaften unterstützen die Geschäftsführung, das Innovationsmanagement und jeden, der in einer Organisation Innovation voranbringen will (z. B. Intrapreneure) dabei, mutiger, kreativer und langfristiger zu agieren.
Autor
Felix Hofmann ist ein Innovationsexperte, YouTuber und mehrfacher Gründer. Er war sieben Jahre lang Geschäftsführer des BMI Labs, einem Spin-off der Universität St. Gallen, das Unternehmen bei der Entwicklung neuer Geschäftsmodelle unterstützt. Als Innovationsberater moderierte er hunderte Workshops zum Thema Geschäftsmodellinnovation und unterstützte große europäische Konzerne in der Innovation. Nebenbei hilft er Start-ups als Mentor bei mehreren internationalen Startup-Programmen.
Zuvor war er Mitgründer von PaperC, Deutschlands Startup des Jahres 2009, einer Plattform für akademische eBooks, deren Co-CEO er vier Jahre lang war. Außerdem ist er Mitgründer von FIVE, einem Schweizer Naturkosmetik-Startup, das in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ bekannt wurde.
Felix Hofmann studierte Business Innovation M.A. an der Universität St. Gallen in der Schweiz. Seine Leidenschaft ist die Rolle von Mensch und Psychologie in der Innovation. Warum schaffen es ein paar Ausnahmen, wirklich neue Dinge in die Welt zu bringen, während die meisten Firmen sich damit schwertun und scheitern?
Schnellübersicht
Vorwort
1. Verzerrte Wahrnehmung
2. Wege zu mehr Kreativität
3. Nutze deine Angst als Kompass
4. Die Macht der langfristigen Perspektive
5. Die Psychologie des Durchhaltens
6. Andere zum Umdenken bewegen
7. Reframing-Tools
Anhang
Reframing: Der Schlüssel für mehr Innovation
Wenn du jemanden in deiner Organisation fragen würdest, ob Innovation wichtig ist, lautet die Antwort wahrscheinlich „Ja“ – ganz gleich, wen du fragst. Wenn es aber darauf ankommt, wenn die Ressourcen für Innovation in Konkurrenz zu anderen Themen stehen, wenn man große Risiken eingehen und sich auf Neuland bewegen muss, dann schrecken viele zurück. Warum ist das so?
Falls du Bücher wie Schnelles Denken, Langsames Denken von Daniel Kahneman oder Die Kunst des klaren Denkens von Rolf Dobelli kennst, weißt du, dass Menschen seltsame, irrationale Wesen sind. Die meisten halten sich für schlauer und kreativer als sie tatsächlich sind, haben viele Ängste, die sie nur selten zugeben würden, denken kurzfristig, sind schlecht darin, eine einmal gefasste Meinung zu ändern, und noch schlechter darin, andere zum Umdenken zu bewegen. Wir lesen darüber, amüsieren uns über unsere eigenen Unzulänglichkeiten und schlagen das Buch schlussendlich mit einem lachenden und einem weinenden Auge wieder zu.
Für die Innovation in etablierten Organisationen ist diese „Unbelehrbarkeit“ jedoch tragisch. Man liest viel von fehlender Risikokultur, organisatorischer Trägheit und den „Antikörpern“, die radikale Innovation verhindern. Es klingt ganz so, als könnte man dagegen nichts tun. Dabei ist es möglich, kognitive Verzerrungen (Englisch: biases) nicht nur zu erkennen und ihnen damit einen Teil ihrer Macht zu nehmen, sondern sie auch zu nutzen. Wir können nämlich ihre Macht, wie bei der japanischen Kampfkunst Aikido, umleiten und zur Förderung von Innovation einsetzen.
Der Schlüssel dazu ist das Reframing. Das ist ein Begriff, den du wahrscheinlich schon mal gehört hast, sonst hättest du vielleicht auch nicht zu diesem Buch gegriffen, der jedoch meist etwas schwammig bleibt. Aber wenn du mir ein paar Stunden deiner Zeit schenkst, wirst du nicht nur eine bessere Vorstellung davon haben, was Reframing bedeutet und wie es angewendet wird, sondern auch eine Reihe von Tools und Übungen kennen, die dir und anderen helfen, kreativer, mutiger und langfristiger zu handeln.
Warum dieses Buch?
Braucht es ein weiteres Buch über Innovation? Das habe ich mich auch gefragt. Ich denke schon! Und das ist der Grund:
Es gibt Bücher über kognitive Verzerrungen aus dem Bereich der Verhaltenswissenschaften. Und es gibt Bücher über Corporate Innovation und Unternehmenskultur. Doch kein Buch bringt diese beiden Themen direkt zusammen. Dabei bringt die Verschmelzung sehr viele Erkenntnisse, wie ich finde. Dieses Buch erklärt, warum Innovation in etablierten Unternehmen meistens scheitert und zeigt auf, was verändert werden muss, damit sie gelingen kann.
Ich hoffe, dass du nach dem Lesen des Buches die Dinge besser verstehst, die sich jeden Tag vor deinen Augen abspielen. Warum investieren wir in unserer Firma nicht in Innovation, wenn wir doch wissen, wie wichtig sie ist und ständig davon reden? Warum schaffen wir es nicht, Projekte zu beenden, deren strategische Bedeutung verloschen ist? Warum gelingt es uns nicht, radikal und neu zu denken? All diese und weitere Fragen sollen nach dem Lesen des Buches klarer sein.
Innovation hat mich schon immer fasziniert. Seit ich ein Teenager war, wollte ich etwas gründen und Neues erschaffen. Im Jahr 1999, als die New Economy ihre Hochphase erreicht hatte, war ich 16 Jahre alt. Diese Zeit hat mich stark beeinflusst. Fast täglich notierte ich mir neue Geschäftsideen. Mit 25, direkt nach meinem Wirtschaftsstudium in Berlin, gründete ich mit Freunden mein erstes Start-up. Ich lernte, was es heißt, mit Rückschlägen umzugehen und welche Rolle Emotionen in der Innovation spielen. Ein paar Jahre später, als ich zurück an die Uni ging, um meinen Master in Innovationsmanagement abzuschließen, wurde ich CEO der Beratungsfirma BMI Lab. Es war ein Spin-off der Universität St. Gallen, an der ich studiert hatte. Ich half, aus dem Uni Lab eine Innovationsberatung zu machen, die ich anschließend sieben Jahre lang leitete. Dort führte ich mehr als 300 Innovations-Workshops mit den unterschiedlichsten Unternehmen aus verschiedensten Branchen durch. Ich lernte viele innovative Projekte und spannende Menschen, zum Teil aus der Geschäftsleitung großer europäischer Konzerne, kennen. Aber ich erkannte auch viele Probleme in der Corporate Innovation, die ich in diesem Buch behandeln werde. Es waren immer wieder die gleichen Dinge: Die meisten Menschen halten sich für kreativ, doch in Wahrheit bleiben sie gerne in ihrer Komfortzone und versuchen Probleme nur sehr oberflächlich zu verstehen.
Viele Menschen haben Angst vor Innovation, adressieren diese aber nicht, sondern schieben gern andere Gründe vor. Die meisten denken kurzfristig und geben oftmals viel zu früh auf. Und die Menschen, die Innovation vorantreiben wollen, sind oftmals Einzelkämpfer, die es nicht schaffen, andere zum Umdenken zu bewegen, geschweige denn mitzureißen.
In den sieben Jahren sah ich viele, wirklich innovative Projekte scheitern. Man könnte es sich einfach machen und sagen, dass sie an der Kultur gescheitert sind. Das stimmt auch zu einem gewissen Grad. Ich habe nur ein Problem mit dem Wort „Innovations-“ bzw. „Unternehmenskultur“. Es suggeriert, dass andere das Problem sind. Wenn ich der fehlenden Innovationskultur die Schuld gebe, dann bin ich selbst machtlos. Deswegen ist dies auch kein Buch über Innovationskultur, sondern über Menschen, Individuen, die Psychologie gezielt einsetzen, um sich und andere zu besseren Innovatoren zu machen. Es ist ein Buch, das dir konkret sagt, was du verbessern kannst, wenn das Umfeld nicht perfekt ist.
Während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 machte ich ein Think Year, das dann, wie auch die Pandemie, viel länger als ein Jahr ging. In dieser Auszeit begann ich, für dieses Buch zu recherchieren und mehr über die Psychologie in der Innovation zu verstehen. Ich lernte, wie man Erkenntnisse aus der Psychologie einsetzen kann, um mehr Innovation in etablierten Organisationen zu fördern. Doch statt direkt dieses Buch zu schreiben, entschied ich mich, mein neues Wissen mit mehreren Kunden zu testen. Über Monate coachte ich Innovationsteams in einem Weiterbildungsprogramm, das ich „Innovation Mindset Mastery“ nenne. Dadurch konnte ich die vielen Konzepte, die du in diesem Buch findest, ausprobieren und verbessern. Die Erkenntnisse daraus findest du auf den folgenden Seiten.
Psychologie einsetzen, um Innovation zu fördern
Dieses Buch beschäftigt sich mit der Rolle von Psychologie in der Innovation. Kognitive Verzerrungen, Emotionen und falsche Kommunikation führen dazu, dass Mitarbeitende in Organisationen kurzfristig denken und oftmals feige handeln. Du wirst lernen, wie du kognitive Verzerrungen für mehr Innovation nutzen, Emotionen verändern und deine Kommunikation verbessern kannst. Der Schlüssel dafür ist oftmals ein Perspektivenwechsel – ein Reframing.
Zunächst werde ich ausführlich erklären, was Reframing ist, denn im Laufe des Lesens wirst du dem Konzept immer wieder begegnen. An dieser Stelle möchte ich dir ein Beispiel geben.
Angenommen, du bist in einer schwierigen und ärgerlichen Situation. Irgendwas lief nicht so, wie du es dir vorgestellt hattest. In diesem Fall lohnt es sich, folgende Reframing-Frage zu stellen: Was ist das Großartige an dem Problem? Wenn du in einer schwierigen Situation steckst und dir dann diese Frage stellst, gerätst du erstmal ins Stocken. Denn die Frage passt so gar nicht zu dem, wie du dich gerade fühlst. Doch, wenn du dir wirklich die Zeit nimmst, dich mit dieser Frage zu beschäftigen, merkst du schnell, wie sich sofort neue Möglichkeiten auftun. Du hast die Perspektive verändert. Du hast etwas Negatives in etwas Positives umgeframt.
Kapitel 1 beschäftigt sich mit den Grundlagen, warum Menschen irrationale Entscheidungen in der Innovation treffen und weshalb Reframing überhaupt möglich ist. Aber das Buch ist nicht nur eine Röntgenbrille. Es ist auch ein Werkzeugkasten, eine sogenannte Toolbox. Es zeigt, welche Ansätze es aus der Psychologie gibt, um die wiederkehrenden Probleme in der Corporate Innovation zu lösen.
In den Kapiteln 2 bis 5 beschäftigen wir uns im Detail mit Kreativität, Courage, langfristigem Denken und dem Durchhaltewillen bzw. der langfristigen Motivation. Du lernst, wie du Tools einsetzen und Übungen durchführen kannst, um kreativer zu werden, mutiger zu handeln, langfristiger zu denken und Rückschläge in Treibstoff umzuwandeln.
In Kapitel 6 geht es um die Frage, wie man Innovation als neue Norm etablieren kann und andere von radikaler Innovation überzeugt. In Kapitel 7 findest du zudem eine Übersicht mit den wichtigsten Reframing-Tools, die du in deiner täglichen Praxis anwenden kannst.
Das Buch erklärt nicht, warum Innovation wichtig ist und immer wichtiger wird. Dazu gibt es viele andere Bücher. Es beschäftigt sich stattdessen mit der Frage, weshalb Innovation oftmals scheitert, selbst dann, wenn der Wille für Innovation eigentlich da zu sein scheint. Und es zeigt auf, wie man Psychologie einsetzen kann, um das zu ändern.
Für wen ist dieses Buch?
Wenn du mehr mutige Innovation in deine Organisation bringen willst, ist dieses Buch für dich genau richtig. Dabei spielt es keine Rolle, ob deine Firma aus Hunderttausend oder nur ein paar Mitarbeitenden besteht. Führungskräften will ich mit diesem Buch helfen, ihr Unternehmen zu transformieren und die Kultur zu verändern. Denn ganz ohne Führung geht es nicht. Mitarbeitenden aus dem Innovationsmanagement eines Konzerns zeigt dieses Buch, wie sie ihren Einfluss erweitern und erfolgreicher in ihrem Job werden. Intrapreneure, die versuchen, ein innovatives Projekt (oder Venture) gegen alle Widerstände in der Organisation umzusetzen, hilft es, widerstandsfähiger zu werden und die Motivation nicht zu verlieren.
Noch ein paar Worte zum Gendern. Ich habe dieses Buch für jeden Menschen geschrieben, der mehr Innovation in seine Organisation bringen möchte und schließe niemanden aus. Da es derzeit leider keine allgemeingültigen Regeln zum Gendern in der deutschen Sprache gibt, habe ich versucht, mein eigenes System zu entwickeln. Es basiert auf drei einfachen Regeln:
Wenn möglich, verwende ich genderneutrale Begriffe (z. B. Mitarbeitende statt Mitarbeiter).
2.Im Plural verwende ich in Ausnahmen das generische Maskulin, wenn es keine etablierten genderneutralen Begriffe gibt (z. B. Innovatoren statt Innovatorinnen).
3.Um das auszugleichen, verwende ich im Singular generisch die weibliche Form (z. B. Kandidatin statt Kandidat), sofern es sich nicht um eine konkrete Person handelt.
Meiner Meinung nach stört das den Lesefluss kaum. Ich hoffe, dass dieses System auch für dich funktioniert und du dich auf keinen Fall ausgeschlossen fühlst. Und wie du wahrscheinlich bereits festgestellt hast, duze ich meine Leserinnen und Leser. Ich finde das irgendwie sympathischer – IKEA und Apple machen es schließlich auch. Hah!
Für alle, die tiefer in die Materie einsteigen und interaktiv die Tools anwenden wollen, habe ich einen Online-Kurs entwickelt: www.psychology-innovation.com
Für Organisationen, die ihre Kultur verändern und viele Mitarbeitende gleichzeitig mit den Themen dieses Buches in Kontakt bringen möchten, habe ich Workshops und ein größeres Transformationsprogramm entwickelt. Mehr dazu findest du auf meiner Website: www.felixhofmann.com
Zu vielen meiner Themen (Kreativität, Mut, langfristiges Denken, Motivation, Beeinflussung etc.) findest du auch spannende Videos auf meinem YouTube-Kanal – schau gern mal vorbei: @felixhofmann
Felix Hofmann
1. Verzerrte Wahrnehmung
Verzerrte Wahrnehmung
Unbewusste Entscheidungen
Die Wechselstrategie
Wir sehen die Welt durch Frames
Verzerrte Wahrnehmung
Was glaubst du: Was ist der größte Fehler, den die meisten Firmen in der Innovation machen? Vielleicht Geschäftsideen mit Lego zu demonstrieren und nach dem Wochenende nicht mehr zu wissen, wofür eigentlich der grüne Plastikkaktus stand? Oder Post-its so zu kleben, dass sie nicht am Whiteboard hängenbleiben und tags drauf allesamt auf dem Boden liegen? Beides ärgerlich, aber darauf wollte ich nicht hinaus. Zu wenig Kontakt zu den Kunden oder zu starker Fokus auf Technologie? Schon dichter dran.
Die Antwort: Einer der größten Fehler ist es, Innovation als einen rein rationalen Prozess zu behandeln. Aber Menschen sind nicht rational und Entscheidungen werden überwiegend unbewusst getroffen. Damit sind auch Innovationsprozesse eine höchst irrationale Angelegenheit. Das Wissen über diese Irrationalität hilft dir, sie für dich nutzbar zu machen. Denn, wenn du die Irrationalität verstehst, kannst du damit dein Unternehmen innovativer machen.
Unbewusste Entscheidungen
Tatsächlich sind die meisten unserer Entscheidungen von kog nitiven Verzerrungen beeinflusst. Wenn du dich mit dem Einfluss kognitiver Verzerrungen und Emotionen auf Entscheidungen auseinandersetzt, kannst du daraus einige Vorteile für dich ziehen:
Deine eigenen Entscheidungen werden sich verbessern.
2.Mit dem Wissen über Psychologie kannst du das irrationale Handeln anderer besser verstehen.
Denn Irrationalität ist nicht unvorhersehbar. Je mehr du dich mit Kognition und Emotionen beschäftigst, desto nachvoll ziehbarer werden für dich Entscheidungen, die du bisher mit Kopfschütteln quittiert hast. Aber dabei bleibt es nicht. In den späteren Kapiteln dieses Buches werden wir nicht nur unsere Wahrnehmung schulen, sondern auch Werkzeuge kennenlernen, die es dir ermöglichen, Irrationalität aktiv zu nutzen und Entscheidungen zu beeinflussen.
Die meisten Menschen halten sich für rational
Viele Menschen glauben nicht, dass ihr Handeln von kognitiven Verzerrungen beeinflusst wird. Sie leiden an einer sehr hartnäckigen Illusion: Sie halten es für möglich, dass alle anderen Menschen irrational sind – nur nicht sie selbst. Und ich nehme mich da nicht aus. Der Organisationspsychologe Adam Grant nennt das den „I’m-Not-Biased-Bias“.1 Dieser Bias beschreibt das Gefühl, weniger von kognitiven Verzerrungen betroffen zu sein als der Durchschnitt der Bevölkerung. Kommt dir das bekannt vor? Vielleicht hast du schon mal gelesen, dass 80% aller Autofahrer sich für überdurchschnittlich gute Autofahrer halten.2 Na klar, Meister! Die meisten Menschen halten sich selbst auch für intrinsisch motivierter als die anderen. Und sogar Menschen, die hinter Gittern sitzen, halten sich für bessere und – Achtung (!) – liebevollere Menschen als der Durchschnitt der Bevölkerung.3 All das sind Beispiele für den „Better-Than-Average-Effect“ (BTAE). Und so ähnlich ist das auch mit der Rationalität: Alle anderen sind irrational, nur du siehst die Dinge, wie sie sind.
Wir nehmen nur einen Bruchteil der Realität war
Es hilft, eine gewisse Bescheidenheit bezüglich der eigenen Rationalität zu entwickeln, wenn man sich bewusst macht, dass wir nicht einmal in der Lage sind, die Realität als solche zu er fassen.
Die Forscherin Lisa Feldman Barrett schreibt in ihrem Buch How Emotions Are Made, dass wir uns bewusst machen sollten, dass unser Gehirn keinen direkten Zugang zur Realität hat. Es befindet sich in einer „dunklen, stillen Kiste“, die wir auf unseren Schultern tragen. Daher bleibt unserem Bewusstsein nichts anderes übrig, als unsere eigene Realität zu kreieren.4 Alles, was wir wahrnehmen, ist eine Halluzination unseres Gehirns. Diese speist sich aus den limitierten Wahrnehmungen unserer Sinnesorgane.
Unsere Augen gehören zu unseren wichtigsten Sinnesorganen. Da wir allerdings 15- bis 20-mal pro Minute blinzeln, können wir nur 90 % aller Bildinformationen verarbeiten.5 Das wäre ein Argument dafür, warum nicht jeder Schiedsrichter, der eine fragwürdige Entscheidung trifft, bestochen sein muss. Aber das ist noch nicht alles. Unsere Augen können nur einen winzigen Teil, schätzungsweise 0,0035 % des gesamten Lichtspektrums, sehen.6 Oder anders ausgedrückt: Wäre die visuelle Welt da draußen ein Buch mit 200 Seiten, sähen wir davon gerade mal ein einziges Wort.
Unsere Wahrnehmung fokussiert Veränderung
Von den schätzungsweise 11 Millionen Bits an Informationen, die wir pro Sekunde durch unsere Sinnesorgane aufnehmen, können wir nur ca. 40 Bits bewusst verarbeiten – das sind ca. 0,0004 %.7 Wenn du nicht glaubst, wie lückenhaft deine Wahrnehmung ist, empfehle ich dir, nach „3 yellow dots optical illusion“ zu googeln und dir eines der Videos auf YouTube anzusehen.
Hier siehst du drei stark leuchtend gelbe Punkte vor einem sich drehenden Hintergrund aus blauen Strichen. Wenn du dich einige Sekunden auf die Mitte des Bildes konzentrierst, scheinen die drei gelben unbeweglichen Punkte plötzlich zu verschwinden. Natürlich sind sie die ganze Zeit da, aber unser Gehirn interpretiert sie als Fehlinformation. Also löscht es die Bildinformationen aus unserem Bewusstsein – unwichtig, also weg damit.
Solche optischen Täuschungen veranschaulichen, wie limitiert und verzerrt unsere Wahrnehmung der Realität ist. Das ist in der Regel eine Stärke, da wir uns dadurch auf das „Wichtige“ konzentrieren können. Generell fällt es uns Menschen leichter, Veränderungen wahrzunehmen, als alles, was stillsteht. Es ist dir bestimmt schon aufgefallen, dass es leichter ist, eine braune Maus im Wald zu sehen als einen braunen Steinpilz zu finden – allerdings nur, wenn sich die Maus bewegt. Und falls sich der Pilz bewegt, hast du wohl schon die falschen Pilze gegessen.
Fakt ist: Alles, was sich bewegt oder verändert, lenkt unsere Aufmerksamkeit auf sich. Eine Veränderung kann immer eine Chance oder eine Gefahr sein. Auf jeden Fall ist sie erst einmal wichtig und sagt uns: „Achtung, da passiert etwas – schau hin!“
Du hast zwei Arten, zu denken
Vielleicht hast du schon mal beobachtet, dass deine Denk prozesse sehr unterschiedlich ablaufen können. Wenn du beispielsweise, wie jeden Tag, mit dem Auto zur Arbeit fährst, machst du das intuitiv und mühelos, ebenso wenn du einen einfachen Text liest oder 3 × 3 ausrechnest. Wenn du jedoch zum ersten Mal am Steuer sitzt, einen komplizierten Fachtext liest oder 17 × 24 ausrechnen musst, ist dein Denkprozess mühevoll und langsam.
Der bekannte Psychologieprofessor und Nobelpreisträger Daniel Kahnemann nennt diese unterschiedlichen Arten zu denken, System 1 und System 2.8 Ersteres beschreibt die schnelle Art, zu denken, Zweiteres die mühevolle Art, zu denken. Da dein Gehirn faul ist und mühevolle Arbeit genauso sehr mag wie deine Beine es mögen, Wochenendeinkäufe in die 5. Etage zu schleppen, versucht es so viel wie möglich, mit System 1, deinem Fahrstuhl, zu erledigen. Wenn du jedoch mit System 1 denkst, bist du stark von kognitiven Verzerrungen und Emotionen beeinflusst. System 2 lenkt deine Aufmerksamkeit auf die komplizierten mentalen Aktivitäten. Dazu gehören beispielsweise auch komplexe Rechenaufgaben. Wenn du mit System 2 denkst, hast du ein Gefühl von Kontrolle und Konzentration. System 1 ist unser Standardsystem. Wir verwenden es, bis es entweder überfordert ist oder wir uns aktiv für System 2 entscheiden, weil wir uns bewusst konzentrieren.
Dein Handeln wird stark beeinflusst
Dein Umfeld beeinflusst, wie du dich in bestimmten Situationen verhältst. Die subtile Art von Beeinflussung, die uns tag täglich betrifft, wird als Priming-Effekt bezeichnet. Menschen stimmen beispielsweise eher für eine Erhöhung des Bildungsetats, wenn sich die Wahlkabine in einem Schulgebäude befindet.9 Menschen, die zuvor mit Geld geprimt wurden, zum Beispiel, wenn bei einem Experiment ein Bündel Monopoly-Geld auf dem Tisch liegt, werden egoistischer und sind weniger hilfsbereit:10 Wenn die Versuchsleiterin eines solchen Experiments später scheinbar unabsichtlich einen Becher mit Stiften fallen ließ, halfen die Probanden, die zuvor mit Geld geprimt wurden, weniger engagiert mit, die Stifte vom Boden aufzuheben. Die unbewusste Beeinflussung wirkt sich anscheinend auf das Selbstbild und das hilfsbereite Handeln (weniger Stifte aufheben) der Menschen aus.
Der Anchoring-Effekt beeinflusst dein Denken
Ich habe dieses kleine harmlose Spiel schon manchmal mit fremden Leuten in Cafés gespielt. Dabei fragst du eine Person, ob sie denkt, dass Mahatma Gandhi älter oder jünger war als 114 Jahre zum Zeitpunkt seines Todes. Und danach frägst du die Person ganz konkret: „Wie alt war Mahatma Gandhi zum Zeitpunkt seines Todes?“ Als Nächstes fragst du eine andere Person, ob Gandhi zum Zeitpunkt seines Todes älter oder jünger als 35 Jahre war. Danach fragst du wieder: „Wie alt war Mahatma Gandhi zum Zeitpunkt seines Todes?“ Die Ergebnisse sind interessant. Höchstwahrscheinlich wird dir die erste Person ein höheres Alter nennen als die zweite Person. Das ist Anchoring in Aktion: Wenn wir etwas gedanklich schätzen oder bewerten, machen wir das ausgehend von einem Anker.11 Und natürlich erleben wir Anchoring jeden Tag im Supermarkt oder bei eigentlich allem, was einen Kaufpreis hat. Jeder Preis ist ein Anker.
Priming und Anchoring spielen auch für die Kreativität eine wichtige Rolle, wie du in Kapitel 2 sehen wirst. Es sind Tools, die nicht nur Gandhi älter oder jünger machen, sondern auch unsere Ideen nützlicher oder radikaler machen können.
Du triffst Entscheidungen, bevor sie dir bewusst werden
Alle Theorie spricht gegen den freien Willen, alle Erfahrung dafür. SAMUEL JOHNSON, ENGLISCHER LITERAT
Selbst das, was wir als freien Willen bezeichnen, scheint anders zu funktionieren, als die meisten glauben. Der Psychologieprofessor Daniel Wegner von der Harvard University kam aufgrund seiner Forschung zu der Schlussfolgerung, dass das Gefühl, einen bewussten Willen zu haben, eine Illusion unseres Gehirns sei. Ähnlich wie bei einem Zaubertrick, spielen sich bei Entscheidungen im Hintergrund ganz andere komplexere Vorgänge ab, die uns verborgen bleiben. Unser Gehirn hat die Entscheidung bereits getroffen, bevor wir sie bewusst wahrnehmen und scheinbar erst dann fällen.
Du hast wahrscheinlich die Selbstwahrnehmung, dass du dich steuerst, wie du beispielsweise Super Mario im gleichnamigen Videospiel lenkst. Du drückst auf dem Controller die Taste „B“ und zack – Super Mario springt nach oben. Ähnlich stellen wir uns die Kausalität unserer Handlungen vor. Stattdessen ist ein Gedanke, etwas zu tun, vergleichbar mit einem Blinker an einem Auto, schreibt Wegner.12 Der Blinker kommt zuerst, bevor das Auto um die Kurve fährt. Aber wer würde deswegen behaupten, dass der Blinker das Auto steuert? Der Blinker hat mit der Steuerung des Autos nichts zu tun.
Die Illusion des freien Willens entsteht dadurch, dass wir vorher wissen, was wir tun werden. Der Bewusstseinsforscher John-Dylan Haynes konnte durch den Einsatz funktioneller Magnetresonanztomografie (fMRI) beweisen, dass es bis zu 10 Sekunden dauern kann, bis wir uns einer Entscheidung, die wir bereits getroffen haben, bewusst werden.13 Heißt das, dass irgendetwas in deinem Unbewusstsein die Entscheidung trifft und du ab dann nur noch Zuschauer bist? Das nicht. Haynes konnte ebenfalls beweisen, dass es einen kurzen Moment gibt, bis zu dem wir Entscheidungen noch umstürzen können.14 Er nennt diesen Zeitpunkt den „Point of no Return“, nach dem kein Veto mehr möglich ist. Dieser kurze Moment des Bewusstseins ermöglicht es dir, einzugreifen. Du weißt, dass Super Mario springen wird – aber du hast eine kurze Chance, den Sprung aufzuhalten oder umzulenken.
Menschen erhalten sich erfolgreich die Illusion, die Realität als solche wahrzunehmen und rational zu entscheiden. Du solltest dir jedoch bewusst machen, dass du die Realität niemals direkt erleben kannst. Das, was du als Realität empfindest, ist ein winziger Ausschnitt dessen, und dieser wird stark beeinflusst von einer Vielzahl unbewusster Effekte. Dies führt dazu, dass wir immer wieder Entscheidungen treffen, die nicht rational und daher oftmals nicht zu unserem Vorteil sind.
www.theatlantic.com/health/archive/2018/03/you-dont-know-yourself-as-well-as-you-think-you-do/554612/
2Svenson, O. (1981): Are we all less risky and more skillful than our fellow drivers? Acta psychologica, 47(2), 143–148.
3Sedikides, C./Meek, R./Alicke, M. D./Taylor, S. (2014): Behind bars but above the bar: Prisoners consider themselves more prosocial than nonprisoners. British Journal of Social Psychology, 53(2), 396–403.
4Barrett, L. F. (2018): How emotions are made. Pan Books.
5www.smithsonianmag.com/science-nature/why-do-we-blink-so-frequently-172334883
6www.energy.gov/nnsa/articles/visible-light-eye-opening-research-nnsa
7Wilson, T. D. (2002): Strangers to ourselves: Discovering the adaptive unconscious. Belknap Press/Harvard University Press.
8Kahneman, D. (2011): Thinking, fast and slow. macmillan.
9Berger, J./Meredith, M./Wheeler, S. C. (2008): Contextual priming: Where people vote affects how they vote. Proceedings of the National Academy of Sciences, 105(26), 8846–8849.
10Vohs, K. D./Mead, N. L./Goode, M. R. (2006): The psychological consequences of money. science, 314(5802), 1154–1156.
11Kahneman, D. (2011): a. a. O.
12Wegner, D. M. (2004): Précis of the illusion of conscious will. Behavioral and Brain Sciences, 27(5), 649–659.
13Soon, C. S./Brass, M./Heinze, H. J./Haynes, J. D. (2008): Unconscious determinants of free decisions in the human brain. Nature neuroscience, 11(5), 543–545.
14Schultze-Kraft, M./Birman, D./Rusconi, M./Allefeld, C./Görgen, K./Dähne, S./Blankertz, B./Haynes, J.-D. (2016): The point of no return in vetoing self-initiated movements. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 113(4), 1080–1085.
Die Wechselstrategie
Menschen wollen Sicherheit
Stellst du jemanden vor die Wahl zwischen einer 90 %igen Chance, 1.000 Euro zu bekommen, oder einer 100 %igen Chance, 900 Euro zu bekommen, werden sich die meisten Menschen für die 900 Euro entscheiden. Es liegt in der Natur der Menschen, Risiken – wenn immer möglich – komplett auszuschalten. Das ist der „Certainty Effect“.15 Die Tatsache, dass Menschen Risiken nicht mögen, führt dazu, dass manche Risiken kleinreden und andere Risiken, wenn immer möglich, aus dem Weg gehen wollen. Beides ist ein Problem für Innovation.
Kaum jemand wechselt
Angenommen, du machst bei einer Spielshow im Fernsehen mit. Manch einer kann sich vielleicht noch an die Spielshow Geh aufs Ganze mit Jörg Draeger erinnern. Sie folgte einem einfachen Prinzip: Es gibt drei Tore. Hinter zwei Toren befinden sich Nieten – die sogenannten Zonks –, hinter dem dritten Tor wartet der Hauptgewinn, zum Beispiel ein (nigelnagelneues) Auto oder eine Traumreise.
Die Kandidatin muss nun wählen und sich für ein Tor entscheiden. Sie hofft natürlich auf den Hauptpreis, weiß aber selbstverständlich nicht, was sich hinter welchem Tor verbirgt. Dann öffnet der Moderator das erste nicht gewählte Tor … Glück gehabt: einer der beiden Zonks (Zuerst öffnet er immer ein Tor mit einem Zonk, damit das Spiel spannend bleibt.). Somit bleiben nur noch der zweite Zonk und der Hauptgewinn übrig. Die Kandidatin hat nun nochmal die Chance, ihre Entscheidung zu überdenken und das Tor zu wechseln. Würdest du wechseln? Oder würdest du bei deiner ersten Wahl bleiben? Auch in der Verhaltenswissenschaft wurde dieses Dilemma immer wieder untersucht und diskutiert. Interessant ist, dass in dieser Situation kaum jemand wechseln möchte.16