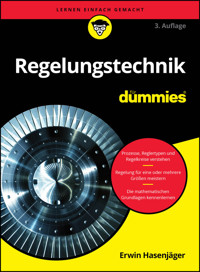
24,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Wiley-VCH
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Für Dummies
- Sprache: Deutsch
Auch Maschinen haben ihre Regeln
Auch wenn der Name sehr geordnet klingt, ist Regelungstechnik bisweilen komplex. Damit Sie dennoch damit zurechtkommen, erklärt Erwin Hasenjäger Schritt für Schritt und mit zahlreichen Beispielen, was Sie über dieses Thema unbedingt wissen sollten. Sie erfahren, welche Reglertypen es gibt, weshalb Simulationen so wichtig sind, was es mit Schwingungen sowie Dynamik auf sich hat und vieles mehr. Natürlich kommen dabei auch die mathematischen Grundlagen und die passende Software nicht zu kurz. So ist Regelungstechnik für Dummies der perfekte Einstieg in dieses anspruchsvolle Thema.
Sie erfahren
- Wie Sie digitale und andere Besonderheiten berücksichtigen
- Wie Sie die richtigen Reglereinstellungen wählen
- Was SISO und MIMO bedeuten
- Wie Sie Prozesse geschickt optimieren können
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Regelungstechnik für Dummies
Schummelseite
DER REGELKREIS
Elemente im Regelkreis
Regler und Regelstrecke
Signale im Regelkreis
w(t) Sollwert
y(t) Regelgröße (Istwert)
e(t) Regeldifferenz
u(t) Stellgröße
z(t) Störgröße
DIE TESTSIGNALE
Sprung
Rampe
Sinus
DIE BESCHREIBUNG VON DYNAMIK
Differenzialgleichung
Übertragungsfunktion
Frequenzgang
DIE SCHALTUNGEN
Reihenschaltung
Parallelschaltung
Kreisschaltung
Regelkreis
DIE MODELLE FÜR REGELSTRECKEN
P
P-T1
P-T2
P-S2
I
oder
I-T1
oder
DIE MODELLE FÜR REGLER
P
PI
PD
PID
PID-T1
DIE STABILITÄT
stabil
grenzstabil
instabil
Lage eines Eigenwerts …
… und das Eigenverhalten
Lage zweier Eigenwerte …
… und das Eigenverhalten
DER ABLAUF BEIM REGLERENTWURF
Die Stellgröße für den Aktor am Prozesseingang und den Sensor für die Regelgröße am Prozessausgang festlegenDen dynamischen Zusammenhang zwischen Stellgröße und Regelgröße theoretisch und/oder experimentell modellierenDie gewünschte Dynamik des geschlossenen Regelkreises vorgebenDaraus die Struktur und die Einstellung des Reglers ermittelnDie Funktion der Regelung durch Simulation testenRegler an die Regelstrecke koppelnRegelung an der Anlage vorsichtig testen
Regelungstechnik für Dummies
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
3. Auflage 2025
© 2025 Wiley-VCH GmbH, Boschstraße 12, 69469 Weinheim, Germany
Wiley, the Wiley logo, Für Dummies, the Dummies Man logo, and related trademarks and trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley & Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries. Used by permission.
Wiley, die Bezeichnung »Für Dummies«, das Dummies-Mann-Logo und darauf bezogene Gestaltungen sind Marken oder eingetragene Marken von John Wiley & Sons, Inc., USA, Deutschland und in anderen Ländern.
Das vorliegende Werk wurde sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor und Verlag für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie eventuelle Druckfehler keine Haftung.
Coverfoto: © Jörg Vollmer - stock.adobe.comKorrektur: Jürgen Erdmann und Petra Heubach-Erdmann
Print ISBN: 978-3-527-72259-4ePub ISBN: 978-3-527-85015-0
Über den Autor
Dr. Erwin Hasenjäger studierte Maschinenbau und Technische Kybernetik an der Universität Stuttgart. Schon im Studium hat es ihm besonders die Regelungstechnik angetan. Nach dem Studium sammelte er bei der Firma Krupp in Essen industrielle Erfahrungen mit Projekten der Automatisierung, um anschließend, natürlich mit einem regelungstechnischen Thema, an der Universität Siegen zu promovieren.
Daran schloss sich eine Professur an der Fachhochschule Bingen an. Im Fachbereich Technik, Informatik und Wirtschaft leitete er viele Jahre den Studiengang Maschinenbau und bot eine Vielzahl von Fächern mit Vorlesungen und Arbeiten in den Laboratorien an. Neben der Tätigkeit an der Hochschule war Erwin Hasenjäger für die Industrie und in Berufsverbänden tätig.
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Über dieses Buch
Konventionen in diesem Buch
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
Wie es weitergeht
Teil I: Der Einstieg in ein spannendes Fach
Kapitel 1: Das Ganze im Überblick
Königsdisziplin der Automatisierung
Regelungen in Technik und Natur
Die Aufgaben von Regelungen
Viele Partner in einem Kreis
Prozess und Regelung im Wechselspiel
Kapitel 2: Ein Beispiel zum Einstieg
Am Anfang steht der Auftrag
Den Prozess gut kennenlernen
Den Regelkreis schließen
Alles eine Frage der Einstellung
Ein paar Dinge sind schon klar geworden
Kapitel 3: Das Grundwissen für die Regelungstechnik
Der komplette Regelkreis
Testsignale für den Regelkreis
Das Verhalten der Regelstrecke
Reglertypen
Teil II: Theorie kann praktisch sein
Kapitel 4: Schnell fertig mit Mathe
Differenziale machen dynamisch
Steckbriefe der Dynamik
Algebra ist einfacher
Kapitel 5: Die Algebra der Regelungstechnik
Die Übertragungsfunktion im Fokus
Einfacher Zusammenbau
Der Regelkreis im Bildbereich
Hilfreiches Programm
Der Werkzeugkasten für die Regelungstechnik
Blöcke zusammenschalten
Kapitel 6: Alles schwingt
Schwingung rein, Schwingung raus
Ein Beispiel aus der Mechanik
Der Frequenzgang grafisch
Mit Asymptoten arbeiten
Kapitel 7: Zustände kompakt
Zustände, Vektoren und Matrizen
Die ABCD-Form
Drei Tanks
Lösung der Zustandsgleichung
Kapitel 8: Mehr zu den Zuständen
Eigenheiten, Eigenwerte, Eigenverhalten
Veränderliches und Konstantes
Normale Formen
Steuerbares und Beobachtbares
Teil III: Der Regelkreis hat Ecken
Kapitel 9: Das Regeln in einer Schleife
Struktur und Aufgaben
Stabilität: Ein Polynom mit Charakter
Hurwitz gibt Auskunft
Nyquist kann schon mehr
Stabilität numerisch prüfen
Regeldifferenzen vermeiden
Dynamik vorgeben
Kapitel 10: Die richtige Reglereinstellung
PID – der Klassiker
Ein Regler, der alles kompensiert
Vorgabe von Eigenwerten
Entwürfe im Bode-Diagramm
Praktische Regeln
Kapitel 11: Erweiterte Regelkreise
Regelkreise in einer Kaskade
Antriebsregelung mit Kaskadenstruktur
Weitere Strukturen
Zwei Größen gleichzeitig regeln
Kapitel 12: Regeln mit Rechnern
Regler werden zu Programmen
Der Rechner kennt keine Differenziale
Diskrete Regler
Diskrete Übertragungsfunktionen
Kapitel 13: Digitale Regelgeräte
Regelungstechnische Datenverarbeitung
Kompaktregler
Was noch gebraucht wird
Teil IV: Alles gleichzeitig regeln
Kapitel 14: Die Regelung von Zuständen
Rückführung des Systemzustands
Eigenwertvorgaben leicht gemacht
Sollzustände erreichen
Der Zwei-Massen-Schwinger
Kapitel 15: Zustandsbeobachter ersetzen Messungen
Mit Modellen schätzen
Berechnung von Beobachtern
Beobachter an einer Rührkesselkaskade
Regeln mit Beobachtern
Beobachter und Regler an einem Antrieb
Kapitel 16: Integrales und Digitales
Zustandsregler mit I-Anteil
Diskretes für den Rechner
Teil V: Optimales, Menschliches und Hilfreiches
Kapitel 17: Optimal – besser geht es nicht
Das Prinzip der Optimierung
Optimierung von Reglern
Optimale Zustandsregler
Kapitel 18: Fuzzy-Regler mit menschlichen Zügen
Scharfes und Unscharfes
Mit Fuzzy-Mengen regeln
Ein Vergleich
Kapitel 19: Hilfreiche Software für die Regelungstechnik
MATLAB und seine Toolboxes
Scilab – der umfangreiche Werkzeugkasten
Mit WinFACT alle Register ziehen
Virtuelle Instrumente mit LabVIEW bauen
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Kapitel 20: Zehn Toptipps zur Regelungstechnik
Merkregeln
Tipps für Studenten
Hinweise für den Praktiker
Damit wir uns nicht missverstehen
Schöne Gesellschaften
Brauchbares Internet
Feine Videos
Let's talk in English
Zum Blättern
Zum Vertiefen
Abbildungverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Tabellenverzeichnis
Kapitel 1
Tabelle 1.1: Regelungsbeispiele aus Technik und Biologie
Kapitel 2
Tabelle 2.1: Translation und Rotation
Kapitel 3
Tabelle 3.1: Signale im Regelkreis
Tabelle 3.2: Beispiele für Tests an Regelstrecken
Kapitel 4
Tabelle 4.1: Systeme mit P-T1-Verhalten
Tabelle 4.2: Berechnung von Eigenwerten
Tabelle 4.3: Auszug aus der Tabelle der Laplace-Korrespondenzen
Kapitel 5
Tabelle 5.1: Wichtige Übertragungsfunktionen für Regelstrecken und Regler
Kapitel 6
Tabelle 6.1: Wichtige Frequenzgänge für Regelstrecken und Regler
Tabelle 6.2: Amplitudenverhältnisse in Dezibel
Tabelle 6.3: Asymptotische Amplitudengänge der wichtigsten Regelstrecken
Tabelle 6.4: Asymptotische Amplitudengänge der wichtigsten Regler
Tabelle 6.5: Zusammenhänge zwischen asymptotischen Amplituden- und Phasengängen
Kapitel 9
Tabelle 9.1: Stationäre Regeldifferenzen
Kapitel 10
Tabelle 10.1: Beim Kompensationsregler müssen Sie nur Ihre Wünsche äußern
Tabelle 10.2: Reglereinstellungen resultieren aus der T-Summen-Regel
Tabelle 10.3: Einstellregeln nach Chien, Hrones und Reswick
Tabelle 10.4: Reglerentwurf nach Ziegler-Nichols am Stabilitätsrand
Kapitel 12
Tabelle 12.1: Aus Kurven werden Zahlenfolgen.
Kapitel 13
Tabelle 13.1: Unterschiedliche Einsätze und Ausführungen von Reglern
Tabelle 13.2: Stützstellen auf der nichtlinearen Kennlinie
Tabelle 13.3: Stützstellen für den Kompaktregler
Kapitel 14
Tabelle 14.1: Interpretation von Eigenwerten bei Ein-Massen-Systemen
Kapitel 15
Tabelle 15.1: Eine Funktion für die Berechnung von Regler und Beobachter
Kapitel 16
Tabelle 16.1: Der Zustandsregler zeitkontinuierlich und zeitdiskret
Tabelle 16.2: Die Reglerparameter bei unterschiedlichen Abtastzeiten
Kapitel 18
Tabelle 18.1: Zugehörigkeitsgrade von drei Messwerten
Tabelle 18.2: Die Regelbasis beschreibt die Maßnahmen in Abhängigkeit der Eingä...
Tabelle 18.3: Messwerte machen Regeln aktiv und passiv.
Illustrationsverzeichnis
Kapitel 1
Abbildung 1.1: Zur Automatisierung gehören mehrere Abteilungen
Abbildung 1.2: Messen, Steuern und Regeln sind die Kernfächer der...
Abbildung 1.3: Auch bei hoher Automatisierung – ohne den Menschen...
Abbildung 1.4: Regelkreise haben sich in vielen Bereichen bewährt
Abbildung 1.5: Prozessverläufe können unterschiedliche Dynamik be...
Abbildung 1.6: Die Regelstrecke besteht aus Aktorik, Prozess und ...
Abbildung 1.7: Bei einem falsch eingestellten Regler wird der Reg...
Abbildung 1.8: Regelungen ohne bleibende Abweichungen sind erwüns...
Abbildung 1.9: Schnelles Erreichen der Sollhöhe ist erwünscht
Abbildung 1.10: Regelungen werden auch mit Störungen fertig
Abbildung 1.11: Im Regelkreis arbeiten viele Partner zusammen
Abbildung 1.12: Die Regelung stellt die gewünschte Füllhöhe in e...
Abbildung 1.13: Stoffe, Energien und Informationen werden verarb...
Kapitel 2
Abbildung 2.1: Drehbewegungen sind in der Technik sehr wichtig
Abbildung 2.2: An dieser Regelstrecke sind nun Messungen möglich
Abbildung 2.3: So sieht die Regelstrecke als Blockdiagramm aus
Abbildung 2.4: Der Hochlaufversuch zeigt das dynamische Verhalten...
Abbildung 2.5: So sieht nun der Drehzahlregelkreis aus
Abbildung 2.6: In diesem Block steckt alles drin
Abbildung 2.7: Das Verhalten der Drehzahlregelung hängt von der R...
Abbildung 2.8: Der integrale Anteil im Regler beseitigt die Regel...
Kapitel 3
Abbildung 3.1: Das Signalflussbild eines Regelkreises
Abbildung 3.2: Der Signalfluss enthält Summationen und Verzweigun...
Abbildung 3.3: Der Einheitssprung kann verändert werden
Abbildung 3.4: Mit Sprungfunktionen können Sie auch Impulse besch...
Abbildung 3.5: Rampensignale steigen linear an
Abbildung 3.6: Die Sinusschwingung ist ein wichtiges Testsignal d...
Abbildung 3.7: Vor dem Reglerentwurf kommt die Untersuchung der R...
Abbildung 3.8: Die gemessene Sprungantwort führt zum Modell der R...
Abbildung 3.9: Das P-System springt ohne Verzögerung auf den Endw...
Abbildung 3.10: Das P-T0-System reagiert erst nach einer Laufzei...
Abbildung 3.11: Das P-T1-System steigt verzögert auf den Endwert...
Abbildung 3.12: Das P-T2-System steigt stärker verzögert an als ...
Abbildung 3.13: Das P-S2-System schwingt gedämpft auf den Endwer...
Abbildung 3.14: Das I-System läuft mit konstanter Steigung hoch
Abbildung 3.15: Das I-T1-System läuft verzögert auf die konstant...
Abbildung 3.16: Die linearisierte Kennlinie ist die Tangente im ...
Abbildung 3.17: Der Lauf einer Kugel macht Stabilität anschaulic...
Abbildung 3.18: Regler sind in der Lage, instabile Regelstrecken...
Abbildung 3.19: Nach der Untersuchung der Regelstrecke folgt der...
Abbildung 3.20: Die drei Anteile des PID-Reglers arbeiten parall...
Abbildung 3.21: Jeder der drei Regleranteile hat seine Wirkung
Abbildung 3.22: Der Integrator hat ein Gedächtnis
Abbildung 3.23: Der Zwei-Punkt-Regler gibt nur zwei konstante We...
Abbildung 3.24: Mit einem Zwei-Punkt-Regler schwingt die Regelgr...
Abbildung 3.25: Der Zwei-Punkt-Regler mit Hysterese hat zwei Sch...
Abbildung 3.26: Drei-Punkt-Regler gibt es ohne Hysterese (links)...
Abbildung 3.27: Für das Regelkreisverhalten gibt es Spezifikatio...
Kapitel 4
Abbildung 4.1: Die Antriebskraft erzeugt die Geschwindigkeit
Abbildung 4.2: Die Wärmezufuhr erzeugt die Temperatur im Ofen
Abbildung 4.3: Die Konzentration im Zulauf erzeugt die Konzentrat...
Abbildung 4.4: Die Spannung am Eingang erzeugt die Spannung am Au...
Abbildung 4.5: Hier steckt alles drin
Abbildung 4.6: Die Eigenwerte bestimmen die Stabilität
Abbildung 4.7: Komplexe Zahlen haben zwei Komponenten
Abbildung 4.8: Das P-T1-System hat einen Eigenwert auf der negati...
Abbildung 4.9: Das P-T2-System hat einen weicheren Übergang
Abbildung 4.10: Das P-S2-System hat konjugiert komplexe Eigenwer...
Abbildung 4.11: Die Lage der Eigenwerte zeigt die Schwingeigensc...
Abbildung 4.12: Das Lösen von Differenzialgleichungen wird einfa...
Abbildung 4.13: Die Übertragungsfunktion beschreibt Dynamik im B...
Kapitel 5
Abbildung 5.1: Der Pol-Nullstellen-Plan zeigt die Lage
Abbildung 5.2: Systeme in Reihe werden multipliziert
Abbildung 5.3: Die Flüssigkeit durchläuft zwei in Reihe angeordne...
Abbildung 5.4: Parallele Systeme werden addiert
Abbildung 5.5: Bei Kreisschaltungen sind die Vorzeichen wichtig
Abbildung 5.6: Der Regelkreis hat eine negative Rückführung
Abbildung 5.7: Die Funktion »step« erzeugt Sprungantworten
Abbildung 5.8: Simulink bearbeitet grafisch definierte Strukturen
Kapitel 6
Abbildung 6.1: Der Frequenzgang zeigt, wie sinusförmige Signale ü...
Abbildung 6.2: Eine Kolbenpumpe wird elektrisch angetrieben
Abbildung 6.3: Der Betrag des Frequenzgangs zeigt, wo die Resonan...
Abbildung 6.4: Die Zeitverläufe zeigen die Phasenverschiebung
Abbildung 6.5: Die Ortskurve des Frequenzgangs ist eine geschloss...
Abbildung 6.6: Der Frequenzganganalysator testet Maschinen
Abbildung 6.7: Die Ortskurve des P-T1-Systems ist ein Halbkreis
Abbildung 6.8: Das P-T1-System kann höheren Frequenzen schlechter...
Abbildung 6.9: Die Ortskurven aller dynamischer P-Systeme starten...
Abbildung 6.10: Die Ortskurven von I-Systeme haben keinen endlic...
Abbildung 6.11: Das Bode-Diagramm zeigt den Amplituden- und den ...
Abbildung 6.12: Das Bode-Diagramm zeigt die Resonanzfrequenz
Abbildung 6.13: Asymptotische Amplitudengänge liefern Modellpara...
Abbildung 6.14: Der Amplitudengang mit drei Abschnitten wird in ...
Kapitel 7
Abbildung 7.1: Der Zwei-Massen-Drehschwinger ist ein mechatronisc...
Abbildung 7.2: Die MIMO-Regelstrecke hat mehrere Stellgrößen und ...
Abbildung 7.3: Die Dimensionen der ABCD-Matrizen müssen zusammenp...
Abbildung 7.4: Flüssigkeiten laufen durch drei Tanks
Abbildung 7.5: Die Simulation zeigt die Dynamik in den Tanks
Abbildung 7.6: Nach der Modellierung des Prozesses können Sie sei...
Abbildung 7.7: Zustandsgrößen können Sie auch grafisch darstellen
Abbildung 7.8: Die numerische Integration berechnet Flächen zwisc...
Abbildung 7.9: Das Blockdiagramm macht die Struktur der ABCD-Form...
Kapitel 8
Abbildung 8.1: Vier Wege führen zum Zustandsvektor
Abbildung 8.2: Im Wärmeübertrager gibt ein Stoff die Wärme an ein...
Abbildung 8.3: Eine Kugel rollt auf einer neigbaren Platte
Abbildung 8.4: Wichtig im Blockdiagramm sind die Integratoren
Abbildung 8.5: Das Blockdiagramm zeigt die Struktur der Regelungs...
Abbildung 8.6: Beobachternormalform
Abbildung 8.7: Es kann nicht immer alles geregelt oder gemessen w...
Abbildung 8.8: Aus dem Blockdiagramm machen Sie Zustandsgleichung...
Kapitel 9
Abbildung 9.1: Der einschleifige Regelkreis hat eine Standardform
Abbildung 9.2: So würde sich ein idealer Regelkreis verhalten
Abbildung 9.3: Das Nyquist-Kriterium verwendet Frequenzgänge
Abbildung 9.4: Ein Regelkreis an der Stabilitätsgrenze macht Daue...
Abbildung 9.5: Die Ortskurve geht an der Stabilitätsgrenze durch ...
Abbildung 9.6: Das Umfahren des kritischen Punkts entscheidet übe...
Abbildung 9.7: Stabilitätsreserven sind sinnvoll
Abbildung 9.8: Das Nyquist-Kriterium funktioniert auch im Bode-Di...
Abbildung 9.9: Der Regelkreis ist stabil
Abbildung 9.10: Ein leichtes Überschwingen macht den Regelkreis ...
Abbildung 9.11: Die Regelgröße darf hier nicht überschwingen
Abbildung 9.12: Die Regelgröße fährt etwas weicher auf den Sollw...
Kapitel 10
Abbildung 10.1: Die PID-Regeleinrichtung ist ein Standard
Abbildung 10.2: Die Kanäle des PID-Reglers haben unterschiedlich...
Abbildung 10.3: Das mit dem D-T1-Verhalten verzögerte Differenzi...
Abbildung 10.4: Das ist die Sprungantwort des PI(D-T1)-Reglers
Abbildung 10.5: Drei Schritte führen zur Reglereinstellung
Abbildung 10.6: Der Kompensationsregler erzeugt die gewünschte D...
Abbildung 10.7: Der Elektromagnet positioniert die Masse
Abbildung 10.8: Ungeregelt schwingt die Masse
Abbildung 10.9: Geregelt fährt die Masse gedämpft auf den Sollwe...
Abbildung 10.10: Es gibt geeignete Bereiche für die Eigenwerte
Abbildung 10.11: Es beginnt mit dem P-Anteil
Abbildung 10.12: Der I-Anteil verringert die Phasenreserve
Abbildung 10.13: Mit dem PID-Regler wird die Dynamik besser.
Abbildung 10.14: Eine Kontrolle im Zeitbereich ist sinnvoll
Abbildung 10.15: Tests am Prozess geben Aufschluss
Abbildung 10.16: Die Summenzeitkonstante T
S
wird grafisch ermit...
Abbildung 10.17: Die T-Summen-Regel macht zwei Einstellvorschlä...
Abbildung 10.18: Hier wird der Wendepunkt der Sprungantwort auf...
Abbildung 10.19: Die Ableitung der Sprungantwort erleichtert di...
Kapitel 11
Abbildung 11.1: Hilfsregelgrößen machen die Regelung schneller
Abbildung 11.2: Die Kaskadenregelung schachtelt Regelkreise
Abbildung 11.3: Ein zusätzlicher Regelkreis verbessert die Tempe...
Abbildung 11.4: Die Bewegung von Roboterachsen ist anspruchsvoll
Abbildung 11.5: Die Kaskade einer Antriebsregelung enthält drei ...
Abbildung 11.6: Ein Führungsgrößenrechner liefert die externen S...
Abbildung 11.7: Die Vorsteuerung unterstützt den Regler
Abbildung 11.8: Die Vorsteuerung verbessert das Führungsverhalte...
Abbildung 11.9: Hilfsregler greifen in das Innere des Prozesses ...
Abbildung 11.10: Hilfsstellgrößen sollten mit der Zeit verschwi...
Abbildung 11.11: Bei messbaren Störungen kann direkt etwas dage...
Abbildung 11.12: Die Erfassung von Störungen verbessert das Reg...
Abbildung 11.13: Split-Range-Regelungen steuern zwei Aktoren an
Abbildung 11.14: Zwei Prozessgrößen sind verkoppelt
Abbildung 11.15: Zwei Größen am Eingang und Ausgang erzeugen vi...
Abbildung 11.16: Mit Entkopplungsreglern entstehen zwei unabhän...
Abbildung 11.17: Beide Stellgrößen wirken auf beide Regelgrößen
Abbildung 11.18: Die beiden Regelkreise sind vollständig entkop...
Kapitel 12
Abbildung 12.1: Regler entwickelten sich von der Mechanik zum Pr...
Abbildung 12.2: Mit dem Fliehkraftregler fing es an
Abbildung 12.3: Elektronik macht die Regelung preiswert und flex...
Abbildung 12.4: Der Regler wird zum Programm im Rechner
Abbildung 12.5: Amplituden werden stufig und Zeiten diskret
Abbildung 12.6: Ein analoges Signal sieht im Rechner anders aus
Abbildung 12.7: Diskretisierung verändert das Signal
Abbildung 12.8: Der digitale PID-Regler erzeugt Stufen
Abbildung 12.9: Das Reglerprogramm arbeitet in einer Schleife
Abbildung 12.10: Daten werden durch den Speicher geschoben
Abbildung 12.11: MATLAB macht das Diskretisieren leicht
Abbildung 12.12: Die Abtastzeit kann geändert werden
Kapitel 13
Abbildung 13.1: Das EVA-Prinzip gilt auch für digitale Regelunge...
Abbildung 13.2: Der Proportionalbereich sinkt mit zunehmender Re...
Abbildung 13.3: Die Front des Kompaktreglers enthält wichtige Be...
Abbildung 13.4: Module und Reglerfunktionen werden verknüpft
Abbildung 13.5: Sollwerte und Stellgrößen sind umschaltbar
Abbildung 13.6: Störgrößenaufschaltung vor dem Regler korrigiert...
Abbildung 13.7: Störgrößenaufschaltung nach dem Regler korrigier...
Abbildung 13.8: Zwei-Punkt-Regler können nur schalten
Abbildung 13.9: Drei-Punkt-Regler schalten zwischen drei Stellgr...
Abbildung 13.10: Die Gleichlaufregelung synchronisiert zwei Reg...
Abbildung 13.11: Bei der Verhältnisregelung arbeiten zwei Regel...
Abbildung 13.12: Das Mischungsverhältnis wird geregelt
Abbildung 13.13: Sprungförmige Sollwerte sind nicht immer erwün...
Abbildung 13.14: Der NTC-Widerstand besitzt eine nichtlineare K...
Kapitel 14
Abbildung 14.1: Die kippbare Schiene bewegt den Wagen
Abbildung 14.2: Der Zustandsregler macht das richtig gut
Abbildung 14.3: Das Signalflussbild macht die Gleichungen deutli...
Abbildung 14.4: Der Zwei-Massen-Schwinger ist ziemlich prominent
Abbildung 14.5: Massen mit Federn neigen zu Schwingungen
Abbildung 14.6: Zustände regeln bedeutet Eigenwerte platzieren
Abbildung 14.7: Der Zustandsregler macht die Dämpfung
Abbildung 14.8: Jetzt kann der Zustandsregler auch positionieren
Abbildung 14.9: Simulink kann mit Blockdiagrammen rechnen
Abbildung 14.10: Mit dieser kleinen Blockauswahl kann vieles si...
Kapitel 15
Abbildung 15.1: Ein Modell des realen Prozesses läuft mit
Abbildung 15.2: Der Beobachter bekommt eine Rückmeldung vom Proz...
Abbildung 15.3: Der Beobachter kann in das Innere eines Prozesse...
Abbildung 15.4: Nicht messbare Zustände werden vom Beobachter ri...
Abbildung 15.5: Jetzt ist alles zusammengeschaltet
Abbildung 15.6: Die Schwingerkette beschreibt das typische Verha...
Abbildung 15.7: Das Blockdiagramm simuliert die Regelstrecke
Abbildung 15.8: Ungeregelt neigt das System zu Schwingungen
Abbildung 15.9: Das Blockdiagramm erprobt das Gesamtsystem
Abbildung 15.10: Es hat alles geklappt
Kapitel 16
Abbildung 16.1: Der Zustandsregler bekommt einen I-Anteil
Abbildung 16.2: Der I-Anteil erweitert den Zustand
Abbildung 16.3: I-Anteile vermeiden bleibende Regeldifferenzen
Abbildung 16.4: Im Rechner ist alles zeitdiskret
Abbildung 16.5: Funktionen, die den Übergang erleichtern
Abbildung 16.6: Im Zeitdiskreten entstehen Stufen
Abbildung 16.7: So funktioniert der zeitdiskrete Zustandsregler
Kapitel 17
Abbildung 17.1: Das Drahtrechteck soll eine maximale Fläche beko...
Abbildung 17.2: Die Gütefunktion hat ein Maximum
Abbildung 17.3: Gewichte legen fest, was wichtig ist
Abbildung 17.4: Die Gewichtungen bestimmen das Verhalten
Abbildung 17.5: Quadratische Funktionen eignen sich für die Opti...
Abbildung 17.6: Es wird ein optimaler Reglerparameter gesucht
Abbildung 17.7: Die Gütefunktion hat beim optimalen Reglerparame...
Abbildung 17.8: Regelgüte und Regelaufwand stehen in einem guten...
Abbildung 17.9: Die Gütefunktion wird auch simuliert
Abbildung 17.10: Simulation und Optimierung wechseln sich ab
Abbildung 17.11: Der Gütewert wird minimiert
Abbildung 17.12: Der LQR-Entwurf liefert optimale Regler
Kapitel 18
Abbildung 18.1: Die klassische Mengenlehre kennt nur Ja oder Nei...
Abbildung 18.2: Die Fuzzy-Menge kennt auch Zwischenwerte
Abbildung 18.3: Fuzzy-Mengen können unterschiedliche Formen habe...
Abbildung 18.4: Die Fuzzy-Mengen beschreiben einen Messbereich
Abbildung 18.5: Das ist das Ergebnis der Fuzzifizierung
Abbildung 18.6: Der Fuzzy-Regler ersetzt den herkömmlichen Regle...
Abbildung 18.7: Ein Fuzzy-Regler besteht aus drei Teilen
Abbildung 18.8: Ein Regler hält den Abstand
Abbildung 18.9: Die Regelbasis verknüpft Fuzzy-Mengen
Abbildung 18.10: Messgrößen bestimmen die Zugehörigkeitsgrade
Abbildung 18.11: Erfüllungsgrade erzeugen Flächen
Abbildung 18.12: Verformungen von Fuzzy-Mengen beeinflussen das...
Kapitel 19
Abbildung 19.1: Zu MATLAB gibt es Toolboxes zu den verschiedenst...
Abbildung 19.2: Simulationen bauen Sie mit Xcos auf
Abbildung 19.3: Die Zahl der Funktionen in Scilab ist enorm
Abbildung 19.4: Die Hilfefunktion beschreibt alle Funktionen aus...
Abbildung 19.5: Auf den Paletten von Xcos finden Sie die Blöcke
Abbildung 19.6: WinFACT besteht aus mehreren Einzelprogrammen
Abbildung 19.7: Ein Regelkreis ist schnell zusammengebaut
Abbildung 19.8: Mit dem Block »Multiplot« sehen Sie das Ergebnis
Abbildung 19.9: Das sind noch nicht alle Blöcke von BORIS
Abbildung 19.10: In BORIS wird die Regelungsstruktur aufgebaut
Abbildung 19.11: FLOP definiert die Klassen der linguistischen ...
Abbildung 19.12: … und die Regelbasis
Abbildung 19.13: Das 3-D-Kennfeld überprüft die Regelbasis
Abbildung 19.14: Ein virtuelles Instrument hat auch ein Äußeres...
Abbildung 19.15: Virtuelle Instrumente werden auch »verdrahtet«
Abbildung 19.16: Der Knoten »Multiplikation« hat Terminals und ...
Abbildung 19.17: Palette der Elemente für das Frontpanel (Aussc...
Abbildung 19.18: Palette der Funktionen für das Blockdiagramm (...
Abbildung 19.19: Palette der Werkzeuge für Frontpanel und Block...
Abbildung 19.20: Ein Signalgenerator wird aufgebaut
Abbildung 19.21: Das Blockdiagramm simuliert einen Regelkreis
Abbildung 19.22: Dieses VI simuliert einen Regelkreis
Abbildung 19.23: LabVIEW regelt jetzt die reale Regelstrecke
Abbildung 19.24: Der Regelkreis zeigt das gewünschte Verhalten
Orientierungspunkte
Cover
Titelblatt
Impressum
Über den Autor
Inhaltsverzeichnis
Einführung
Fangen Sie an zu lesen
Abbildungverzeichnis
Stichwortverzeichnis
End User License Agreement
Seitenliste
1
2
3
4
7
8
9
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
439
440
441
442
443
444
445
449
450
451
Einführung
Über dieses Buch
Es gibt Menschen, die aus reinem Interesse zu einem Buch über Regelungstechnik greifen, und solche, die sich im Studium mit diesem Fach auseinandersetzen müssen. Gleichgültig zu welcher Gruppe Sie gehören, es ist prima, dass Sie sich für dieses Buch entschieden haben. Regelungstechnik klingt nüchtern, ist aber eine sehr spannende Sache. Sie findet nicht nur in Maschinen, sondern zum Beispiel auch im Menschen statt. Denken Sie nur daran, dass Ihre Bluttemperatur auf ein zehntel Grad genau geregelt ist. Dieses Buch Regelungstechnik für Dummies möchte zwei Dinge bei Ihnen erreichen. Zum Ersten möchte das Buch Sie im Umgang mit den Methoden der Regelungstechnik fit machen und zum Zweiten möchte es Sie zu einem regelungstechnisch denkenden Menschen werden lassen. Bei vielem, was wir tun, geht es darum, Ziele mit geeigneten Maßnahmen zu erreichen. Sie werden hier die Sprache der Regelungstechnik lernen, also die Begriffe, aber auch die Mathematik der Regelungstechnik. Dass Regelungstechnik nicht ohne Mathematik geht, das wussten Sie ja schon. Dass es aber überhaupt nicht wehtut, das erfahren Sie hier. Beispiele und Programme helfen Ihnen dabei.
Also – dann viel Spaß!
Konventionen in diesem Buch
Sie sollen sich in diesem Buch leicht zurechtfinden. Neben der detaillierten Gliederung in Kapitel und Unterkapitel erleichtern Ihnen folgende Hilfen das Lesen:
Aufzählungen erfolgen mit einer Häkchenliste.
Nummerierte Aufzählungen werden verwendet, wenn die Reihenfolge der Schritte wichtig ist.
Fett
Gedrucktes hebt wichtige Textteile hervor.
Kursiv
Gedrucktes erscheint für die Einführung neuer Begriffe, die Sie auch im Stichwortverzeichnis finden.
Die Auszeichnung
Listing
wird für Eingaben in Programme und für Webadressen verwendet.
Kursives Listing
steht für Ausgaben von Programmen.
Dann gibt es noch die Textkästen. Das sind meist mathematische Details oder auch interessante Ergänzungen, die Sie nur lesen sollten, wenn es da was zum Auffrischen gibt oder Sie auf ergänzende Details neugierig sind.
Jetzt bekommen Sie noch zwei formale Hinweise. Zum Ersten verwendet dieses Buch für die Sekunde das Einheitenzeichen sec und nicht das übliche s, da die Regelungstechnik s für eine andere wichtige Größe benötigt. Zum Zweiten werden in Abbildungen anders als im Text keine kursiven Formelzeichen verwendet.
Wie dieses Buch aufgebaut ist
Das Buch besteht aus sechs Teilen mit mehreren Kapiteln. Sie müssen die Kapitel nicht unbedingt der Reihe nach lesen, aber ein reines Nachschlagewerk ist dieses Buch auch nicht. Was die Teile enthalten, erfahren Sie hier.
Teil I: Der Einstieg in ein spannendes Fach
Überall, wo in der Technik eine Maschine Bewegungen und Veränderungen automatisch und mit hoher Genauigkeit ausführt, treffen Sie auf die Regelungstechnik. Sie wird von »Regelungstechnikern« eingerichtet und zum Laufen gebracht, die genau das draufhaben, was Sie in diesem Buch lernen können. Sie werden fasziniert davon sein, was mit der Regelungstechnik möglich ist.
Kapitel 1 zeigt Ihnen, dass die Regelungstechnik als Teilgebiet der Automatisierungstechnik ein Prinzip anwendet, das Sie nicht nur in der Technik finden, sondern das Sie überall in der Natur erkennen können: das Prinzip der Rückkopplung in einem Regelkreis oder wie es im Englischen heißt: feedback control.
Kapitel 2 fängt ganz sachte mit einem Beispiel aus der Mechatronik an. Es erklärt Ihnen, aus welchen Bausteinen ein Regelungstechniker einen Regelkreis aufbaut und wie er dabei vorgeht. Ein Regelkreis besteht immer aus zwei Partnern: dem zu regelnden Prozess und dem, der es macht, dem Regler. Der Regler wirkt auf den Prozess und der Prozess auf den Regler und … Wo ist der Anfang in diesem Kreislauf? Es gibt keinen! Wenn Sie das spannend finden, werden Sie in diesem Buch auf Ihre Kosten kommen.
Nach Kapitel 3 können Sie sich schon mit Regelungstechnikern unterhalten, weil Sie die wichtigsten Begriffe der Regelungstechnik bereits kennengelernt haben. Und behalten Sie bitte auf dem weiteren Weg durch dieses Buch trotz der vielen regelungstechnischen Details das Wesentliche im Blick: das Prinzip der Rückkopplung.
Teil II: Theorie kann praktisch sein
Ingenieure haben ein spezielles Verhältnis zur Mathematik. Sie wenden sie an, um praktische Probleme elegant zu lösen, nach dem Motto »Nur so viel Mathematik wie nötig«. Und da Ingenieure für die Regelungstechnik zuständig sind, können Sie beruhigt und interessiert diesen Teil lesen. Wenn auch manches zunächst etwas theoretisch klingt, für die Anwendung erfahren Sie sofort die praktische Quintessenz.
In einem dynamischen System finden Veränderungen statt. Und natürlich ist ein Regelkreis mit Regelstrecke und Regler ein dynamisches System. Dynamik beschreiben Sie mathematisch mit zeitlichen Differenzialen. Wie Sie damit umgehen, zeigt Ihnen Kapitel 4.
Da aber die Differenzialgleichung nicht des Ingenieurs liebstes Kind ist, macht er daraus schnell eine algebraische Gleichung. Wie Sie damit sehr einfach arbeiten können, erfahren Sie in Kapitel 5.
Schwingungen treten in der Technik häufig auf, teils sind sie erwünscht, teils unerwünscht. Die Regelungstechnik setzt Schwingungen zu Testzwecken ein und hat wieder eine feine Untersuchungsmethode entwickelt, die Sie in Kapitel 6 kennenlernen.
In denKapiteln 7 und 8 erfahren Sie, wie Sie mit Zustandsgleichungen mehrere Einzelvorgänge auf einen Rutsch erfassen können. Das ist total spannend. Diese Kapitel stellen allerdings etwas höhere Ansprüche an den regelungstechnischen Einsteiger und können zunächst übersprungen werden. Wenn Sie bei Kapitel 14 im übernächsten Teil angekommen sind, wo solche Vorgänge geregelt werden, sollten Sie jedoch vorher auch diese beiden Kapitel gelesen haben. Aber eins nach dem anderen.
Teil III: Der Regelkreis hat Ecken
Hier lesen Sie alles, was ein Regelungstechniker zur Berechnung und technischen Realisierung eines Reglers wissen muss.
Kapitel 9 beschreibt, was einen guten Regler ausmacht. Er muss stabil, genau und schnell sein. Wie Sie diese Eigenschaften erzeugen und überprüfen können, erfahren Sie hier.
Der wichtigste Begriff in der Regelungstechnik ist der sogenannte PID-Regler, den Sie in Kapitel 10 kennenlernen. Sie erfahren die verschiedenen Möglichkeiten, die richtigen Einstellwerte für den PID-Regler zu finden.
In Kapitel 11 lesen Sie etwas darüber, wie durch zusätzliche Maßnahmen im Regelkreis das Regelverhalten noch verbessert werden kann.
Heutzutage steckt in fast jedem Gerät digitale Elektronik. Natürlich hat die Regelungstechnik mit dieser Entwicklung Schritt gehalten. Kapitel 12 befasst sich mit den Besonderheiten des digitalen Reglers. Sie lernen, wie die Dynamik eines Reglers in einem Rechner aussieht.
Digitale Regelgeräte können sehr unterschiedlich aussehen. Aber meistens sieht man außer einer Rechnerbox überhaupt nichts mehr. Den Rest macht die Software. Eine Ausnahme ist der Kompaktregler mit einer realen Bedienfront, mit der Sie noch verstehen können, welche Funktionen der Regler hat. In Kapitel 13 erfahren Sie einiges darüber.
Teil IV: Alles gleichzeitig regeln
Die Regelungstechnik hat in den letzten 40 Jahren eine Alternative zum PID-Regler entwickelt, die Zustandsregelung. Damit ist es möglich, nicht nur eine Prozessgröße, sondern mehrere Prozessgrößen gleichzeitig zu regeln. Die Zustandsregelung gehört unbedingt in ein Buch über Regelungstechnik, da es mittlerweile fester Bestandteil von Vorlesungen ist und es sehr viele industrielle Anwendungen der Zustandsregelung gibt.
In Kapitel 14 lesen Sie, wie eine Zustandsregelung aussieht, wie diese Regelung berechnet wird und welche Vorteile sie hat.
Aber wie es oft so ist, wo Vorteile sind, gibt es auch Nachteile. Der Nachteil der Zustandsregelung liegt häufig darin, dass nicht alles, was Sie für die Regelung benötigen, an der Anlage gemessen werden kann. Abhilfe schafft das Verfahren des Beobachters, das in Kapitel 15 vorgestellt wird.
Auch ein Zustandsregler wird natürlich als Programm auf einem Rechner realisiert. Näheres dazu erfahren Sie in Kapitel 16.
Teil V: Optimales, Menschliches und Hilfreiches
Mit drei interessanten Kapiteln, die auf keinen Fall fehlen dürfen, können Sie Ihr Wissen über die Regelungstechnik abrunden.
Sie erfahren in Kapitel 17 einiges über Optimierung und optimale Regler. Sie werden feststellen, dass das Optimale nur eine Frage der Bewertung ist.
Einen ganz anderen Weg, um zu einer Regelstrategie zu kommen, beschreitet Kapitel 18. Hier wird das, was der Mensch als Regler tun würde, in leicht verständliche Regeln gegossen – ohne Mathematik.
Alle Verfahren, die Sie in diesem Buch gelesen haben, finden Sie in Programmen für die Regelungstechnik. Vier wichtige Programme stellt Kapitel 19 vor.
Teil VI: Der Top-Ten-Teil
Der Top-Ten-Teil in … für Dummies-Büchern ist für den Autor eine feine Sache. Hier kann er ganz nach seinem Geschmack einen Schlusspunkt setzen.
Mit Kapitel 20 schließt dieses Buch und stellt für die Leser zehn hilfreiche Tipps zusammen.
Die Studenten der Regelungstechnik werden ebenso angesprochen wie die Praktiker. Am besten wäre es natürlich, wenn auch die Studenten ein wenig praktische Erfahrung in einem Labor für Regelungstechnik sammeln könnten. Eine geregelte Maschine beeindruckt mehr als ein Diagramm.
Sie erfahren, wer sich mit Regelungstechnik befasst, Sie können sich Videos ansehen, lernen die wichtigsten englischen Fachbegriffe und schließlich können Sie mit der angegebenen Literatur tiefer einsteigen.
Symbole, die in diesem Buch verwendet werden
In diesem Buch werden Symbole verwendet, die Sie auf besondere Sachverhalte hinweisen. Achten Sie also besonders auf diese Symbole:
Hier erhalten Sie Tipps, die Ihnen das Leben leicht machen, oder Sie werden hier auf wichtige Zusammenhänge hingewiesen.
Hier erfahren Sie neue Begriffe, die Sie zum Experten machen.
Hier sollten Sie bei der Anwendung besonders vorsichtig sein.
Hier kommt ein Beispiel, das gut zum Thema passt.
Wie es weitergeht
Der Überblick über das Inhaltsverzeichnis und diese Einführung sollten Ihnen schon eine Vorstellung gegeben haben, was Sie in diesem Buch erwartet. Machen Sie nun dieses … für Dummies-Buch zu Ihrem Freund und Begleiter in Sachen Regelungstechnik, dem Fach mit Feedback. Deshalb freut sich auch der Autor dieses Buches über Feedback zu dem, was Ihnen gefallen hat und, noch wichtiger, wo Sie Verbesserungsvorschläge haben. Schreiben Sie einfach an mail@e-hasenjaeger.de.
Vielen Dank und nun geht's los mit Kapitel 1.
Teil I
Der Einstieg in ein spannendes Fach
IN DIESEM TEIL …
Die drei Kapitel in diesem Teil führen Sie in die Regelungstechnik ein. Dazu gehört, dass Sie erfahren, wo Regelungstechnik stattfindet, was man für sie braucht und wie sie funktioniert.
Dann folgt ein ausführliches Beispiel aus der Antriebstechnik, das Ihnen die Arbeitsweise zeigt.
Schließlich erfahren Sie das Grundwissen der Regelungstechnik und sind damit für alles Weitere bestens gerüstet.
Kapitel 1
Das Ganze im Überblick
IN DIESEM KAPITEL
In vielen Bereichen Regelungen erkennenDas Prinzip des Regelkreises verstehenProzessgrößen und Signale unterscheiden lernenDynamik mit Diagrammen auf Papier bringenBegriffe der Regelungstechnik verwendenDie Regelungstechnik ist eine Methode, die reale Welt möglichst nahe an einen gewünschten Zustand heranzuführen. Das wird Sie faszinieren. Sie können mit der Regelungstechnik fachübergreifend Vorgänge nicht nur dynamisch beschreiben, sondern auch in gewünschter Weise beeinflussen. Am Anfang steht dabei nicht gleich die Mathematik, sondern das grundlegende Verständnis, wie ein Regelkreis aufgebaut ist und was ein Regelkreis leisten kann. Hierzu lernen Sie in diesem ersten Kapitel die wichtigsten regelungstechnischen Begriffe und die Elemente von Regelkreisen kennen.
Königsdisziplin der Automatisierung
Wenn Sie auf den Anfang des Industriezeitalters blicken, dann begann dieses mit der Mechanisierung und nahm dem Menschen damit schwere körperliche Arbeit ab. Mit der Weiterentwicklung von Elektronik und Digitaltechnik war es dann möglich, immer mehr Prozesse selbsttätig ablaufen zu lassen, sodass damit zur Mechanisierung die Automatisierung kam. Die Automatisierungstechnik hat das Ziel, Maschinen und Anlagen selbstständig ohne ständige Mitwirkung des Menschen zu betreiben. Der Automatisierungsgrad wird ständig erhöht. Damit verbunden sind die Senkung von Produktionskosten sowie die Steigerung von Qualität und Sicherheit.
Das Servicehaus
Die Regelungstechnik ist ein wichtiges Teilgebiet der Automatisierungstechnik. Das können Sie sich wie eine Abteilung im Haus der Automatisierungstechnik vorstellen, in der Projekte für automatisierte Produktionsmethoden oder Produkte mit automatisierten Funktionen bearbeitet werden (siehe Abbildung 1.1).
Abbildung 1.1: Zur Automatisierung gehören mehrere Abteilungen
Natürlich arbeiten alle Abteilungen der Automatisierung eng zusammen. Sie müssen auch viel Fachwissen über die jeweilige Branche besitzen, in der die Automatisierung stattfindet.
Zu diesen Branchen gehören die
Fertigungstechnik,
Verfahrenstechnik,
Energieerzeugung,
Grundstoffindustrie,
Versorgung und Entsorgung,
medizinische Technik,
Gebäudetechnik,
Luft- und Raumfahrt,
Fahrzeug- und Verkehrstechnik.
Elektrotechnik, Hydraulik und Pneumatik bilden die Basis für die Automatisierung. Mit elektrischen, hydraulischen und pneumatischen Aktoren erzeugen Sie die gewünschten mechanischen, thermischen und stofflichen Abläufe in den Prozessen. Aktoren sind Motoren, Ventile, Heizungen, Hydraulik- und Pneumatikzylinder.
Messen, Steuern, Regeln
Die Messtechnik, die Steuerungstechnik und die Regelungstechnik sind die Bindeglieder zwischen den gewünschten physikalischen Prozessgrößen in der Maschine und Anlage und den Informationen (Signalen) darüber.
Die Messtechnik behandelt Geräte und Methoden zur Messung, also zur zahlenmäßigen Bestimmung physikalischer Größen wie Geschwindigkeit, Kraft, elektrische Spannung oder Temperatur. Die Messtechnik erzeugt mit Sensoren aus den physikalischen Größen Informationen in Form von Signalen.
Ein Beispiel: Temperaturen bewirken in metallischen Leitern eine Widerstandsänderung. Das ist das Messprinzip eines Temperatursensors. Ein konstanter Strom durch diesen Messwiderstand erzeugt eine temperaturabhängige Spannung. Diese Spannung wird durch elektronische Verstärkung auf Standardwerte für die Erfassung mit einem Rechner gebracht. Schließlich erfolgt im Rechner die Rückrechnung auf die zugehörige Temperatur. Die Sensorik besteht also aus dem Sensor und der elektronischen Anpassung.
Umgekehrt zur Messtechnik macht die Steuerungstechnik aus Signalen physikalische Aktionen.
Die Steuerungstechnik befasst sich mit der Einwirkung von Signalen auf physikalische Größen in Geräten und Maschinen mithilfe von Aktoren. Ein Steuerungsprogramm erzeugt die Signale nach einem Plan.
Ein Beispiel: Die Vorgabe für die Durchflussmenge einer Flüssigkeit in einem Rohr kommt von einem Programm. Der Rechner gibt ein Signal aus, das der Aktor zunächst in eine elektrische Spannung umsetzt. Diese Spannung treibt den Motor an einer Klappe eines Durchflussventils im Flüssigkeitsrohr an.
Wie Sie aus dem Beispiel erkennen können, gibt es keine Rückmeldung darüber, ob die erzeugte Klappenstellung den gewünschten Durchfluss erzeugt. Sie merken, dass bei den Aktionen der Steuerungstechnik keine Rückmeldungen darüber erfolgen, ob die Programmvorgaben auch wirklich erreicht wurden. Während bei der Messtechnik die Information über den Prozess mit der Sensorik erzeugt wird, wirkt bei der Steuerungstechnik die Information auf den Prozess. In beiden Fällen geht die Wirkung also nur in einer Richtung (siehe Abbildung 1.2). Erst die Regelungstechnik verbindet die Aktorik und die Sensorik.
Die Regelungstechnik setzt Geräte und Programme als Regler ein, um damit die tatsächlichen Zustände eines Prozesses in gewünschte Zustände zu bringen. Die Regelungstechnik nutzt dazu die Sensorik und die Aktorik. Mit der Sensorik bekommen Sie eine Rückmeldung über die Wirkung der Aktorik auf den Prozess.
Für das Beispiel bedeutet es, dass der eingestellte Durchfluss gemessen und über die Klappenstellung richtig eingestellt wird.
Sie sehen an dem Beispiel, dass das Messen, das Steuern und das Regeln eng zusammenhängen, weshalb die Automatisierungstechnik auch von der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik spricht.
Abbildung 1.2: Messen, Steuern und Regeln sind die Kernfächer der Automatisierung
Aktoren und Sensoren
MitAktoren und Sensoren kann die Regelung ihre Aufgaben am Prozess erfüllen. Aktoren und Sensoren haben aber auch außerhalb von Regelkreisen wichtige Funktionen in der Automatisierungstechnik.
Prozesseingriffe durch den Menschen, einfache, schaltende Steuerungen und vor allem die Regelungstechnik nutzen Aktoren, mit denen aus Signalen physikalische Prozesseingriffe werden.
Sensoren werden immer dann eingesetzt, wenn Information über das, was in der Maschine geschieht, gewünscht wird. Das ist für den beobachtenden und bedienenden Menschen genauso wichtig wie für den automatisch arbeitenden Regler.
Die Aufbereitung von Sensorsignalen für den Menschen wird in der Automatisierung »zentrales Beobachten« genannt, die Möglichkeit, manuell in den Prozess einzugreifen, ist das »zentrale Bedienen« (siehe Abbildung 1.3.)
Auch die Mechatronik und die Simulation gehören in den Bereich der Automatisierung.
Die Mechatronik verbindet die Mechanik, Elektronik und Informatik zu einer modernen, leistungsfähigen Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik im Maschinen- und Fahrzeugbau. Zur Mechatronik zählen komplexe Anwendungen von Industrierobotern genauso wie Antischleuderprogramme in Straßenfahrzeugen.
Simulationen spielen bei der Entwicklung von Automatisierungssystemen eine große Rolle. Simulationen bilden reale Vorgänge auf Rechnern nach. Das verkürzt Entwicklungszeiten, spart Entwicklungskosten und gibt frühzeitig Auskunft darüber, ob das auch alles so funktioniert, wie es geplant ist. Deshalb verwendet auch die Regelungstechnik sehr häufig die Simulationstechnik. Bereits vor der Inbetriebnahme einer Regelung möchten Sie wissen, ob Sie die Regelung richtig berechnet haben.
Abbildung 1.3: Auch bei hoher Automatisierung – ohne den Menschen geht es nicht
Die Leittechnik und Kommunikationstechnik überwacht, steuert und koordiniert ganze Produktionsbereiche. Die Leittechnik fasst die Daten untergeordneter Bereiche zusammen. Sie finden die Leittechnik im Straßen-, Schienen- und Luftverkehr, in Kraftwerken, in der mechanischen Fertigung, in der Verfahrenstechnik und im Gebäudemanagement.
In den untergeordneten Bereichen sind eine Vielzahl von Mess-, Steuerungs- und Regelungssystemen installiert. Die Kommunikation der einzelnen Automatisierungssysteme erfolgt über Datenleitungen, sie heißen Feldbusse. Das sind lokale Netzwerke mit hoher Sicherheit, Geschwindigkeit und Reaktionsfähigkeit.
Regelungen in Technik und Natur
Alles geregelt – das klingt gut. Tatsächlich wird in der Technik und auch in der Biologie sehr vieles erfolgreich geregelt. In der Technik kennen Sie zum Beispiel die Temperaturregelung einer Heizungsanlage, die Geschwindigkeitsregelung durch einen »Tempomat« in einem Fahrzeug, den Autopiloten eines Flugzeugs oder Schiffs.
Die biologische Regelung lässt Sie auf zwei Beinen stehen, eine gewisse Zeit sogar auf einem. Die Frequenz des Herzschlags ist geregelt, der Blutdruck, die Körpertemperatur, die Atmung, die Pupillenöffnung. Auch der Mensch führt Regelungen aus, zum Beispiel beim Autofahren. Sie fahren auf der Autobahn mit einer bestimmten Geschwindigkeit und Sie achten dabei auf den passenden Abstand zum vorderen Fahrzeug und zum Seitenstreifen.
Das Prinzip Rückmeldung
Das Prinzip der Rückmeldung von Prozessgrößen an eine Instanz, die bei Abweichungen dieser Größen von einem gewünschten Sollzustand geeignete Maßnahmen ergreift, ist in Technik und Natur eine der faszinierendsten Funktionsweisen, man nennt sie Regelung.
Ein gemeinsames Prinzip
Der US-amerikanische Mathematiker Norbert Wiener (1894–1964) erkannte, dass Regelungsvorgänge bei Lebewesen und Maschinen nach dem gleichen Prinzip funktionieren. Er schuf für diese Gemeinsamkeit einen neuen Begriff, die Kybernetik. Dieses Kunstwort leitete er aus dem Griechischen ab, wo kybernetes der Steuermann eines Bootes ist. Kybernetik ist also die Steuermannskunst. Das erste Buch zur Kybernetik erschien 1948 mit dem Titel Cybernetics or Control and Communication in the Animal and the Machine.
Die Regelung ist ein Wirkungskreislauf in Natur und Technik, der auf dem Prinzip der Rückkopplung basiert.
Allen Regelungen gemeinsam ist ein geschlossener Wirkungskreislauf, ein Regelkreis, den Abbildung 1.4 zeigt.
Abbildung 1.4: Regelkreise haben sich in vielen Bereichen bewährt
Das Wichtigste im Regelkreis ist die Regelgröße, um sie dreht sich alles. Sie wird mithilfe der Regelung auf einen gewünschten Wert, den Sollwert, gebracht. Die Regelung erzeugt dazu eine geeignete Aktion, die Stellgröße, die im Veränderungsvorgang, dem Prozess, umgesetzt wird und so die Regelgröße in gewünschter Weise beeinflusst. Häufig treten auch unerwünschte Störgrößen auf, die ebenfalls auf die Regelgröße wirken. Sie können von der Regelung ausgeglichen werden.
Die mit Pfeilen versehenen Linien am Prozess und an der Regelung in Abbildung 1.4 geben die Richtung der Wirkungen an.
Es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem, was geregelt werden soll, dem Prozess, und der Instanz, die es tut, der Regelung. Und das ist das Besondere in der Regelungstechnik: Sie können nicht sagen, ob die Regelgröße die Stellgröße beeinflusst oder umgekehrt. Wie war das mit der Henne und dem Ei? Diese gegenseitige Beeinflussung bereitet anfänglich etwas Vorstellungsschwierigkeiten. Sie werden aber sehen, dass ein bisschen Mathematik dieses Problem leicht lösen kann. Das wird spannend in den Kapiteln 4 und 5.
Wichtig ist es, die beiden Begriffe Prozess und Regelung auseinanderzuhalten und die Größen im Regelkreis wie Regelgröße, Sollwert, Stellgröße und Störgröße zu verstehen. Die Alltagsbeispiele in Tabelle 1.1 sollen Ihnen dabei helfen.
Beispiel
Regelgröße
Regelung
Stellgröße
Prozess
Störgröße
Heizung
Raumtemperatur
Thermostat und Heizungsregler
Ventilöffnung und Mischerstellung
Erzeugung und Transport von Warmwasser
Außentemperatur und Wärmeverluste
Tempomat
Geschwindigkeit
Steuergerät
Kraftstoffzufuhr
Erzeugung von Antriebsmoment und Bremsmoment





























