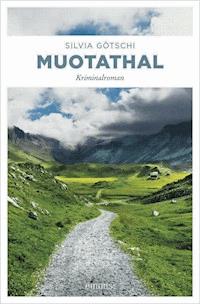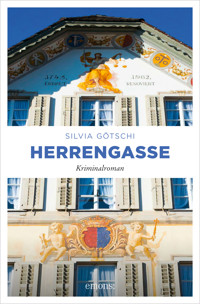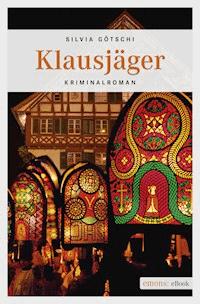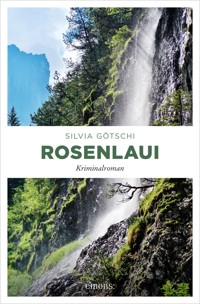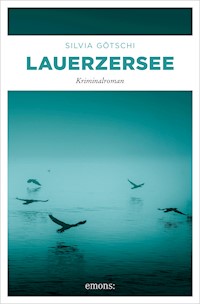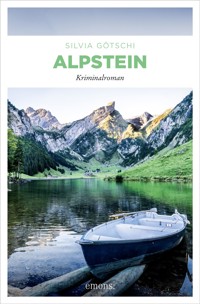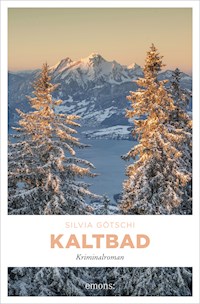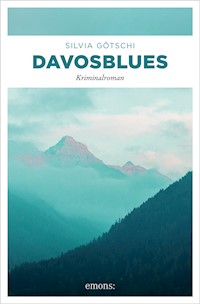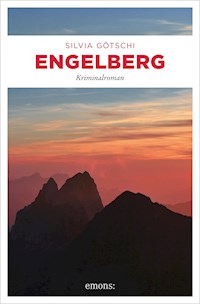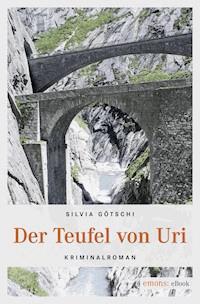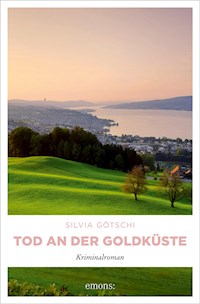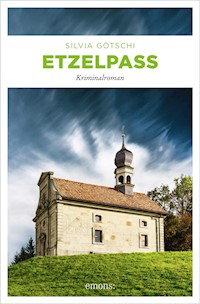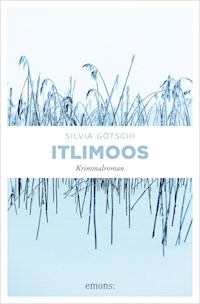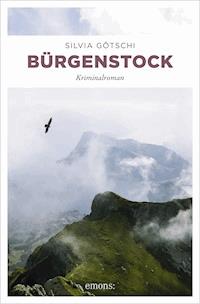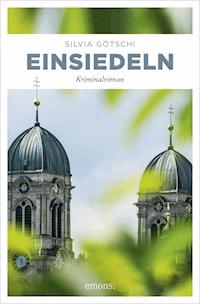13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Düster, aufwühlend und raffiniert konstruiert: Ein schonungsloser Psycho-Krimi von der Schweizer »Queen of Crime«. Kurz vor der beliebten »Metzgete« erschüttert eine Meldung die March: Vier bestialisch zugerichtete Leichen wurden in einer verlassenen Villa bei Tuggen entdeckt. Fast zur selben Zeit verschwinden zwei junge Frauen aus der Gegend spurlos. Sind sie die nächsten Opfer? Valérie Lehmanns Ermittlungen führen zu einem Kinderheim und einer ominösen Vereinigung – und zwingen sie schließlich, sich mit den Geistern ihrer eigenen Vergangenheit auseinanderzusetzen. Band 9 der »Valérie Lehmann«-Reihe. Alle Bände der Reihe können unabhängig voneinander gelesen werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2023 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: istockphoto.com/stsmhn
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-98707-109-6
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Auf Erden herrscht die Liebe, im Himmel die Gnade,
und nur in der Hölle gibt es Gerechtigkeit.
Anaklet II.
Die losgebundenen Furien der Wut ruft
Keines Herrschers Stimme mehr zurück.
Friedrich Schiller
Es gibt zwei Arten von Menschen, die bestialisch morden:
Psychopathen und Krimiautoren.
Unbekannt
Die Bettdecke ist zerknittert und weiß. Kalt fühlt sie sich an, und ich liege wie in einem Sarg voller Eiskristalle. Wenn ich die Augen schließe, sehe ich mich in einem fernen Leben, das abrupt aufgehört hat zu existieren. Ich friere. Nachts vernehme ich dieses Wimmern und die Wagen, wenn sie über den Linoleumboden rollen. Manchmal höre ich eine Tür zuschlagen, dann streift ein Windhauch mein Gesicht. Der Tee ist noch warm und schmeckt nach Kräutern. Die Leere zieht mich in die Realität.
Da sind die Augen dieser Fremden wie ein Fenster zur Seele. Oder in den Abgrund, dem ich entweichen will. Ich kann nicht mehr, möchte schlafen, möchte sterben, mich nicht anstarren lassen mit diesem gekünstelten Mitleid. Die Frau hat keine Ahnung, wie mein Inneres zerreißt. Wie sich alles auflöst, was hoffnungsvoll begonnen hat.
Die Decke liegt flach auf meinem Leib. So schnell können Träume vergehen, als zerriebe man die Flügel einer Motte zwischen den Fingern. Zurück bleibt nichts als ein Odem von Staub. Und unglaublich rasch verschmelzen die letzten Bilder zu einem einzigen schwarzen Brei. Ich nenne es Perspektivlosigkeit.
Jemand hat für mich entschieden.
Da sind Stimmen, Lachen, Geräusche, die nicht mir gehören. Man hat mich dieser Selbstverständlichkeiten beraubt, mir gedroht und alles genommen, wofür es sich zu leben gelohnt hätte.
»Du bist eine Schande für die ganze Familie!«
Die Worte hallen in mir nach. Eine Schande! Für die ganze Familie! Als hätte keiner vor mir jemals Schande über die Familie gebracht, in der Liebe ein Fremdwort ist. Vater wäscht seine Hände in Unschuld, zitiert Bibelverse und geht sonntags zur Kirche. Unter der Woche will er seine Ruhe, die Glotze am Abend, ein Bier. »Du kannst nicht hierbleiben. Was würden die Nachbarn von uns denken?« Mein Vater, wie er die Hände in die Seite gestemmt hat. »Mutter habe ich es noch nicht gesagt. Gnade dir Gott, wenn sie es erfährt. Du Schlampe! Du hast es nicht verdient, eine Sekunde länger bei uns zu sein.«
Die Haut hängt schlaff. Ich müsse etwas dagegen tun, hat man mir geraten, als würde es jetzt noch einen Sinn ergeben, schön auszusehen.
Alles fremd. Die Energie ist aus mir gewichen. Da ist dieses Pochen in meinem Leib und der warme Fluss, in dem ich zu ertrinken drohe. Blut, viel Blut. Es sickert aus mir wie das Leben. Wenn ich den Atem anhielte, würde ich gehen können. Sterben, denke ich, ist der letzte Akt auf der Bühne dieser Verlogenheit. Ich will es, ich will es nicht. Ich hadere, hole tief Luft. Sterben geht nicht, strengt mich an.
Bewegungen wie der Flügelschlag eines Schmetterlings – alles vorbei. Was bleibt, ist ein Phantom.
Der Schmerz und die Leere.
Und nachts dieses Weinen. Ich weiß nicht, ob es bloß in meinem Kopf ist.
Die Hölle muss sich besser anfühlen.
Eins
»Ich bin Tomaso Cavadini vom Fahndungsdienst der Kantonspolizei Schwyz.« Er wies sich aus, nachdem die Frau die Tür geöffnet hatte, zeigte auf seine junge Kollegin und stellte sie vor. »Guten Tag, Frau Bruhin.«
Die Frau auf der Türschwelle nickte. Sie war von zarter Statur mit dunklem Haar. Ihr Gesicht war aufgequollen mit roten Flecken, als hätte sie geweint. »Ich weiß, wer Sie sind.«
»Wir kommen noch einmal wegen Ihrer Tochter.«
Ein Mädchen von siebzehn Jahren wurde vermisst. In Tomasos Unterlagen war sie mit »Akte 1123/5« vermerkt. Ein Schicksal, welches eine nichtssagende Nummer bekommen hatte, mit einem Hinweis auf den Monat und das Jahr.
»Haben Sie Scarlett gefunden?« Frau Bruhin bewegte sich nicht von ihrem Platz, verschränkte die Arme und blickte ihn an. »Gibt es endlich Neuigkeiten?«
Tomaso kommentierte es nicht. Er hatte gelernt, Fragen zu ignorieren. Wenn jemand fragte, dann war er es. »Dürfen wir eintreten?« Er warf einen Blick in den von der Herbstsonne durchfluteten Flur. Innerthal lag über neunhundert Meter über Meer. Das Dorf am Wägitalersee blieb meistens vom Nebel verschont. Jetzt im November leuchteten die Farben besonders klar, die Häuser wie gezeichnet auf einer Postkartenidylle. Ein Mädchen verschwunden? Unmöglich.
»Haben Sie sie gefunden?« In Frau Bruhins Stimme lag kaltes Entsetzen. »Lebt sie?«
Tomaso betrat das Haus, welches unweit der Kirche Santa Katharina am Hang lag. Das Hausinnere wirkte einladend und verspielt. Der Küchentisch war aufgedeckt für drei Personen, mit geblümtem Porzellan, im Brotkorb befanden sich Croissants. Trotzdem lag über allem etwas Düsteres, nicht Ausgesprochenes, ein Hauch Melancholie. »Dürfen wir uns setzen?«
»Bitte.« Frau Bruhin wies auf die Stühle. Sie selbst blieb stehen und vermochte nicht zu verbergen, wie nervös sie war. Sie zupfte am Saum ihres unifarbenen Pullovers, bis sich ein Faden löste. »Sagen Sie mir die Wahrheit. Grundlos sind Sie nicht hier … Ist sie tot?«
Tomaso presste ein Rüschenkissen an die Lehne, ließ sich nieder. Seine Kollegin blieb stehen. Er kam sich hilflos und unfähig vor. »Wir haben sie nicht gefunden.« Er startete sein Tablet. Sie hatten Scarlett Bruhin im internen Datennetz der Polizei ausgeschrieben und aufgrund der erhobenen Daten in den sozialen Medien nach ihr gesucht. »Es gibt noch Fragen.«
»Das ist nichts Neues. Ich sehe einfach keinen Fortschritt.« Frau Bruhin ließ enttäuscht die Arme sinken. »Seit Tagen lässt man mich im Ungewissen.«
»Ihre Tochter ist bald volljährig«, ließ Tomaso die Bemerkung fallen und wusste im gleichen Moment, wie unangemessen und unsensibel sie war.
»Bald.« Frau Bruhin schnaubte. »Sie sagen es. Bald heißt nicht, dass sie es jetzt ist. Und solange sie unter meinem Dach lebt, trage ich die Verantwortung für sie. Haben Sie wenigstens eine Spur von ihr?« Sie wies auf das Tablet. »Oder was bedeuten Ihre Notizen?« Endlich setzte sie sich auf den Stuhl und fuhr sich mit der Hand über die Augen.
Tomaso kam sich schäbig vor. Vor gut einer Woche war eine völlig aufgebrachte Mutter an den Polizeihauptposten in Schwyz gelangt und hatte Meldung wegen ihrer verschwundenen Tochter erstattet. Eine erste Spur war im Sand verlaufen. Aktuell hatten sie nichts. Sie wussten auch nicht, ob es sich beim Verschwinden von Scarlett um ein Verbrechen handelte oder ob sie freiwillig untergetaucht war.
»Mum! Ist alles in Ordnung?«
Tomasos Blick wanderte zur Küchentür, wo sich ein junger Mann aufgebaut hatte.
»Das ist mein Sohn Paul. Ja, Liebling. Es ist alles in Ordnung. Sie sind wegen Scarlett hier.«
»In Ordnung? Scarlett ist verschwunden, und du nennst es ›in Ordnung‹?« Er wandte sich an Tomaso. »Meine Mum sitzt hier seit Tagen wie auf Nadeln.«
»Und du?« Tomaso sah ihn an. Er hatte die weichen Gesichtszüge seiner Mutter. Sein Körper war schlaksig und etwas ungelenk. Dunkle Stirnfransen verdeckten halb sein Augenpaar.
»Ich fuhr mit meinem Rad alle Wege ab, die Scarlett jeweils ging, bevor sie verschwand. Ich besuchte die Kneipen und Bars, in denen sie manchmal herumhing. Ich fragte mich zu Tode, das können Sie mir glauben.«
Jungen und Mädchen in diesem Alter verschwanden häufig und tauchten wieder auf. »Es ist nicht so, dass wir eine Vermisstenmeldung ignorieren. Aber auf Panik machen wollen wir nicht.«
»Ich hatte einen etwas anderen Eindruck«, wehrte sich Frau Bruhin. »Ich machte Ihren Kollegen klar, dass meine Tochter mir immer eine Message hinterlässt, wenn sie später als vereinbart nach Hause kommt. Man vertröstete mich, ich solle mich noch ein wenig gedulden.«
Paul setzte sich an den Tisch. »Mum, du kennst doch Scarlett. Wenn sie wütend ist, dann sieht sie rot. Es war nicht das erste Mal, dass sie von zu Hause weglief.«
»Erklären Sie mir das näher, Frau Bruhin.« Tomaso fiel auf, wie sich Paul in Widersprüche verstrickte.
»Das ist so, aber nach einem Tag war sie stets zurück. Jetzt sind bereits neun Nächte und acht Tage vergangen, an denen wir kein Lebenszeichen von ihr erhalten haben. Ihr Handy ist aus. Und sagen Sie nicht, sie könnte bei einer Freundin oder einem Freund sein. Wir haben alle Möglichkeiten bereits geprüft. Scarlett ist wie vom Erdboden verschluckt worden. Ich habe den Eindruck, Sie nehmen mich nicht ernst.«
Tomaso versuchte, bei den Fakten zu bleiben. »Da steht, dass Sie geschieden sind.«
»Was hat das damit zu tun?«
»Könnte Ihre Tochter bei Ihrem Ex-Mann sein? Oder ihren Großeltern oder anderen Verwandten?«
»Seit acht Tagen, Herr Cavadini, und seit neun Nächten vermisse ich meine Tochter«, erwiderte Frau Bruhin. »Wäre das Kind einer Berühmtheit verschwunden, würden Sie gewissenhaft nach ihm suchen. Wir sind bloß einfache Leute in einer Zweiklassengesellschaft, und man lässt es uns immer wieder spüren.«
Tomaso warf seiner Kollegin einen verzweifelten Blick zu. Trost spenden war nicht seine Stärke, und wenn er angegriffen wurde, nahm er es persönlich. In der Fahndung war er per Zufall gelandet, weil vor zwei Jahren Personalmangel geherrscht hatte. Man hatte ihn vom Wachdienst in Schwyz als sogenannte Überbrückung nach Biberbrugg geholt. Als die Stelle weiterhin unbesetzt war, entschied er sich zum Bleiben. Er belegte Kurse und arbeitete sich in die Materie ein.
Frau Bruhin mäßigte sich. »Wir haben auch mit meinen Schwiegereltern gesprochen. Scarlett war nicht dort, auch nicht in einem Spital oder so. Mein Ex-Mann sucht auch nach ihr, und glauben Sie ja nicht, er könnte mir ihre Anwesenheit bei sich verschweigen. Wir sind zwar geschieden, aber reden ab und zu miteinander, vor allem über die Kinder.«
»Die Chance, dass ein vermisstes Mädchen nach einer Woche wieder zum Vorschein kommt, verringert sich von Tag zu Tag«, sagte Paul und leerte eine Mischung aus Getreideflocken in die Schale vor ihm. Er goss Milch dazu, bevor er den Mix umrührte und den Löffel hineinsteckte.
Tomaso sah ihm eine Weile zu, während er innere Bilder an sich vorüberziehen ließ. Zwei Kinder im Alter von sechzehn und siebzehn, eine nervös wirkende Mutter, die möglicherweise kämpfte, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Warum hatte er das Gefühl, hier fehlte es, trotz der romantischen Einrichtung, an Herzlichkeit? War Frau Bruhin so durch den Wind, dass ihr Inneres erstarrt war? »Schildern Sie mir die Situation, als Sie Scarlett zum letzten Mal gesehen haben.« Tomaso legte sein Tablet auf den Tisch.
»Warum? Ich habe alles gesagt, was ich weiß.«
»Vielleicht ist Ihnen noch etwas eingefallen, das wichtig für uns ist.«
Frau Bruhin strich sich die Haare nach hinten. In dieser Geste lag pure Resignation. »Das war vorgestern vor einer Woche, am Donnerstag. Wir saßen um den Küchentisch. Wir hatten gegessen und tranken Tee … ich wiederhole mich.«
»Wie war Ihre Tochter?« Fragen halfen Tomaso aus dem Dilemma. Er schämte sich, weil er keine Neuigkeiten hatte und er die Mutter der Verschwundenen nicht zu trösten vermochte. Wenn er es noch gekonnt hätte, es hätte nichts genützt.
»Ein wenig nervös. Aber das ist sie immer, wenn am andern Tag Prüfungen anstehen. Sie sagte, sie müsse wahrscheinlich die ganze Nacht lernen, um eine genügende Note zu holen.«
»Trotzdem ist sie ausgegangen?«
»Das wusste ich nicht. Nach dem Essen kehrte sie in ihr Zimmer zurück. Ich wähnte sie dort. Als es halb elf war, ging ich nach oben, um ihr eine gute Nacht zu wünschen. Sie war nicht da.« Frau Bruhins Stimme stockte. »Mir fällt ein, dass sie in letzter Zeit oft wie abwesend war. Mit ihren Gedanken anderswo. Sie kam später als gewöhnlich von der Schule zurück, schrieb mir aber immer eine Nachricht. Wenn ich sie nach dem Grund fragte, verschloss sie sich. Sie besucht in Lachen die Kaufmännische Berufsschule. Sie ist im zweiten Lehrjahr, nachdem sie nach dem neunten Schuljahr ein Zwischenjahr eingeschoben hatte.« Frau Bruhin hielt inne. »Das habe ich alles Ihrem Kollegen erzählt. Tun Sie endlich etwas. Finden Sie meine Tochter!«
»Ein Zwischenjahr? Ging sie auf Reisen?« Tomaso hatte schon oft von jungen Leuten gehört, denen die schulischen Pflichtjahre zu viel geworden waren und die sich eine Auszeit gönnten, bevor sie das Studium begannen oder in die Berufslehre einstiegen.
»Sie hören nur, was Sie wollen. Ich sagte …« Frau Bruhin winkte ab. »Ich schickte sie in die Westschweiz, um Französisch zu lernen. Wie ich damals …« Ihre Lippen umspielte kurz ein Lächeln.
»Kam sie verändert zurück?«
»Hm … wenn Sie mich so fragen. Natürlich hat sie sich in dem einen Jahr verändert, ist fraulicher geworden, auch reifer, wenn Sie das meinen. Aber mir fiel es positiv auf.« Ein Schluchzen schüttelte ihren Körper.
Tomaso fragte nach der Familie, dem Ort, der Dauer und in welcher Schule Scarlett gewesen war.
»Sie lebte bei einer jungen Familie mit drei Kindern. Zweimal pro Woche ging sie zum Unterricht.« Frau Bruhin erhob sich und schritt zum Küchenschrank. »Zum Glück schreibe ich die Ereignisse jeweils in den Kalender.« Sie holte aus einer Schublade mehrere kleine Bücher, sah sie durch und legte zwei davon auf den Küchentisch. Sie nahm das erste Buch, welches mit »2021« beschriftet war, und blätterte es durch. »Hier … Scarlett reiste am 20. August 2021 nach Verbier und«, sie griff nach dem zweiten Buch mit dem Titel »2022«, »kehrte am 30. Juni im Jahr darauf zurück.«
»Hat sie noch immer Kontakt zu den Leuten, bei denen sie lebte?« Tomaso notierte den Namen und die Adresse der Gastfamilie.
»Sie ist, glaube ich, nicht so erpicht darauf. Scarlett hat durchblicken lassen, dass sie dort ziemlich ausgenutzt wurde. Sie war erst fünfzehn, als die Familie sie aufnahm. Aber sie scheuten sich nicht, ihr die drei Kinder unter die alleinige Obhut zu geben, wenn Monsieur und Madame arbeiteten. Scarlett musste den Haushalt machen und kochen und gleichzeitig drei Kleinkinder in Schach halten … und das für mickrige siebenhundert Franken im Monat.«
»Das hätte sie bei der zuständigen Stellenvermittlung melden sollen«, brachte sich Tomasos Kollegin ins Gespräch.
Frau Bruhin sah sie mit leicht geneigtem Kopf an, realisierte augenscheinlich erst jetzt, dass es da eine zweite Person gab. »Scarlett hatte sich auf ein Inserat beworben. Es gab also keine Rückendeckung. Das, was sie gemacht hat, hat mit dem Modell des zehnten Schuljahres, wie es heute in der Westschweiz angepriesen wird, nichts zu tun.«
Blauäugig, dachte Tomaso. »Aber im Sommer darauf ist Scarlett wohlbehalten zurückgekommen.«
»Ja, und, wie schon erwähnt, erwachsener. Es hat ihr nicht geschadet, eine Zeit lang untendurch zu müssen. Unsereins musste es auch.«
Wie die Mutter, so die Tochter. Vielleicht war Scarlett den Fängen ihrer Mutter entflohen, hatte sich von deren Projektionen gelöst. Tomaso hätte es verstanden. »Hat Scarlett Probleme in der Schule?«
»Sie gehört zu den mittelmäßigen Schülerinnen. Ihre Probleme sind Sprache und Mathematik. Dagegen ist sie im Zeichnen sehr gut, aber das bringt ihr nichts, ist kein Fach im KV.«
»Hat Ihre Tochter etwas mitgenommen?«
»Natürlich, ihre Tasche und den Mantel. Ich …« Frau Bruhin warf wiederum einen zerknirschten Blick zu Paul. »Du hast doch gesagt, dass ihre Tasche fehlt.«
Paul nickte.
»Hatten Sie Streit mit Ihrer Tochter?« Tomaso streckte seinen Rücken. Trotz des Kissens schmerzte sein Kreuz. Das hier hatte er nicht gesucht. Er hatte von oben die Order bekommen, sich die Geschichte wegen der vermissten Scarlett Bruhin noch einmal anzuhören. Am Abend des 2. Novembers war das siebzehnjährige Mädchen spurlos verschwunden. Eine erste Vermisstenmeldung war drei Tage später in den Medien erschienen. Landesweit wurde nach der jungen Frau gesucht.
»Das Übliche«, insistierte Frau Bruhin. »Ich muss mir von meinen Kindern nicht alles gefallen lassen.« Sie stöhnte auf. »Hätte ich gewusst, dass sie sich Minuten später davonschleicht, hätte ich sie besser kontrolliert.«
Genau unter dieser Kontrolle musste Scarlett gelitten haben und war vielleicht deshalb ausgebüxt. Tomaso erhob sich und schritt zum Fenster. Der Blick auf den Wägitalersee war atemberaubend. Wie ein dunkelblaues Juwel lag er zwischen den Bergen. Die rot und orange verfärbten Bäume spiegelten sich. »Was für eine Aussicht.«
»Wie man’s nimmt.« Frau Bruhin war ebenfalls aufgestanden und kam an seine Seite. »Früher war der Wägitalersee ein Seelein mit einem Badehaus in der Nähe der Hundlochquelle. Meine Urgroßmutter mütterlicherseits war dort als Wäscherin tätig. Dann kamen die Zürcher und wollten eine Staumauer bauen. Ein ganzes Dorf wurde dabei zerstört. 1924 sprengte man die Kirche und flutete das Badehaus. Für die Einwohner von Alt Innerthal war es eine Katastrophe. Man hatte sie buchstäblich aus ihren Häusern vertrieben, die zum Teil abgetragen und an erhöhter Lage wieder aufgebaut wurden. Viele von ihnen wurden jedoch im Wasser versenkt. Das Haus, in dem wir nun wohnen, wurde von den Zürchern finanziert. Es ist ein Generationenhaus. Aber die Kirche, die gibt es so nicht mehr. Wohl entstand ein neues Gotteshaus, aber ich glaube, es ist mit einem Fluch belegt. Ich gehe dort nicht hin.«
Tomaso musste ein paarmal leer schlucken. »Leben Ihre Eltern unter dem gleichen Dach?«
Frau Bruhin seufzte. »Sie sind während der Pandemie gestorben.«
Hinter seinem Rücken räusperte sich seine Kollegin. »Wir sollten gehen.«
Tomaso war froh um diese Aufforderung. Er wandte sich noch einmal an Frau Bruhin. »Das tut mir leid.« Eine gebeutelte Familie. Das Schicksal hatte wiederholt gnadenlos zugeschlagen. Dies warf ein anderes Licht auf sie. »Wir werden nichts unterlassen, um Ihre Tochter zu finden. Und bitte, hören auch Sie sich um.«
»Was glauben Sie, was ich den ganzen Tag und die endlosen Nächte tue?«
»Notieren Sie, was Ihnen zu Scarlett einfällt, was wir nicht besprochen haben.«
Frau Bruhin drückte ihm die Hand, als hätte sie einen Schraubstock um seine Gelenke gelegt. »Finden Sie meine Tochter.«
***
»Ist da die Polizei?«
»Sie sind mit dem Polizeiposten Siebnen verbunden. Wie kann ich Ihnen helfen?« Wachtmeister Züger sah auf den Monitor vor ihm. Soeben war er schachmatt gesetzt worden. Das hinderte ihn nicht daran, in den vor Fett triefenden Berliner zu beißen.
»Sie müssen sofort … Es ist etwas Schreckliches passiert.« Eine weibliche Stimme. »Kommen Sie zur ›Spukvilla‹ zwischen Wangen und Tuggen. Bitte beeilen Sie sich.« Sie teilte die Adresse mit.
Züger notierte mit der rechten Hand den Straßennamen und die Nummer, während er mit der linken Korporal Egloff an seine Seite winkte. Vom Pfannkuchen stob Zuckerstaub auf. Vor zwei Stunden hatten sie ihren Dienst auf dem Polizeiposten im Außenbezirk von Siebnen angetreten, den Samstagsdienst, den niemand gerne mochte. Samstage waren wie die Sonntage, lang und trostlos und meistens dazu da, Pendenzen abzuarbeiten. »Wo befinden Sie sich?«, fragte er mit vollem Mund, während Konfitüre auf das Pult tropfte.
»Im Flur …«
»In welchem Flur? Geht es genauer?« Züger schniefte und verdrehte die Augen, was Egloffs Interesse weckte.
»Bitte beeilen Sie sich.«
»Bleiben Sie, wo Sie sind. Sie sind also im Flur dieser Villa? Wir werden jemanden hinschicken. Und nennen Sie mir bitte Ihren Namen.« Es klickte in der Leitung. Züger behielt den Hörer eine Weile am Ohr, als könnte er die Anruferin zurückholen, allein durch seine Gedanken. Doch sie war weg. Nur ein nerviger Ton blieb hängen.
»Kennst du die Spukvilla in Tuggen?« Züger starrte auf die Fensterscheibe, die sein Büro vom Rest der Welt abtrennte. Die Gebäude gegenüber versanken in einem umbrabraunen Licht. »Ich selbst erinnere mich vage an ein Geisterhaus. Aber ist es dasselbe?«
»Ich war noch nie dort, aber ich weiß, um welches Haus es geht. Es steht seit Jahren leer. Man wollte es abreißen, aber der Denkmalschutz hat sich gewehrt. Wegen Belle Époque oder so.« Egloff hatte sich das Halfter mit der Pistole umgebunden. »Ich nehme an, das ist ein Einsatz für mich. Ich werde die Streife auf dem Weg aufbieten. Bernie und Kurt schieben Verkehrsdienst.«
»Ich komme mit. Die Streife brauchen wir nicht.« Für Züger hatte nie nur ansatzweise eine andere Option bestanden. Endlich kam Bewegung in den Morgen, der bis anhin einschläfernd auf ihn gewirkt hatte. Das Schachspiel mit dem unbekannten Gegner war bloß zum Zeitvertreib. Er vergewisserte sich, dass seine Pistole am Gurt befestigt war, schob gleichzeitig sein Hemd in die Hose und regte sich über seine Wampe auf. In den Frust essen war nicht gut für die Linie. Herrgott, vor einem Jahr hätte er dies nicht zugelassen, obwohl seine Ehe schon damals auf der Kippe stand.
Etwas Schreckliches sei passiert. In der Stimme der Anruferin hatte so viel Verzweiflung gelegen, wie er sie kaum zuvor bei jemandem gespürt hatte. Er hatte davon gelesen, von diesem Haus in der Nähe des Kieswerks. Damals, als es von einer Erbengemeinschaft veräußert worden war. Man munkelte, es seien absonderliche Dinge darin geschehen. Was genau, hatte Züger nie erfahren. »Belle Époque. Das war um die vorletzte Jahrhundertwende, oder?«
»Nehmen wir meinen Wagen?« Egloff überging die Bemerkung seines Kollegen, zog sich die Jacke an und setzte die Mütze auf.
Züger kniff den Mund zusammen, warf einen Blick auf die Wanduhr, die seit Jahr und Tag dort tickte. Einmal in der Woche musste sie um fünf Minuten zurückgestellt werden, was der Aspirant erledigte. Dieser saß an seinem Platz, würde für die nächsten Stunden den Telefondienst übernehmen. Es war ein Viertel nach zehn.
Züger sah wieder zum Fenster, auf den schmalen Streifen Himmel über den Hausdächern. Es war neblig, wie die Tage zuvor. Ab und zu drang ein Sonnenstrahl durch das Grau.
Sie gingen zu Fuß nach unten, weil der Aufzug außer Betrieb war. Man müsse an allen Ecken und Enden sparen, hieß es. Der Polizeiposten in Siebnen rentierte nicht. In eine Renovation zu investieren lag nicht drin. Das war nicht nur die Meinung der zuständigen Behörde.
Draußen schlug ihnen ein unangenehmer Wind entgegen. Egloff ging zügig zu seinem Wagen, einem ausgedienten weißen Subaru, den er für nichts auf der Welt wieder hergeben wollte, ein Streifenwagen, der ihn bislang nicht im Stich gelassen hatte. Widerwillig ließ sich Züger auf der Beifahrerseite nieder. Der Sicherheitsgurt klemmte wie üblich. »Wann lässt du deine Karre endlich flicken?« Dass der Subaru das Vorführen bei der Motorfahrzeugkontrolle in diesem Frühjahr noch bestanden hatte, konnte niemand nachvollziehen.
Egloff drehte den Schlüssel. Der Wagen sprang an und scharrte im Getriebe, als er ihn vom Parkplatz auf die Stachelhofstraße fuhr. Er betätigte das Martinshorn. »Wie geht’s Lisa?«
»Ist das eine rhetorische Frage?« Züger sah geradeaus, auf die fast leere Straße. Der Samstagmorgen schien die Hektik und den Lärm unter der Woche geradezu zu kompensieren. Aber in dieser Ecke des Kantons ging sowieso alles ein wenig ruhiger vonstatten. »Sie ist ausgezogen.« Er zögerte. »Willst du das Horn wirklich eingeschaltet haben?«
»Man soll uns nur hören, auch die Langschläfer, wenn wir am Wochenende arbeiten müssen.« Egloff gab Gas. »Was ist mit Lisa?«
»Wir haben uns nichts mehr zu sagen.«
»Ist es so schlimm?«
»Willst du mich aushorchen?« Züger war es nicht recht. Egloff war zwar sein Freund, aber wenn es um Lisa ging, beschränkte sich sein Mitteilungsbedürfnis auf das Wesentliche. Lisa hatte da keinen Platz. Das Letzte, was sie vor einer Woche zu ihm gesagt hatte, fühlte sich noch immer wie eine Ohrfeige an. Ihre Worte waren genauso unerwartet auf ihn hereingeklatscht wie eine kalte Hand, die einen roten Abdruck auf seiner Wange hinterließ. Sie habe ihn nie geliebt, hatte sie ihn angeschrien. Es sei ein Fehler gewesen, ihm vor zwölf Jahren ins nordöstliche Kaff im Kanton Schwyz gefolgt zu sein. Immerhin hatte sie es zwölf Jahre neben ihm ausgehalten und von seinem Lohn profitiert. Zum Arbeiten außerhalb der Wohnung fand sie sich zu schade.
Sie rasten schweigend Richtung Wangen, an grauen Feldern entlang, vorbei an fast nackten Bäumen mit dem letzten bunt gefärbten Laub, wie eine Hommage an den vergehenden Herbst, ein untrügliches Zeichen dafür, dass alles vergänglich war. Bei der Loreto-Kapelle kreuzten sie die Autobahn über eine Brücke, kamen vorbei an Häusern bis zum Kieswerk. Aufgeschürfte Erde, einzelne Höfe und ein Stück Wald vervollständigten das Bild einer einsamen Gegend. Egloff zweigte links ab auf die Straße, die nach Girendorf führte. Der Wagen schwankte bedenklich, während die Reifen quietschten. Ein Jogger kam ihnen entgegen, ein paar Meter weiter hinten ein alter Mann, der stehen blieb und ihnen nachsah.
»Wir könnten heute Abend in die Frohsinn-Bar gehen«, sagte Egloff und setzte dem Schweigen ein Ende. Offenbar wollte er etwas gegen Zügers Stimmungstief unternehmen.
»Warten wir ab, was sich heute ergibt.« Nach Feiern war ihm seit einer Ewigkeit nicht zumute. Der Besuch einer Bar hatte meist ein unkontrolliertes Besäufnis zur Folge. Irgendwie musste Züger sein Elend ertränken. Es war aber nicht die Lösung. Vielleicht würde Lisa wieder zurückkommen, wenn er um sie kämpfte. Meistens morgens überwog die Hoffnung, am Abend wurde sie vom Zweifel niedergewalzt.
Die Spukvilla lag am Ende eines Feldwegs, etwas versetzt neben einer Gruppe heruntergekommener Häuser, bei denen man nicht wusste, ob sie einmal zueinandergehört hatten. Baufällig sahen sie alle aus, zogen bestenfalls die Kids an, die an den aufgerissenen Wänden mit Spraydosen und Farbe ihre Wut auslebten. Ein Drittel der Fassaden war mit Graffitis besudelt. Ein Baugespann, sicher schon Jahre da und teils von Wind und Wetter in Schräglage gebracht, ließ vermuten, dass ein Bauvorhaben noch hängig war.
Eine überfüllte Abfalltonne versperrte die Durchfahrt zum Haus. Egloff umfuhr sie rasant und fluchte.
Das verwahrloste Haus fiel in der Umgebung nicht auf. Die Fassade schien in der Vergangenheit noch mehr gelitten zu haben. Trotz allem musste das Haus einmal sehr einladend gewesen sein. Noch zeugte ein breiter Eingang mit Reliefs von der einstigen Eleganz. Jetzt allerdings vergruben sie sich hinter wuchernden, verdorrten Rosenranken und ungeschnittenen Büschen, welche die Vorderseite zur Hälfte verdeckten. Die Natur hatte sich ihren Anteil zurückerobert, die historische Schönheit sowie die aktuelle Hässlichkeit verschlungen. Im ersten Stock schien sich ein Balkon mit Balustraden befunden zu haben, die abgetragen waren. Wie Skelette ragten die Streben ins Leere. Darüber das Stockwerk mit schmalen Fenstern, einige von ihnen durch Jalousien verschlossen. Ein rostiges Abflussrohr hatte sich von einer defekten Dachrinne gelöst. Wirklich baufällig, ging Züger durch den Kopf, und nicht sehr einladend.
Egloff fuhr in die Nähe des Eingangs neben einen Land Rover, der neueren Datums war. Er wirkte wie ein Fremdkörper vor der Kulisse einer verflossenen Epoche. »Bist du sicher, dass man dich von hier aus angerufen hat?« Egloff drehte den Zündschlüssel, worauf der Motor mit einem Seufzer erstarb.
»Überzeugen wir uns.« Züger verließ den Beifahrersitz. Er fotografierte das Nummernschild des Wagens mit seinem Smartphone und vergewisserte sich, ob die Motorhaube warm war. War sie nicht.
Aus der Nähe sah das Haus noch verfallener aus als aus der Ferne. Seine vielen Wunden wurden sichtbar. Sonne, Wind und Niederschläge hatten es zerfressen. Wie aufgeschürfte Haut lösten sich die Farbreste von den Mauern.
Züger ging zur Tür. Er fühlte sich in das Haus hereingezogen, in ein Interieur, das mehr als hundert Jahre überdauert hatte. Er griff nach seiner Pistole, einer Glock. Er wusste nicht, was ihn dahinter erwartete. Kein Laut war zu vernehmen außer dem aufgeregten Piepsen eines Vogels, der sich im sich lichtenden Dickicht eines alten Baumes verfangen hatte. Züger schaute nach oben, wo die arme Kreatur versuchte, sich durch ein unermüdliches Flattern zu befreien.
Die Tür war angelehnt. Züger stieß sie mit der Schulter auf.
»Polizei.« Er umfasste die Pistole mit beiden Händen, streckte sie nach vorn auf Achselhöhe. Vor ihm öffnete sich ein langer Korridor.
Egloff, der nach ihm ins Haus getreten war, suchte nach einem Lichtschalter, kippte ihn nach unten. Im Flur blieb es dunkel. Die einzigen Lichtquellen waren die Tür und ein offen stehendes Fenster gegenüber. Züger holte eine Taschenlampe hervor, die er sich in den Gurt gesteckt hatte. Standardausrüstung. Er knipste sie an und ließ den Lichtkegel über die Wände streifen.
Der Korridor sah nicht modern, doch sauber aus, was man hier zuletzt erwartet hätte. Im Salon war niemand.
»Wir wurden verarscht«, stellte Egloff verärgert fest. »Jemand hat sich einen Jux erlaubt, uns Polizisten aus einem geruhsamen Samstagsdienst zu reißen.«
»Genau, und ich habe mich von meinem Schachkollegen in Übersee matt setzen lassen.« Züger sah sich um, ohne den Salon zu betreten. Es machte den Anschein, als hätte sich vor Kurzem jemand darin aufgehalten. Ein Odeur von einem Parfum so flüchtig wie ein Schmetterlingsatem hing in der Luft, wo man Moder erwartet hätte. Das Innere des Hauses widersprach dem Eindruck der Außenansicht. Gepflegte Sessel, zwei Sofas und ein niedriger Beistelltisch, wenngleich aus einer vergangenen Zeit, verliehen dem Salon eine beinahe gemütliche Note. Das war aber auch alles. Vor der rechten Wand stand eine leere Vitrine. Auf dem Boden lagen Tücher, die einst zum Abdecken der Möbel gedient hatten.
»Sei still!« Züger drehte sich nach der Treppe um, die ein Geschoss höher führte.
»Ich habe nichts gesagt.« Egloff musterte ihn.
»Hörst du das auch?« Züger stieg die Wand entlang nach oben, hielt den Atem an und war auf alles gefasst. Er erreichte einen weiteren Flur, von dem ein paar Türen weggingen. Ob die unbekannte Anruferin diesen Flur gemeint hatte? »Pssst, da tönt Musik. Woher kommt die?«
Auf dem ersten Stock herrschte eine bleierne Stimmung, diesig und gespenstisch, und dort, wo der Lichtstrahl der Taschenlampe und das Licht von außen hinreichten, tanzten Staubpartikel in der Luft wie Plankton im Meer.
Auch Egloff hatte die Etage erreicht. Er ging die Wände entlang, öffnete die erste Tür. Züger befand sich hinter ihm, lauschte, vergaß zu atmen. Die Stille im Haus bedrückte ihn, verhieß nichts Gutes. Die Ruhe vor dem Sturm? Die Musik war so schnell weg, wie sie in seine Ohren gedrungen war. Vielleicht hatte Egloff recht, und man hatte sie veralbert. Oder man hatte sie in eine Falle gelockt.
Egloff ging in entgegengesetzter Richtung weiter. Züger gelangte in ein Badezimmer. Drinnen befand sich eine altmodische frei stehende Badewanne auf Goldfüßen, welche sich wie Klauen an einer flauschigen Langflorteppichvorlage festkrallten. Das einzig Intakte. Lavabo und Toilettenschüssel wiesen Risse auf. Der Spiegel war verschmiert. Hier waren außer Zweifel Vandalen am Werk gewesen.
Der Unterschied zwischen außen und innen wollte in Zügers Kopf keinen Platz finden. Hier musste erst noch jemand eingezogen sein und sich trotz des Chaos breitgemacht haben. Aber wer, um alles auf der Welt, war so verrückt, hier zu wohnen? Oft kam es vor, dass Jugendliche, von zu Hause ausgerissen, sich in solchen Häusern eine vorübergehende Bleibe suchten. Manchmal wurden abbruchreife Gebäude von Alternativen besetzt, was zu politischen Scharmützeln führte.
Züger verließ das Badezimmer in dem Moment, als vom andern Ende des Korridors ein heiserer Ausruf ertönte. Züger spurtete in die Richtung, aus der er gekommen war. Hinter der letzten Tür vernahm er wieder Musik, die von einem anderen Ton übertüncht wurde, ein Würgen, dann ein Husten. Kurz darauf torkelte Egloff aus dem Zimmer. Er wischte sich Erbrochenes vom Mund. Kraftlos und vornübergebeugt stützte er sich am Türbalken ab. »Geh da nicht rein! Verdammt! Erspar dir diesen Anblick.«
***
Seit Tagen hielt sich in Küssnacht der Nebel hartnäckig. Bäume und Sträucher standen wie konturenlose Wesen in dieser Trostlosigkeit. Es wurde auch am Mittag nie richtig hell. Im Rücken drückte das Rigimassiv, vorne der Vierwaldstättersee, den man von hier aus nicht sah. Aber er zog das Trübe geradezu an. November, der Monat der depressiven Stimmung, eine Nichtzeit zwischen dem vergehenden Herbst und dem beginnenden Winter. Valérie Lehmann hätte ihn am liebsten aus dem Kalender gestrichen.
Sie hatte es sich im Wohnzimmer mit einer Tasse Kaffee gemütlich gemacht und genoss den Besuch ihres Sohnes Colin. Eine schöne Abwechslung in ihrem ansonsten hektischen Polizeialltag. Eine Seltenheit. Colin streckte die Beine von sich, verschränkte die Arme hinter seinem Kopf, mit verwuschelter Frisur, und hinterließ den Eindruck, etwas auszuhecken. Keine fünf Minuten war es her, seit er geläutet hatte. Valérie hatte gerade Kaffee gemacht und war auf dem Weg ins Wohnzimmer, als Colin durch die unverschlossene Tür trat. Gut gelaunt und aufgedreht und zu einer Zeit, zu der er normalerweise noch schlief.
Nun saßen sie sich gegenüber, und Valérie fragte sich, was der Grund für die Euphorie ihres Sohnes war. Sie kannte ihn sonst als eher stillen Beobachter, der alle andern sprechen ließ, bevor er den Mund aufmachte. Seit zwei Jahren war er ausgelernter Informatiker. Die Stelle in Freienbach gefiel ihm, aber er liebäugelte, das wusste Valérie, schon lange mit der Polizeischule in Hitzkirch.
»Falls du etwas zu trinken möchtest, du weißt, wo der Kühlschrank ist.«
»Danke, später. Ich … ich muss dir etwas erzählen.« Er kam mit seinem Oberkörper nach vorn und stützte seine Ellenbogen auf den Oberschenkeln ab.
»Hoffentlich nichts Schlimmes.« Wie sehr sie ihren Sohn liebte, wurde ihr einmal mehr bewusst.
»Nein, ich gehe davon aus, du freust dich mit mir. Ich habe Emilio versprochen, es dir persönlich mitzuteilen.«
»Stopp, du hast es Emilio bereits gesagt? Was gesagt? Was? Und warum ihm zuerst?« Valérie war es gewohnt, hinter ihren Männern anzustehen. Die beiden waren wie ein eingeschworenes Team, was ihr zwar nichts mehr ausmachte. Zanetti und Colin verstanden sich einfach gut. Es hätte nicht besser sein können. Aber dass Colin Neuigkeiten vor allem Zanetti anvertraute, kam ihr oft in den falschen Hals.
»Ich habe eine neue Freundin.«
»Ach.« Ihre Augenbrauen verselbstständigten sich nach oben.
»Ist das alles, was du dazu zu sagen hast?« Colin verdrehte seine Augen. »Sie ist vier Jahre jünger als ich und studiert an der ETH Zürich im ersten Jahr Architektur. Du wirst sie mögen, wenn du sie siehst.«
»Ich freue mich für dich.« Valérie freute sich wirklich. Dass sie es nicht zeigen konnte, lag an Colins verflossener Liebe, dieser Angela, die ihr während ihrer Beziehung mit Colin ein echter Dorn im Auge gewesen war. Zu dominant, unverhältnismäßig viel älter als er, mit allen Attributen, mit denen eine schöne Frau nur gesegnet sein konnte.
Colin grapschte in seiner Gesäßtasche und holte sein Portemonnaie daraus hervor. Er öffnete es, zog ein Foto aus einem der Fächer und streckte es Valérie hin. »Et voilà, das ist Lea.«
Fast wäre ihr »Das ist ja noch ein Kind« über die Lippen gekommen. Im letzten Moment unterließ sie die Bemerkung. »Hübsch, ja, sie sieht sympathisch aus.« Brünett, blaue Augen, Schmollmund, kindlich. Auf beunruhigende Weise schön. »Ein älteres Foto?«
»Nein.«
»Ist sie denn schon volljährig?«, konnte Valérie sich dennoch nicht verkneifen. Kurz war der Verdacht aufgekommen, Colin hätte wie sein Vater ein Faible für mädchenhafte Frauen. Doch diese Vermutung versickerte im Angesicht der einstigen Beziehung zu Angela.
»Vor einem Monat ist sie achtzehn geworden. Wir haben ihren Geburtstag im Sertig gefeiert.« Colin setzte ein verschmitztes Lächeln auf. »Nur wir zwei. Ihre Eltern leben in Zürich und besitzen auf einem Maiensäß in der Nähe von Davos eine Hütte.«
»War es nicht zu kalt in dieser Jahreszeit?« Auch das noch, ein Maiensäß. Valérie spürte, wie kleine unbedeutende Dinge vor ihr emporwuchsen. »Dort oben wird es bereits geschneit haben.«
»Wir hatten Glück. Der Winter lässt dieses Jahr auch in höheren Lagen auf sich warten.«
»Und wann stellst du sie uns vor? Deine … deine Lea?«
»Wenn nichts dazwischenkommt, am nächsten Samstag.«
Ihr iPhone klingelte. Valérie nahm es vom Salontisch, sah, dass Zanetti sie suchte. Er hatte am Morgen früh das Haus verlassen, er habe im Büro zu tun, sei aber auf den Mittag zurück, damit sie gemeinsam etwas unternehmen konnten, hatte er ihr zwischen Tür und Angel mitgeteilt.
Valérie wischte über den Touchscreen und meldete sich.
»Es gibt Arbeit.« Zanettis Stimme klang belegt.
»Logisch, ist ja Wochenende.« Valérie erwiderte Colins fragenden Blick mit einem Schulterzucken. Dass sie in den meisten Fällen am Ende einer Woche ausrücken mussten, war wie ein ungeschriebenes Gesetz. »Wo?«
»Kurz vor Tuggen, in der Nähe des Kieswerks.«
»Und warum erfahre ich das von dir?«
»Ich habe das Ermittlungsverfahren eingeleitet. Gian Luca steht aber neben mir.« Zanetti räusperte sich. »Möchtest du ihn sprechen?«
»Nein, nicht nötig. Wir sehen uns.« Valérie bedauerte, ihren Sohn wiederholt enttäuschen zu müssen. Sie hob Schultern und Augenbrauen und kniff den Mund zusammen.
»Schon okay«, sagte Colin verständnisvoll.
»Wenn du jetzt losfährst, bist du in einer Stunde hier.« Zanetti teilte ihr die genaue Adresse mit.
»Geht es um Mord?« Seit dem Fall im letzten Winter waren sie bis heute verschont geblieben. Häusliche Gewalt, Prügeleien, Messerattacken, Angriffe aus dem Nichts heraus – aber keine Toten.
»Um …« Zanetti musste es sich offenbar überlegen, was er sagen wollte. »Ein Blutbad.«
***
Daniel Christen von der Notrufzentrale war im Begriff, in die Mittagspause zu gehen, als ihn ein Anruf erreichte. Ausgerechnet jetzt. Er hatte sich mit einer Kollegin verabredet. Zudem hatte er Hunger.
»Ich möchte eine Meldung machen.« Dem Klang nach zu urteilen, gehörte die Stimme einer älteren Frau.
Christen versuchte nach einem Notizblock zu greifen. »Wie ist Ihr Name?«
»Gisler. Frau Gisler.« Ungefragt teilte sie die Adresse mit, worauf Christen sie notierte. »Der Briefkasten von Lisette Britschgi wird seit einer Woche nicht geleert. Das kommt sonst nicht vor. Die junge Dame ist sehr gewissenhaft.«
»Alles der Reihe nach, Frau Gisler.« Christens Magen knurrte so laut, der Anruferin konnte es unmöglich entgehen. »Haben Sie bei ihr geläutet?«
»Ja, aber sie öffnet nicht.«
»Vielleicht ist sie in den Ferien.«
»Unmöglich, das hätte sie mir erzählt. Zudem steht es um ihre Finanzen nicht rosig. Die vermag im Moment keine Ferien zu machen, hat sie mir erst noch erzählt. Und der Coop hat ihr gekündigt. Sie ist jung, kommt mir manchmal etwas unbeholfen vor. Aber sie ist nett und geht für mich einkaufen. Wissen Sie, meine Beine tragen mich nicht mehr optimal. Im Haus gibt es keinen Lift.« Frau Gisler atmete heftig. »Könnten Sie jemanden herschicken? Ich mache mir Sorgen.«
Christen stieß Luft aus. Schon wieder jemand, der sich wichtigmachte. In letzter Zeit hatten ihn unzählige Anrufe erreicht von gelangweilten Rentnerinnen, die versuchten, ihre Zeit totzuschlagen. Tagein, tagaus saßen sie am Fenster oder inspizierten die Umgebung ihres Wohnorts und schlugen Alarm, wenn Alltägliches anders war. Dagegen musste er immer wieder staunen, wie leichtgläubig ebendiese Generation war, wenn es um Enkeltricks ging. Trotz vermehrter Prävention häuften sich die Fälle, und die alten Leute gingen den Betrügern gehörig auf den Leim.
»Sind Sie noch dran?«, fragte Frau Gisler.
Künstliche Arbeitsbeschaffung, sinnierte Christen. Und trotzdem musste man dem nachgehen. Unter fünfzig Fällen konnte einer ernst sein. »Ich werde jemanden vorbeischicken. Um wen geht es, haben Sie gesagt?«
»Um Lisette Britschgi. Sie ist siebzehn Jahre alt.«
Zwei
Valérie realisierte vorerst nicht, was sie sah. Die Szenerie kam ihr gestellt vor, wie ein dreidimensionales Gemälde. Vier Körper um einen runden Salontisch. Ihnen haftete etwas Puppenhaftes wie Eingefrorenes an. Sie saßen aufrecht, starrten in die Mitte mit vor Schreck aufgerissenen Augen. Jeder hielt etwas in seinem Mund, das wie eine Zigarre aussah. Ein Theater des Grauens. Eine Inszenierung.
Auf den ersten Blick.
Aber da war mehr, sehr viel mehr. Etwas Verstörendes, das jenseits des Begreifens lag. Etwas, das ein klar denkendes Gehirn nicht zu verstehen vermochte. Etwas abgrundtief Böses.
Die Halogenleuchten fluteten den Raum, was jedes Detail hervorhob. An der Decke ein Lüster, der nicht brannte. Glühbirnen, wie Edison sie erfunden hatte, Glasperlen dazwischen, die fünf Arme miteinander verbunden, Spinnweben wie filigrane Fäden. Valérie überwand sich, hinzusehen.
Da war Blut. Viel Blut. Am Boden, an der Wand hinter dem niedrigen Tisch, auf dem Tisch selbst, ein Muster ineinandergeflossener und verspritzter roter Farbe, wie das beklemmende Kunstwerk eines Menschen, der seiner kranken Seele hier Gestalt gegeben hatte. Mit den Händen, den Füßen, mit dem Herzschlag. Ein pulsierendes Ausschleudern aus vier Richtungen. Und dieser Geruch. Ein Mix aus Alkohol, Magensäure und menschlichen Ausscheidungen. Valérie würgte. Zäher, bitterer Speichel bildete sich in ihrem Gaumen und drängte nach außen. Sie wich einen Schritt zurück. Entsetzt über sich selbst und ihre Reaktion. Entsetzt über das Blutbad. Die Bilder überwältigten sie.
Valérie stand vor einer vierfachen Hinrichtung. Und das, was sie als Zigarren vermutet hatte, enthüllte sich bei genauerem Hinsehen als eine Art Holzpfähle, die den Toten in den Mund gerammt worden waren. Valérie vergaß alles, was sie in den letzten Jahren an Erfahrungen gesammelt hatte und dass man selbst in einer solchen Situation einen kühlen Kopf bewahren musste. Das war leichter gedacht als getan. Ein solches Massaker hautnah zu sehen und zu riechen war neu. Valéries Blick wanderte über die Gläser auf der Tischplatte, in deren Mitte sie einen Hundekopf ausmachte, ein pelziger Schädel, die Schnauze halb geöffnet und fletschend, die spitzen Zähne, als hätte das Tier vor seiner Enthauptung versucht, den Gegner anzugreifen. Valérie kniff die Augen zusammen, öffnete sie wieder, fokussierte das, was sie nicht für möglich hielt. »Was zum Teufel ist das?«
Niemand antwortete ihr. Die Beine der Leichen waren angewinkelt in der sitzenden Haltung, die Hosen bis zu den Knien hinuntergelassen. Dem Mann rechts, auf dessen Geschlecht Valérie den Blick zwang, vielmehr auf die blutverklebte offene Wunde, fehlten der Penis und die Hoden. Sie fehlten bei allen, was der rote See unter dem Tisch, die Tropfen und unzähligen Spritzer bewiesen, als hätte man sie bei lebendigem Leib verstümmelt. Wer immer das hier veranstaltet hatte, er hatte sich an der Blutorgie berauscht.
»Sie wurden alle entmannt«, sagte Louis hinter ihr. Valérie drehte sich zu ihm um. Was sie sah, waren Furcht und Unbehagen auf seinem Gesicht. »Ich hatte gerade ein Gespräch mit unseren Kollegen aus Siebnen, die sie gefunden hatten«, sagte er stockend. »Sie bekamen einen anonymen Anruf, den wir bislang nicht zurückverfolgen konnten.« Louis räusperte sich ein paarmal nervös. »Da muss jemand sehr wütend gewesen sein.«
Valérie taumelte in Richtung Tür. Dort stützte sie sich mit dem Rücken am Rahmen ab, ohne ihn mit der Hand zu berühren. Kalter Schweiß drang aus ihren Poren. Allein die Vorstellung, dass jemand einem Mann die Geschlechtsteile entfernt hatte, war dermaßen abartig. Durchatmen. Die Mitte finden. Ruhig werden. Konzentration auf sich selbst. Ein Mantra. »Om mani padme hum.«
»Was für eine Riesenschweinerei!« Louis nahm Valérie die Wörter aus dem Mund. »Das sieht schlimmer aus als in einem amerikanischen Hardcore-Thriller, entsetzlicher als David Finchers Film.« Ob Louis mit dieser Bemerkung den Schock überspielte? »›Seven‹ sagt dir doch etwas. Die Entmannung ist das eine, und der Hundekopf auf dem Tisch sieht aus, als hätten die Männer vor ihrem Tod … nein, ich darf nicht daran denken. Krank ist das, krank.«
Valérie griff sich an die Schläfe, rief sich ihre Fälle in der Vergangenheit ins Gedächtnis. Es war, als würde sie vom Abscheulichen verfolgt. Als sie vor achteinhalb Jahren die Stelle im Korps der Schwyzer Kriminalpolizei angetreten hatte, wurde sie gleich zu Beginn mit einem Fall betraut, der drei Todesopfer gefordert hatte. Neulich hatte man sie gefragt, wie viele tote Menschen sie im Zusammenhang mit ihren Ermittlungen habe beklagen müssen. Sie hatte die Anzahl genannt und kannte deren Namen. Solche Verluste vergaß man nicht. Zurück blieb immer das Gefühl des Versagens. Der Gedanke, man hätte etwas verhindern können, erschwerte das Aufarbeiten solcher Dramen. Manchmal half es Valérie, sich einzusuggerieren, dass sie noch mehr Opfer verhindert und Menschenleben gerettet hatte.
Sie schloss einen Moment die Augen. Bitte, lasse es nicht wahr sein. Wenn sie die Lider wieder hob, würde es ein ganz normaler Tag sein. Sie hatte vieles mit Colin zu besprechen. Sie wollte sich Zeit für ihn nehmen, ihm zuhören und das nachholen, was sie in den letzten Jahren nicht genug getan hatte. Ihre Beziehung war zwar wesentlich besser geworden, doch noch immer fehlte es Valérie an Zeit und Muße für ihren Sohn. Jetzt war er erwachsen, und sie hatte es heute wieder versäumt.
Louis holte sie in die Gegenwart zurück, als würde er einen Schleier von ihr wegnehmen, der sich dicht um ihre Seele gelegt hatte. »Dr. Stieffel ist da.«
»Was ist mit denen da?« Valérie wies von der Tür aus auf den Tisch, den Boden, an die Wand, wo eine Vielzahl an Kerzen stand, in hohen, schlanken Haltern. Das Wachs zeichnete bizarre Formen.
»Die hätten noch gebrannt, sagte Züger, einer unserer Kollegen, und ein Musikstück habe in der Wiederholung gespielt …«
»Und sie haben sie ausgelöscht? Schuler wird keine Freude haben … Was war da noch? Ein Musikstück?« Valérie fröstelte. »Eine Komposition?«
»Nicht von Wagner.« Louis verzog den Mund, als hätte er in eine saure Gurke gebissen.
Scheusal, dachte Valérie, obwohl ihr genau dieser Gedanke gekommen war. Ihr erster Tatort in Schwyz, die drapierte Leiche, Tannhäuser.
»Von The Black Eyed Peas: ›Shut up‹. Züger hat die CD gestoppt. Schuler hat sie eingepackt.«
»Sie könnte eine Bedeutung haben.« Valérie sah sich um. »Alles hier könnte eine Bedeutung haben.«
»Ach du liebe Scheiße, was für ein Gemetzel.« Stieffel zwängte sich an Valérie vorbei in die Folterkammer. Er trug einen sterilen Anzug und hatte weder Augen für Valérie noch für die Leute des Kriminaltechnischen Dienstes, die mit aller Sorgfalt die Spuren sicherten und Täfelchen mit Nummern platzierten, die auf Indizien hinwiesen.
Wenn sich der Gerichtsmediziner dermaßen unflätig ausdrückte, hatte dies weniger mit seinem Charakter zu tun als mit einer Art imaginärem Schutzschild, welchen er vor sich hielt. Anders war das hier nicht zu ertragen, auch für den resistenten Stieffel nicht. Er schüttelte ein paarmal den Kopf, bevor er sich den Leichen näherte. »Ach du liebe Scheiße.«
Valérie schnappte wiederholt nach Luft, ging zurück und sah ein zweites Mal auf die Toten. Gefasster. Manchmal bedurfte es, sich von der Realität abzugrenzen. Valérie versuchte, die Szene wie durch eine Brille zu betrachten. Sie bildete sich ein, sie sähe den Ausschnitt eines Films, was es erträglicher machte. Wäre nicht dieser Gestank gewesen.
Was war hier geschehen?
Während Franz Schuler mit seinem Team schweigend arbeitete, betrachtete Valérie erneut das Gesamtbild. Ein Tisch mit vier ockergelben Ohrensesseln, deren Stoff das Blut aufgesogen hatte. Die Männerkörper waren mit Seilen daran befestigt. Seemannsknoten, fiel ihr auf. In einem früheren Leben hatte sie Bekanntschaft damit gemacht.
Louis trat an ihre Seite.
»Der Täter hat sie alle mit dem gleichen Knoten am Sessel befestigt.« Valérie nickte in Richtung des Toten, der sich ihr am nächsten befand. »Der Palstek, siehst du das?« Sie wies auf zwei der vier Fauteuils. »Zudem sind es ziemlich dicke Seile, die er dazu verwendet hat, über den Daumen eineinhalb Zentimeter Durchmesser.« Taue, um die Taille der Toten gebunden und ebenso um deren Hals, je vier Stränge, die an der Rückenlehne festgezurrt waren. Daher der aufrechte Sitz. »Da waren mehrere am Werk«, sinnierte sie laut. »Oder man hat ihnen vorher etwas eingeflößt.« Ihr Blick blieb an den langstieligen Gläsern hängen, in denen Reste von Wein waren. »Der Inhalt muss ins Labor. Gibt es Kampfspuren?«
Schuler machte den Weg für Stieffel frei. »Sie können mit Ihrer Arbeit beginnen. Wir sind im näheren Umfeld der Toten so weit fertig mit der Spurensicherung.« Er machte Fotos, der Auslöser der Kamera klickte im Sekundentakt, und zog sich vom runden Tisch zurück. »Wenn Sie fertig sind, würden wir uns dann gern dem Rest widmen.« An Valérie gewandt sagte er: »Keine Kampfspuren. Es sieht danach aus, als hätten die Opfer das Desaster über sich ergehen lassen.«
»Habt ihr die Geschlechtsteile der Opfer irgendwo gesehen?« Stieffel sah kurz auf. Schwer zu sagen, wen er angesprochen hatte.
Niemand erwiderte etwas.
»Kann ich beginnen?« Stieffel nahm sein Diktiergerät in Betrieb und beugte sich über den Toten unmittelbar neben der Tür. »Erstbeurteilung der Leichenlage.« Er stoppte, runzelte die Stirn, als wollte er das hier nicht glauben, bevor er fortfuhr. »Rücken gestreckt …«
Valérie hörte mit halbem Ohr zu, schnappte das Alter der geschätzten vierzig Jahre auf und schließlich: »Alkoholisierung gering, keine weiteren Auffälligkeiten.«
Stieffel richtete seinen Körper auf. »Die Leichen müssen auf den Seziertisch. Unter den gegebenen Umständen ist eine vollständige Legalinspektion nicht möglich. Ich werde die Totenscheine erst nach Bestätigung der Identität der Toten ausstellen.« Er widmete sich der zweiten Leiche.
Schuler sah Valérie kritisch an, nachdem er sie eine Weile angestarrt haben musste. »Alles okay?«
Valérie wandte ihren Blick von Stieffel ab und Schuler zu. Nein, war es nicht. Die Ordnung zerfiel in dem Moment, als Valérie bewusst wurde, was hier tatsächlich geschehen war. Ein Vierfachmord im Kanton Schwyz, in einer Gegend, in der man eine solche Abschlachtung zuletzt vermutete. Nichts anderes war es, ein Blutvergießen, wie es nur ein Psychopath hatte anrichten können. Sexuell motivierte Morde, ging ihr durch den Kopf, oder eine Bluttat, die auf etwas Sexuelles hindeutete. Eine rituelle Handlung? Henry Vischer, der Polizeipsychologe, würde es vielleicht bestätigen. Noch war er nicht da, und Valérie zog ihre eigenen Schlüsse. Die amputierten Penisse und Hoden, die Pfähle in den Mündern. Der abgetrennte Hundekopf. Das alles musste etwas bedeuten.
Valérie spürte eine Berührung auf ihrem Arm. Sie wandte sich brüsk um, hatte ihn nicht erwartet. »Emilio!«
Die Situation machte ihn verletzlich. Sie wäre dennoch am liebsten in seine Arme gesunken, hätte sich von alldem hier distanziert. Sie war Polizistin, eine Ermittlerin, es war ihr Beruf, ihre Berufung. Aber sie war nicht dazu geboren worden, ein solches Blutvergießen zu ertragen. »Sie sind jünger als wir.«
»Ich weiß.« Zanetti wies auf vier Ausweise, die in Asservatenbeuteln steckten. »Diese lagen auf dem Tisch, als wollte der Täter, dass man sofort sieht, wer die Opfer sind.«
»Und?« Valérie zog sich Vinylhandschuhe über, froh um jede Ablenkung. Sie hatte sich einen Cremebalsam mit ätherischen Ölen um die Nasenhöhlen gestrichen, um den Geruch auszuhalten. Jedes Mal war das Betreten eines Tatorts eine Tortur. Jeder Leichengeruch war anders, konnte mit nichts verglichen werden.
Zanetti reichte ihr die Ausweise. Sie sah die Identitätskarten der Reihe nach an. »Mettler-Jenni Matthias, geboren 1980, Fuchs Jan, 1981, Hurni-Fischer Oliver, 1979, und Grüniger Nils, 1981.« Valérie rief Louis an ihre Seite. »Anhand dieser Ausweise müssen wir sofort die Adressen ausfindig machen. Bitte übernimm du das.« Sie zögerte. »Und bitte achtsam. Die Ausweise sind mir zu wenig sicher. Wir werden nicht darum herumkommen, eine Identifikation durch die Angehörigen vorzunehmen, oder wir warten die DNA-Tests ab.«
Sie beobachtete, wie Stieffel dem einen Toten den Pfahl vorsichtig aus dem Mund entfernte, was sich als schwieriges Unterfangen herausstellte. Stieffel kommentierte seine Handlung, sprach erneut auf Band. »Das Kiefergelenk lässt sich nicht verschieben. Die Leichenstarre ist ausgeprägt. Der Tod muss vor sechs bis acht Stunden eingetreten sein …« Er hob den Pfahl gegen das Licht. »Kennt jemand die Bezeichnung dafür?«
Valérie fuhr zusammen, als sie es erkannte. »Das ist ein Leckpfropfen.« Sie musste leer schlucken, während eine Abfolge von Bildern durch ihr Gehirn schoss. »Man verwendet ihn zum Stopfen von Lecks auf Booten.«
»Er ist konisch.« Stieffel drehte das Holzteil vor seinen Augen herum, als würde er nach etwas suchen.
»Es gibt verschiedene Sorten. Die einen sind stumpf, die anderen spitzig.«
»Und warum bist du dir so sicher?«
Sollte sie Stieffel erzählen, dass ihr Ex-Mann ein eigenes Boot besessen hatte? Valérie ließ es bleiben. Dieses Thema gehörte hier nicht hin. Sie selbst war nie gern auf dem Boot gewesen. Nicht, weil sie das Wasser scheute. Aber Willy Lehmann hatte sie herumkommandiert, Lehrer gespielt und sie gemaßregelt, wenn sie einen falschen Handgriff tat. »Ich weiß zufällig, dass es zur Standardausrüstung auf einem Segelboot gehört.«
»Ihr hattet doch eine Yacht.« Louis brachte sich ein.
»Willy hatte eine, das ist ein Unterschied.« Valérie fragte sich, ob sie Louis einmal davon erzählt hatte.
Louis merkte offenbar, dass die Erwähnung ihres Ex-Mannes nicht erwünscht war. »Du redest von einem Palstek, ein Knoten, der in der Seefahrt verwendet wird, und willst nun ein weiteres Requisit erkennen, welches mit Schiffen in Zusammenhang steht?« Die Frage musste kommen. Louis’ Kombinierungsgabe schlug durch. »Was hat aber ein Hundekopf mit alldem zu tun?«
»Was haben diese Morde mit dem Segeln zu tun?«, erwiderte Valérie. Ihr kam es gelegen, sich dem Sachlichen zu widmen. Nach den anfänglich heftigen Emotionen versuchte sie, den klaren Gedanken mehr Platz einzuräumen.
Louis schien ebenso wie sie einen Anhaltspunkt zu suchen, einen Faden, an dem sie sich festhalten konnten. »Vielleicht will uns der Täter damit einen Hinweis geben.«
»Das scheint mir allerdings weit hergeholt. In welche Richtung denkst du? Jemand, der mit Schiffen zu tun hat, ein Schiff besitzt? Dies müsste sich eher auf die Toten beziehen. Aber das ist vorerst ein lautes Denken. Wenn wir die Opfer kennen, können wir eingrenzen.« Eine Idee, ein paar Worte, um dem Unbegreiflichen entgegenzuwirken. Valérie wusste selbst, wie schwierig es war, mit dem ersten Eindruck etwas anzufangen. Die Erstbegehung eines Tatorts war, als würde man ein unbeschriebenes Buch aufschlagen und darin die leeren Seiten mit all dem füllen, was sich an Bildern und Indizien bot. Mit Ausnahme der Bilder hatten sie nichts. Der Seemannsknoten und die Leckpfropfen konnten Hinweise sein, die man in Betracht ziehen musste, sich darauf zu versteifen war verfrüht. Der Hundekopf mit den glasigen, gebrochenen Augen passte nicht. Was sich ihr präsentierte, war wie der Beginn einer schockierenden Reise in die tiefsten Abgründe der menschlichen Seele. »Ich überlasse es dir, Louis, der Identität der Männer nachzugehen«, wiederholte Valérie. Sie sah auf die digitale Uhr auf ihrem iPhone. »Schon bald zwölf?« Das Vorhaben, mit Colin zu Mittag zu essen, musste sie sich abschminken. Sie hatte soeben den normalen Alltag verlassen und war in etwas Ungewisses und Unbekanntes eingetaucht. »Wir sehen uns um zwei im Sitzungszimmer des Stützpunkts.«
Sie verließ das Zimmer und ging auf den Flur. Neben dem Badezimmer lehnte sie an die Wand und betrachtete ein aufgehängtes Bild gegenüber. Nichts hier wollte zusammenpassen. Es sah aus, als hätte man über die Jahre vieles aus dem Haus entfernt und neue Objekte hereingetragen. Jugendstil vermischte sich mit Elementen aus den siebziger Jahren, und unten, wo das Wohnzimmer lag, sahen die Möbel eher nach Biedermeier aus. Den Zerfall der Hülle ließ das Intakte im Innern nicht zu. Unter Ausschluss des Badezimmers war hier vieles unversehrt, wenn auch mit einer Staubschicht überzogen. Selbst die Küche im Parterre machte den Eindruck, gut erhalten zu sein. Valérie kam zum Schluss, dass hier möglicherweise jemand oder Handlungen nicht entdeckt werden wollten. Ob es so war, würde die Spurensicherung an den Tag bringen.
Caminada erschien unter dem Türrahmen zur Küche, wo Valérie die Schränke begutachtete. Außer ein paar Gläsern stand nichts auf den Regalen. »Hallo, Valérie, gut, bist du da. Ich konnte bereits den Halter des Land Rovers draußen ausfindig machen. Er gehört Nils Grüniger, wohnhaft in Lachen.«
»Hi, Gian Luca. Nils Grüniger, sagtest du? Er ist eines der Opfer. Wir haben seine Identitätskarte.«
»Der Wagen kommt zum KTD nach Schindellegi.«
Valérie sah ihn nachdenklich an. Ihr war Caminadas ernstes Gesicht bekannt, aber im Moment versetzte seine Mimik sie in Angst und Schrecken. »Ich ahne, was dich bedrückt. Mir ergeht es nicht anders.«
Caminada schüttelte den Kopf. »Ich habe bereits eine Großfahndung ausgelöst. Ist vielleicht für die Füchse, denn der Täter könnte bereits über alle Berge sein. Und wonach wir genau suchen, ist zurzeit nicht bekannt. Da bräuchten wir mehr Informationen vom KTD.« Er fuhr sich nervös über die Stirn und berührte kaum spürbar Valéries Arm. »Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft werde ich dir den Fall übergeben.«
Valérie hatte es erwartet. Aber Colin musste wieder einmal hintenanstehen. Vielleicht würde er endlich von seinem Vorhaben wegkommen, zur Polizei zu gehen. Er musste ja sehen, welche unregelmäßigen Arbeitszeiten seine Mutter hatte. Und ungefährlich war der Job nicht. Er war schrecklich, hässlich, unbegreiflich. Colin war nicht geeignet für diesen Beruf, fand Valérie. Sie würde es ihm schon noch austreiben. »Okay, dann werde ich mal nach Biberbrugg fahren und die Sitzung vorbereiten. Solange die Spurensicherung im Gange ist, habe ich hier sowieso nichts mehr verloren. Bis um zwei sollten wir zudem die ersten Resultate aus der Rechtsmedizin haben.«
»Stieffel ist noch da. Kann er diese nicht gleich aushändigen, zumindest die ersten Eindrücke?«
»Ich glaube, es ist keine gute Idee, ihn unter Druck zu setzen.«
***
Die katholische Kirche Sankt Laurentius stach am frühen Nachmittag ungewöhnlich hell aus den Nebelschwaden wie ein leuchtender Quader in diesem diesigen Licht. Es mochte an der gelben Farbe liegen, mit der die Mauerelemente und Einfassungen von Tor und Fenstern gestrichen waren. Das 1885 erbaute Gotteshaus fiel anhand des prominenten Standorts auf. Es thronte auf dem Burghügel unweit der Hauptstraße, die durch Reichenburg führte, und war deshalb ein Wahrzeichen.
Yvonne Hurni war auf dem Weg zum Friedhof. Sie grüßte den Pfarrer, der über die Treppe kam, und tauschte ein paar Worte mit ihm. Vor zwei Wochen hatte er die Totenmesse für ihren Schwiegervater gestaltet, dessen Urne nun neben der seiner verstorbenen Frau stand, eingeschlossen in einer mit Astern geschmückten Mauer. Yvonne hatte es zu ihrer Aufgabe gemacht, die beiden Urnengräber zu pflegen. Seit ihre beiden Söhne in Lausanne studierten und bloß hie und da an den Wochenenden nach Hause kamen, hatte sie genug Zeit. Sie arbeitete fünfzig Prozent in der Metzgerei eines befreundeten Ehepaars, was ihr nicht die berufliche Befriedigung brachte, so doch die Gelegenheit, unter Leuten zu sein. Ihr Haus an der Landhofstraße hielt sie innen im Schuss, war es doch nebst dem Heim für eine vierköpfige Familie auch Treffpunkt für die Freunde ihres Mannes. Dann kochte und bewirtete sie und zog sich nach ausgeführter Arbeit gern in ihr eigenes Zimmer zurück, wo sie ihrem Hobby, dem Stricken, frönte. Jahrein, jahraus war gezeichnet vom gleichen Trott, Routine in allem, was Yvonne tat. Manchmal gut gelaunt und euphorisch, meistens miesepetrig, weil ein erfülltes Leben in ihren Augen anders aussah. Sie war zweiundvierzig und glaubte, die Zukunft habe ohne sie begonnen.
Ihr Handy klingelte. Sie griff danach, bat den Pfarrer um Entschuldigung. »Da muss ich ran«, sagte sie, obwohl sie die Nummer nicht kannte. Aber sie hatte kein Bedürfnis, sich noch länger mit dem Priester zu unterhalten. Er war ein redseliger Mann und erzählte gern Geschichten im Wiederholungsmodus. Sie wandte sich ab und nahm den Anruf entgegen. Mittlerweile hatte sie die Urnengräber erreicht. Sie mochte es, zwischen den Grabsteinen zu gehen und die künstlerischen Gräber zu betrachten, die gusseisernen Kreuze und selten schönen Steine, die man mit Hingabe beschriftet und gestaltet hatte. Die Blumen sahen noch frisch aus. Die kühle Luft und der Nebel hatten sie konserviert. »Yvonne Hurni.«
»Kantonspolizei Schwyz, Louis Camenzind.«
Polizei! Yvonne wunderte sich. War sie zu schnell gefahren? Die Radarkästen standen jeweils an den unmöglichsten Stellen. Bestimmt war sie geblitzt worden. »Worum geht es?«
»Ich müsste Sie sprechen.« Camenzind artikulierte langsam, als dächte er, die Wörter kämen nicht bei ihr an.
»Ich bin zurzeit auf dem Friedhof, kann aber in absehbarer Zeit zu Hause sein.« Yvonne musste schlucken. War etwas mit ihren Söhnen? Nein, sie schminkte sich die Bedenken gleich ab. Sollte sie zu schnell unterwegs gewesen sein, würde sie eine Rechnung aufgebrummt bekommen. Von dem Polizisten persönlich übergeben? Heutzutage war alles möglich. »In zehn Minuten, okay?«
»Ich warte vor Ihrem Haus.«