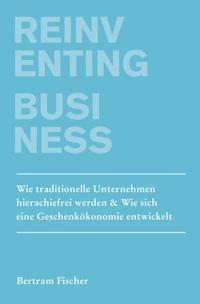Inhalt
Warum Unternehmen hierarchiefrei werden
Die Pionierphase
Die Pionierphase bei Lievegoed und Glasl
Die Pionierphase bei Laloux
Die Pionierphase bei Aristoteles
Einordnung der Pionierphase
Die Krise der Pionierphase
Die Differenzierungsphase
Die Differenzierungsphase bei Lievegoed und Glasl
Die Differenzierungsphase bei Laloux
Die Differenzierungsphase bei Aristoteles
Einordnung der Differenzierungsphase
Die Krise der Differenzierungsphase
Die Integrationsphase
Die Integrationsphase bei Lievegoed und Glasl
Die Integrationsphase bei Laloux
Einordnung der Integrationsphase
Die Krise der Integrationsphase
Die Assoziationsphase
Die Assoziationsphase bei Glasl
Die Assoziationsphase bei Laloux
Die Assoziationsphase bei Aristoteles
Einordnung der Assoziationsphase
Die Krise der Assoziationsphase
Die Hierarchiefreie-Phase oder Reinventing Organizations
Die Hierarchiefreie-Phase bei Laloux
Selbstorganisation
Ganzheitlichkeit
Unternehmenssinn
Die Hierarchiefreie-Phase bei Lievegoed im „Geistesleben“
Die Hierarchiefreie-Phase bei Aristoteles
Die Einordnung der Hierarchiefreien-Phase
Die Krise der Hierarchiefreien-Phase
Die Stakeholder-Phase oder Reinventing Supply-Chain
Unternehmensbeispiele der Stakeholder-Phase
Unternehmensbeispiel Premium Cola
Unternehmensbeispiel Selbstversorgergemeinschaft Schmitthof
Einordnung der Stakeholder-Phase
Die Krise der Stakeholder-Phase
Die Schenkungsphase oder Reinventing Business
Unternehmensbeispiele aus der Schenkungsphase
Die Schenkungsphase bei Aristoteles
Einordnung der Schenkungsphase
Die Krise der Schenkungsphase
Zusammenfassung und Ausblick
Über Reinventing Business
Beratung und Beiträge durch den Autor
Das Konzept unterstützen
Über Bertram Fischer
Impressum
Literatur
Warum Unternehmen hierarchiefrei werden
In den letzten Jahren gewannen vielfältige neue Formen von Wirtschaft und Zusammenarbeit an Bedeutung. Seien es hierarchiefreie Unternehmen wie Buurtzorg oder Morning Star, Stakeholder geprägte Konzepte der Zusammenarbeit wie eBay, airbnb, Uber oder BlaBlaCar oder „gegenleistungslose Unternehmen“ wie Wikipedia oder Couchsurfing. Diese neuen Organisationen wachsen mit großer Geschwindigkeit und verdrängen viele traditionelle Unternehmen. Sie schaffen innerhalb von Jahren, was traditionelle Unternehmen in Jahrzehnten nicht erreicht haben. So beschreibt „CNN Money“, wie sich airbnb in nur sieben Jahren zu einem globalen Marktplatz für Übernachtungen entwickelt hat, der bisher von mehr als 60 Millionen Menschen in 190 Ländern genutzt wurde. Und wie airbnb in dieser Zeit einen höheren Börsenwert als die anderen großen Hotelketten wie Hilton oder Marriott entwickelt hat. Die kostenfreie Internetplattform Wikipedia sorgte in Deutschland für das Ende fast aller analogen Enzyklopädien. So titelte die „NZZ“ im Januar 2014 „Es ist aus mit dem «Brockhaus»“. Es treten Unternehmen aus ehemals fremden Branchen in neue Konkurrenzbeziehungen, so deutet sich heute an, dass die Autoindustrie bald von der IT Branche mit einem selbstfahrenden Auto Konkurrenz bekommt. Eine solche Entwicklung war vor einigen Jahren noch undenkbar. Auch das erste Auto, das Open Source entwickelt wurde und dezentral von jedem selbst gestaltet und zusammengebaut werden kann, ist heute Realität. Der „Spiegel“ betitelte es als „Open-Source-Auto Tabby: Das Mitmach-Mobil“. Bald lässt es sich wahrscheinlich sogar mit einem 3D Drucker dezentral produzieren, wie es bei dem Open-Source-Auto „Strati“ schon in Ansätzen gelungen ist.
Wichtige Wissenschaftler wie der amerikanische Ökonom und Gesellschaftstheoretiker Jeremy Rifkin erwarten eine dritte industrielle Revolution - die „Digitale Revolution“ - die mit einer radikalen Umgestaltung unserer Wirtschaft und Organisationen einhergeht. Rifkin sagte dem „Spiegel“ (2014):
„Wir leben in besonderen Zeiten, denn wir können ein seltenes historisches Ereignis verfolgen: die Entstehung einer neuen Wirtschaftsordnung. Das hat es seit dem frühen 19. Jahrhundert nicht mehr gegeben, als der Kapitalismus auf der Weltbühne erschien. Nun aber wird dieses System selbst in seinen Grundfesten erschüttert, und der Grund sind der enorme technologische Wandel und seine Folgen [...] Wir sehen bereits jetzt die Entstehung einer hybriden Wirtschaft: zum einen ein kapitalistischer Markt, zum anderen ein neues System des Gemeinguts.“
Wie kann man diese neuen Wirtschaftsphänomene verstehen? Wo liegen ihre Möglichkeiten, Herausforderungen, Risiken und Chancen? Was charakterisiert diese neuartigen Unternehmen und was unterscheidet ihre Phasen der Organisationsentwicklung von denen Unternehmen, die Lievegoed und Glasl 1993 mit der Pionierphase, der Diversifikationsphase, der Integrationsphase und der Assoziationsphase beschrieben haben? Dieses Buch befasst sich mit der Weiterentwicklung des von Glasl und Lievegoed entworfenen Konzepts der „Dynamischen Unternehmensentwicklung“, in dem sie die Veränderung von Unternehmensstrukturen in einem Entwicklungskonzept mit vier Unternehmensphasen dargestellt haben. Zu diesen vier Phasen habe ich anhand aktueller Formen der betriebswirtschaftlichen Zusammenarbeit drei weitere Unternehmensphasen ergänzt, eine Hierarchiefreie-Phase, eine Stakeholderphase und eine Schenkungsphase. Im Ausblick folgt dann noch eine vierte, die Lebenskünstler-Phase. Dabei stütze ich mich auf bedeutende Beispiele aus der Wirtschaft und die sie begleitende wissenschaftliche Literatur.
Lievegoed und Glasl haben mit ihrem Konzept der „Dynamischen Unternehmensentwicklung“ viele Jahre die Organisationsentwicklung im deutschsprachigen Raum geprägt. Sie haben unterschiedliche Situationen von Unternehmen in einen Entwicklungszusammenhang gebracht und die Möglichkeiten, Herausforderungen und Lösungsansätze der Situationen anschaulich verständlich gemacht. Viele der in den letzten Jahren entstandenen Unternehmen unterscheiden sich grundsätzlich von den bisher durch Glasl und Lievegoed beschriebenen Unternehmensformen.
Das Buch „Dynamische Unternehmensentwicklung“ von Bernhard Lievegoed und Friedrich Glasl (1993) ist selbst eine Erweiterung des von Lievegoed (1974) herausgebrachten Buches „Organisationen im Wandel“. Darin wurde ein „Modell der Evolution von Unternehmen über drei Entwicklungsstadien“ beschrieben. Zu den drei Entwicklungsstadien Pionierphase, Differenzierungsphase und Integrationsphase fügt Glasl (1993), zwanzig Jahre später, mit dem Buch „Dynamische Unternehmensentwicklung“ noch die Assoziationsphase als vierte Phase hinzu. Dies begründet er mit der Betrachtung der „Aktualität des Entwicklungsdenkens Lievegoeds im Lichte der modernen Organisations- und Führungstheorien“. Meine jetzige Erweiterung, wieder rund 20 Jahre später, aktualisiert das Modell erneut und führt die von Glasl begonnene Ergänzung des Entwicklungskonzeptes fort.
Lievegoed gliedert die Entwicklung von Unternehmen in „idealtypische“ Phasen, die für ein Unternehmen sowohl Orientierungshilfe, als auch ein Schlüssel zum Verständnis für einen Entwicklungsprozess darstellen können, um eine Entwicklungsdiagnose zu stellen und ein Unternehmen einzuordnen. Jeder Unternehmensphase liegt ihr eigenes Verständnis von Unternehmen zugrunde. Damit verbunden ist eine entsprechende Organisations- und Führungsstruktur.
In diesem Konzept ergänze ich Lievegoeds und Glasls Instrument der Unternehmens-Diagnose um drei neue Phasen der Unternehmensentwicklung. Ich orientiere mich für die erste neue Phase zunächst am Entwicklungsmodell von Frederic Laloux, der mit einer sehr ähnlichen Einteilung wie Lievegoed und Glasl den Entwicklungsprozess von Unternehmen beschreibt und um eine Phase hierarchiefreier Unternehmen ergänzt. Für die zweite und dritte Phase beziehe ich mich vor allem auf die Autoren Dirk Baecker, Peter Drucker, sowie Tapscott und Williams, die Unternehmenskonzepte von Unternehmen betrachten bei denen es eine hierarchiefreie Zusammenarbeit in der Supply-Chain gibt und in der nächsten Phase, die durch eine Zusammenarbeit ohne finanzielle Gegenleistung geprägt ist. Es ist eine Zusammenarbeit, die keine Tauschwirtschaft mehr ist, sondern eine „Geschenkökonomie“. Die Unternehmen der Schenkungsphase bilden die Grundlage für die letzte Phase meines erweiterten Entwicklungsmodells. Ich beschreibe also, wie traditionelle Unternehmen hierarchiefrei werden und wie sich eine Geschenkökonomie entwickelt. Dabei beziehe ich mich auch auf Aristoteles, der schon vor 2400 Jahren in seinem Buch „Politik“ ein Entwicklungsmodell für die Zusammenarbeit in der griechischen Stadtgesellschaft, der Polis, beschrieben hat.
Lievegoed und Glasl, aber auch Laloux sehen immer wieder Parallelen zwischen der Entwicklung der sozialen Beziehungen in Unternehmen und der sozialen Beziehungen im Verlauf des Lebens eines Menschen. Glasl beschreibt den Entwicklungsprozess sozialer Systeme mit dem von Pflanze, Tier und Mensch vergleichbar und erklärt: „Die Identität eines Unternehmens kann mit dem Ich eines Menschen verglichen werden, das allen Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühlen und Willensäußerungen Zusammenhang und Kontinuität verleiht“. Diese These habe ich ausgearbeitet und die Eigenheiten der sozialen Beziehungen im Verlauf der Unternehmensentwicklung mit dem Charakter der sozialen Beziehungen im Verlauf eines Menschenlebens bildhaft verglichen.
In ihren Büchern stellen Lievegoed, Glasl, Laloux und Aristoteles die Frage, inwieweit die von ihnen beschriebenen Phasen immer aufeinander folgen müssen. Alle geben darauf eine weiche, uneindeutige Antwort. Auch ob es eine beste Phase gibt, eine die wertvoller oder anzustreben ist, beantworten sie uneindeutig. Diese beiden Fragen habe ich nicht eingehend behandelt, folge aber Aristoteles mit seiner Einschätzung, dass jede Phase ihre situative Berechtigung hat. Meine Abgrenzung zwischen den Phasen dient der Vereinfachung und ist in der Praxis meiner Einschätzung nach nie voll zutreffend.
Die Pionierphase
Die Pionierphase ist die Phase, in der der Gründer oder die Gründerin sich intensiv mit dem neuen Geschäftsmodell beschäftigt hat und dann ein Unternehmen aufbaut, das ganz auf die eigenen Fähigkeiten zugeschnitten ist. Anderen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen kommt in dieser Phase die Rolle eines Dienstleisters oder einer Dienstleisterin zu. Diese Phase kann, wie jede andere auch, auf unbestimmte Zeit andauern und selbst in großen Unternehmen aufrechterhalten bleiben. Während diese Charakteristika des Entwicklungsprozesses bei Lievegoed und Glasl sowie Aristoteles in einer Phase zusammengefasst werden, teilt sie Laloux in drei Phasen ein.
Die Pionierphase bei Lievegoed und Glasl
In der Pionierphase nach Lievegoed und Glasl führen die Gründer und Eigentümer eines Unternehmens dieses autokratisch. Die besonderen Fähigkeiten, Erfahrungen und ihr charismatisches Auftreten verschaffen den Pionier-Unternehmern Respekt und Anerkennung bei „ihren“ Mitarbeitenden. Der Pionierunternehmer sieht die Mitarbeiter als „seine“ Leute an, um die er sich nach bestem Wissen und Gewissen kümmert - „bis in das Privatleben hinein“, indem er sonst übliche soziale Grenzen überschreitet. Denn der Pionier-Unternehmer betrachtet das Unternehmen als von ihm allein geschaffenes Werk und erhebt damit Besitz- und Machtanspruch im Aktionsbereich des Unternehmens einschließlich der Mitarbeiter, sodass aus der Perspektive des Pionier-Unternehmers von „seinen“ Mitarbeitern gesprochen werden kann. Der Pionier kennt „alle Tätigkeiten im Betrieb, weil er sie alle noch selbst verrichtet hat“. So spricht er die Sprache der Mitarbeiter und weiß, auf was es ankommt. Die Kommunikation im Pionierbetrieb ist direkt, beispielsweise vergibt der Chef oder die Chefin Aufträge an die unterste Ebene ohne Berücksichtigung etwaiger Vorgesetzter. Da sich im Unternehmen der Pionierphase alle kennen, wird diese Führungsstruktur nicht als sehr problematisch betrachtet. Formale Kommunikation und Regeln sucht man vergebens, so wird auf Stellenbeschreibungen, Funktionsbeschreibungen oder Ablaufbeschreibungen verzichtet. Das Unternehmen ist geprägt durch flache Hierarchien. Da der Pionier die meisten Entscheidungen selbst trifft, gehen auch Erneuerungen von der Spitze aus.
Den Organisationsstil beschreibt Lievegoed als „personenbezogen“. Aufgaben, die dem Pionier oder den Mitarbeitern liegen, machen sie selbst, andere werden an Kollegen abgegeben oder nicht erledigt. So entstehen flexible Aufgabenabgrenzung und hohe Arbeitsmotivation. Funktionen wie Einkauf werden flexibel auf viele Stellen im Betrieb verteilt. Ein Organisationsschema der bestehenden Situation ergibt ein „Wirrwarr von Linien“. Die Einstellung neuer Mitarbeiter übernimmt der Chef persönlich, er wählt sie weniger nach Qualifikation als nach dem „gewissen Etwas“ aus, denn sie müssen in „die «Familie» passen“. Wer sich im Betrieb zuhause fühlt oder vom Pionierunternehmer geschätzt wird, kommt weiter, wer das nicht tut, verschwindet wieder. So duldet ein Pionier-Unternehmer folglich auch kein Management unter sich, das eigenständige Entscheidungen treffen könnte. Falls es doch ein Management gibt, ist es meist stark in der Kompetenz eingeschränkt. Um seine Vormachtstellung zu erhalten, verhindert der Pionier, dass „seine“ Mitarbeiter zu stark an Kompetenz gewinnen. Wird der Unternehmer von Mitarbeitern grundsätzlich in Frage gestellt, wird dies als Angriff erlebt und der Einfluss des Mitarbeiters eliminiert.
Lievegoed beschreibt, dass der Pionier wenig Kenntnis über die Kosten bestimmter Arbeiten und Dienste hat und auch den Deckungsbeitrag nicht kennt, der durch die Erfüllung eines Auftrages erbracht wird. Es gibt eine starke Kundenorientierung, die bis ins Unwirtschaftliche gehen kann. Dies ist für den Pionier jedoch akzeptabel, so lange das Gesamtergebnis am Ende des Jahres stimmt. Der Unternehmer entscheidet tendenziell intuitiv, Kennzahlen spielen für ihn eine kleine Rolle und sind eher unbeliebt. Ein strukturiertes Controlling oder Management gibt es in Pionier-Unternehmen also nicht.
Die Pionierphase bei Laloux