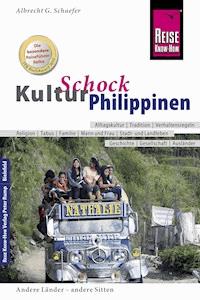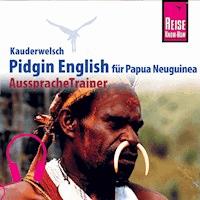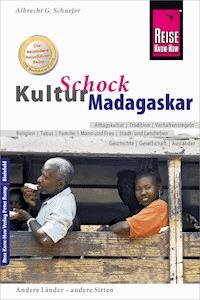
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reise Know-How Verlag Peter Rump
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kulturschock
- Sprache: Deutsch
Viele althergebrachte Klischees haften Madagaskar an. Sie beziehen sich hauptsächlich auf seine – vom europäischen Standpunkt aus betrachtet – ferne Insellage, sie zehren von Abenteuergeschichten, seltenen Tieren, exotischen Gewächsen oder der einen oder anderen Krankheit, die sich der Fremde einfangen kann. Die Menschen, die den "kleinen Kontinent" bewohnen, spielen in den europäischen Vorstellungen eigentlich eine untergeordnete Rolle. Es sind aber die Madagassen, deren Vorfahren aus Südostasien, dem arabischen und indischen Raum, aus Europa und von der Ostküste Afrikas hierher kamen, die so manche erlebenswerte Überraschung bereithalten. Den Besucher erwarten Begegnungen mit Menschen, die Traditionstreue über Fortschritt stellen, und mit anderen, die ihre Ahnen verehren und doch modernen Errungenschaften gegenüber aufgeschlossen sind, Menschen, die große Armut erdulden müssen und deren unerschütterliche Liebenswürdigkeit den Fremden beeindruckt. Dieses Buch hilft dabei, die Einzigartigkeit des Landes aufzuzeigen, seine Bewohner zu verstehen und Missverständnisse auszuräumen. Aus dem Inhalt: - 18 Seiten Verhaltenstipps A-Z - Fady: ein enges Netz von Tabus und Verhaltensweisen - Mora Mora: Harmonie und Konfliktvermeidung als Lebenshaltung - Die "vazimba" – Ureinwohner oder Fabelwesen? - Vazaha: weiße Fremde, allgemein geschätzte, aber seltsame Wesen - In der Stadt, auf dem Land: zwei Lebenswelten - Hochland- und Küstenbewohner: Rivalitäten mit Tradition u.v.m. - Prägende Geschichtsereignisse - Wirtschaftslage – im freien Fall - Mit Strohhut in die Cyberwelt – Mode und Zeitgeschmack - Das "Erbe der Ohren" – madagassische Literatur - Aberglaube - Ein klingender Mikrokosmos – Musik auf der Insel KulturSchock - die besonderen und mehrfach ausgezeichneten Kultur-Reiseführer von REISE KNOW-HOW. Fundiert, unterhaltsam und hilfreich im fremden Alltag unter dem Motto: Je mehr wir voneinander wissen, desto besser werden wir einander verstehen. REISE KNOW-HOW - Reiseführer für individuelle Reisen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 444
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Vorwort
Kaum eine deutschsprachige Publikation zum Reiseziel Madagaskar versäumt es, das Land mit dem bekannten schaurigen Lagerfeuerlied in Verbindung zu bringen, um die Leser auf Abenteuer und prickelndes Unbekanntes einzustimmen. Auch verstaubte Buchtitel, die schon früheren Generationen spannende Unterhaltung boten, beschreiben die Große Insel im Indischen Ozean als einen Hort von Gefahr, wilden Menschen und befremdlichen Bräuchen. Inzwischen verzerren drollige Lemuren (und Pinguine!) aus Animationsfilmen Madagaskar zu einem allzu harmlosen, von Menschen unbewohnten Eiland. Dann gibt es noch den Pfeffer, der dort wächst und das Madagaskar-Steak erst zu einem solchen werden lässt. Klischee wird auf Klischee gehäuft. Für die Fantasie scheint sie ausgesprochen anregend zu sein, die ferne Insel, die von Europa aus gesehen auf der Weltkarte geradeaus nach „unten“ und dann „rechts“ neben Afrika liegt.
Übrigens sind viele Besucher, von zahlreichen Autoren entsprechend eingestimmt, „auf“ Madagaskar unterwegs, so wie sie sich „auf“ Helgoland oder „auf“ Bali bewegen würden. Aufgrund von Größe, Klima- und Landschaftszonen ist das Land jedoch sozusagen ein kleiner Kontinent, sodass dieser KulturSchock-Band dazu beitragen möchte, sich auf die Eindrücke und Erlebnisse „in“ Madagaskar vorzubereiten. Und zwar insbesondere auf die Begegnungen mit den Menschen, die hinsichtlich des Bekanntheitsgrades des Landes als „Hotspot“ von Fauna und Flora oft eher wenig Beachtung finden. Gleichwohl präsentiert sich die madagassische Bevölkerung höchst vielseitig, hat sie doch ethnische Wurzeln, die sie mit ganz verschiedenen Teilen der Welt verbinden – mit Südostasien, Arabien, Indien, Europa und tatsächlich auch mit Afrika, dem nahen Nachbarkontinent, der für die Besiedlung Madagaskars dennoch keine Hauptrolle spielte.
144ma-as
Der Autor mit einer befreundeten Familie in Mangily (Bucht von Ifaty)
Entsprechend verwirrend erscheint dem interessierten Besucher das kulturelle Potpourri. Das eigene Verhalten mutet zunächst angesichts der Unzahl an Tabus und traditionellen Bräuchen schwierig an. Dieses Buch soll dem aufmerksamen und einfühlsamen Reisenden eine wertvolle Orientierungshilfe bieten und als Anregung für eigene Entdeckungen dienen, sowohl für diejenigen, die das faszinierende Land Madagaskar erstmalig bereisen, wie auch für die, die dort leben. Mancherorts kann man sich wirklich wie die ersten vazaha („hellhäutige Fremde“) fühlen und den eigenen Kulturschock mit dem Unverständnis der staunenden Bewohner der Großen Insel messen.
145ma-as
Bara-Junge am Fluss
Anliegen des ersten Teils des Buches ist es, historisches Hintergrundwissen zu vermitteln. Es sind ja die wiederholten, mal friedlichen, mal gewalttätigen Kontakte zu Fremden, die die madagassische facettenreiche Kultur beeinflussten und sowohl Interesse an ausländischen Ambitionen als auch deren Ablehnung prägten. Im zweiten Teil des Buches stehen die Begegenungen mit den Bewohnern des Landes im Vordergrund.
In Madagaskar, einem der ärmsten Länder der Erde, treffen wir ausnehmend oft freundliche, liebenswürdige Menschen. Das mag uns angenehm überraschen, aber auch nachdenklich stimmen. Wir tun gut daran, die uns gezeigte Sympathie zu erwidern, indem wir die Lebensweisen der Madagassen nicht als rein exotische Abwechslung, sondern mit teilnehmender Neugier betrachten und respektieren.
Den Weg dazu soll das vorliegende Buch bereiten, unterstützt von dem traditionellen Reisegruß der Sakalava:
„Domby lahy, marzava loha! Tsara mandroso, tsara miverina!“
„Mit dem Segen des weißköpfigen Zebus –
eine gute Reise und eine gute Heimkehr!“
Inhalt
Vorwort
Verhaltenstipps A–Z
Geologischer und geschichtlicher Hintergrund
Die Wurzeln
Prägende Geschichtsereignisse (1500–1947)
Die jüngere Geschichte (1947–2018)
Geschichtstabelle
Der kulturelle Rahmen
Die halbe Welt auf einer Insel – Zusammensetzung der Bevölkerung
Glaube, Religion und Kirche
Feste, Bräuche, Traditionen
Denkweisen und Verhaltensformen
Die Gesellschaft heute
Politische Landschaft und Hierarchie
Die Welt der (Miss-)Information – die Medien als Instrumente der Macht
Wirtschaftslage – im freien Fall
Die soziale Pyramide
Geschlechter und Familie
Der Alltag
Arbeiten – von der Hand in den Mund
Die Muntermacher – Freude und Fluch
Gesundheit in Not
Mit Strohhut in die Cyberwelt – Mode und Zeitgeschmack
Naturschutz – zwischen Gier und Korruption
Wasser de luxe
Wie gewonnen, so zerronnen – Madagaskar im Spiel
Sport, Freizeit, Urlaub
Eine Sprache für alle
Das „Erbe der Ohren“ – madagassische Literatur
Ein ganz normaler Tag
Der Siegeszug des Telefons
Man sieht sich – soziale Treffpunkte
„Hira gasy“ – Straßentheater mit Tradition
Am liebsten alle unter einem Dach: Wohnen
Als Fremder auf der Großen Insel
Madagaskar auf den ersten Blick: viele Kinder, alte Autos und kahle Erde
„Bonjour vazaha“ – das Bild vom Touristen und von den Deutschen
Etikette, Körpersprache, Anrede
Namen, die Geschichte schreiben
Gastfreundschaft
Verabredungen und Ausgehen
„Masotoa homana“ – „Guten Appetit!“
„Vazaha“ und Madagassin
Einkaufen – Handeln, aber mit Niveau!
„Tsy maninona“ – Kein Problem … oder doch? (Konfliktverhalten)
Umgang mit Behörden und Polizei
Trau, schau, wem – von „dahalo“ und anderen „schrägen Vögeln“ (Sicherheit)
Über Stock und Stein – Verkehr und Transportmittel
Machen Sie es sich bequem – Unterkünfte mit und ohne Sterne
Anhang
Glossar
Literaturhinweise
Internetempfehlungen
Übersichtskarte Madagaskar
Register
Der Autor
Exkurse zwischendurch
Die Schöpfungsgeschichte auf Madagassisch
Die „vazimba“ – Ureinwohner oder Fabelwesen?
Häuptling oder König?
Der Jesuit und der Königssohn
Ein Graf aus Ungarn wird König in Madagaskar
„Madagascar, or Robert Drury’s Journal, 1729“
Jean-Baptiste Laborde – der Günstling Ihrer Majestät
Hoch lebe die Kopfsteuer!
Der „Madagaskar-Plan“ der Nazis
Der König der Vögel als Helfer in größter Not
Wer kennt die Stadt, wer kennt die Namen?
Religionszugehörigkeit
Ein kleiner Fady-Leitfaden
Die Wochentage und „vintana“
Aberglaube
Immer eingenordet
Zebus von der Bank
Im Zustand der Unwissenheit
Medienlandschaft
Ein Schnitt fürs Leben
Die Hochzeitsansprache – mit starken Worten ins Eheleben
Im Dschungel der Stadt
Madagaskar einmal anders
Ein klingender Mikrokosmos – Musik auf der Insel
„Wir hatten die Pest an Bord …“
Anerkennung oder Anmaßung – das verflixte Trinkgeld
Extrainfos im Buch
ergänzen den Text um anschauliche Zusatzmaterialien, die vom Autor aus der Fülle der Internet-Quellen ausgewählt wurden. Sie können bequem über unsere spezielle Internetseite www.reise-know-how.de/kulturschock/madagaskar18 durch Eingabe der jeweiligen Extrainfo-Nummer (z. B. „#1“) aufgerufen werden.
Verhaltenstipps A–Z
Aberglaube: Das Chamäleon einer bestimmten Art soll Glück bringen, eine andere Spezies verheißt genau das Gegenteil und das Ablecken der Finger beim Essen kann drohende Armut bedeuten. Zu allen Lebensbereichen haben Madagassen Warnungen, Aufmunterungen und Redensarten parat, die auch sie selbst oft als Aberglaube bezeichnen. Manche sind im ganzen Land bekannt, andere nur bei bestimmten Bevölkerungsgruppen. Gebildete Menschen mögen Aberglauben als naiv, gestrig, zumindest als spaßig abtun, doch auch unter ihnen gibt es manche, die in entsprechenden Zeichen, Begebenheiten und Verhaltensweisen gute oder schlechte Omen erkennen. Vielfach scheint uns der Übergang zu fady (s. S. 121) fließend. Der Exkurs „Aberglaube“ auf S. 136 enthält eine – kleine – Auswahl. Wer sein Interesse an dem Thema bekundet und möglichst mit Vergleichen aus dem Aberglaube-Fundus der eigenen Erziehung aufwarten kann, wird schnell in eine ergiebige, amüsante Konversation eintreten und feststellen, dass es neben Unterschieden auch Parallelen beim Deuten und Beachten gibt.
Ahnenverehrung: Unter den kulturellen Eigenschaften rangieren Respekt für und Beeinflussung durch die Vorfahren ganz oben. Gelten doch die Ahnen, kürzlich verstorbene Familienmitglieder zählen schon dazu, als Vermittler zwischen Gott und den Lebenden. Jede halbwegs wichtige Rede, jede öffentliche und familiäre Festlichkeit beginnt mit einem Gebet, das nicht nur Gottes Segen, sondern auch das Wohlwollen der Ahnen erbittet. Viele Namen beginnen mit „Ra …“ und/oder „Raza“, was sich von ra („Blut“) bzw. razana („die Ahnen“) herleitet. Grabstätten wie auch Orte, die mit den Vorfahren assoziiert werden, sind von diversen fady (s. S. 121) geschützt, die ausländische Besucher ebenso respektieren sollen wie Madagassen. Menschen im betagten Alter stehen den Ahnen am nächsten. Generell sind Senioren, ob sie Familienmitglieder oder Fremde (Ausländer) sind, Personen, denen man Respekt und Hilfe bietet (siehe auch „Die Ahnen – Mittler zwischen den Lebenden und Gott“ auf S. 115).
AIDS: An der Unabhängigkeitsstraße von Antananarivo hatte Ex-Präsident Ravalomanana kurz nach seinem Amtsantritt 2002 ein SIDA-Mahnmal (das französische Pendant zu AIDS) errichten lassen. Er hatte das Übel zur öffentlichen und persönlichen Angelegenheit gemacht, viele Aufklärungskampagnen, meist mit der Unterstützung bekannter Musikstars, ermöglicht und in Zusammenarbeit mit US-Sponsoren kostenlos oder zumindest günstig Kondome in den Umlauf bringen lassen. Später als auf dem afrikanischen Kontinent verbreitete sich HIV dann doch in den Inselzentren, durch den oft sorglosen Wechsel von Sexualpartnern und die in manchen Ethnien kulturell verankerte Polygamie auch in den Provinzen. Nach Jahren der Stagnation steigen die Ansteckungen wieder deutlich. Als HIV-„Hochburgen“ gelten die Region Anosy und die Küstenstadt Toalagnaro (Fort Dauphin). 2017 schätzte die WHO die Zahl der Infizierten in der Bevölkerung auf 1 bis 1,8 %, wobei die Möglichkeiten, verlässliche Tests durchzuführen, sehr begrenzt sind. Besonders unter dem Putschregime unter Rajoelina (2009–2013) wurden Aufklärungs- und Eindämmungsmaßnahmen sträflich zurückgefahren, derzeit sind zwar Verbesserungen erkennbar, doch wie anderswo scheint das Thema in der madagassischen Öffentlichkeit eine Nebenrolle einzunehmen. Außerdem bremsen traditionelle Fady-Verbote bezüglich Sex die Aufklärung stark. Ansteckungsgefahr für Reisende besteht besonders beim Kontakt mit Prostituierten. Daher wird dringend geraten, Sexualkontakte nur mit entsprechendem Schutz zu unterhalten (siehe auch S. 207)!
Alkohol: Laut einer WHO-Statistik aus dem 2017 konsumiert jeder Madagasse ab dem Alter von 15 Jahren jährlich pro Kopf „nur“ 0,92 Liter reinen Alkohol und ist in dieser Hinsicht weniger „lasterhaft“ als die Bewohner der übrigen afrikanischen Länder. Mancher Besucher mag das anders wahrnehmen. Jeder zweite Straßenkiosk verkauft, oft bis spät am Abend, Schnaps und Bier. Hochprozentigen Rum aus Zuckerrohr (toaka) oder gegorenen Zuckerrohrsaft (betsabetsa) gibt es literweise bei jeder Familienfeier, auch zählen diese Flüssigkeiten zu den irdischen Freuden- und Trostspendern, mit denen die Ahnen bei Laune gehalten werden. Vom Leid, das Alkoholiker(-innen) sich und ihren Angehörigen antun, kann so ziemlich jede Familie ein Lied singen. Abstinenz ist eine geschätzte Tugend, die z. B. in vielen Jobanzeigen deutlich gefordert wird. Besucher wie vor Ort lebende Ausländer finden jedenfalls ein großes, verlockendes Angebot an abgefüllten Muntermachern, das nicht zuletzt auf die Kreativität der früheren Kolonialherren zurückgeht. In luxuriös ausgestatteten Supermärkten und gehobenen Restaurants können wohlhabende Madagassen und Ausländer in einem Angebot an Spirituosen schwelgen, das einen angesichts der großen Armut im Land sprachlos macht. Vorsicht ist im Straßenverkehr geboten, denn gerade an Wochenenden und bei fröhlichen Veranstaltungen sind gewöhnlich viele Betrunkene (mamo) unterwegs – auch am Steuer der Fahrzeuge. Als Teilnehmer eines zunächst harmonischen Umtrunks sollte man die Sinne nicht zu sehr benebeln; der Spaß könnte abrupt in Geschrei und Streit und, weil auf ihre Gelegenheit lauernde Ganoven wachsam sind, in einen Raubüberfall übergehen.
104ma-as
Reggae-Musik kommt immer gut an, mit und ohne Spirituosen
Anrede/Gruß: Als hohes Gut bezieht Höflichkeit Fremde mit ein. Sie sollten sie so oft wie möglich erwidern. Je nach Tageszeit sind die Grußformeln auf Französisch mit dem zu ergänzenden „Monsieur“, „Madame“ oder (in Madagaskar ist es weiterhin gebräuchlich) „Mademoiselle“ angebracht. Weitaus integrierter verhalten sich Besucher allerdings, wenn sie die regionaltypischen Ausdrücke bei Begegnungen verwenden, zumindest das im ganzen Land gebräuchliche „Salamo“ oder „Salama“. Zum Abschied kommt „veloma“ („Tschüss“, „Lebewohl“, „Auf Wiedersehen“) immer gut an. Mit dem angehängten „tompoko“ (ausgesprochen „tupku“ – „meine Dame(n)“/„mein(e) Herr(en)“/„verehrte Herrschaften“), drückt man seine Achtung stilsicher aus. Hat der/die Anzuredende einen Berufs- oder Respekttitel, so sollte dieser in der Regel nicht fehlen: „Bonjour, Madame la Directrice!“ „Salamo tompoko, Monsieur le Commissaire!“ „Veloma, Monsieur le Professeur!“
Ansehen, Gesicht wahren: Zahlreiche Verhaltensweisen bei sprachlicher wie körperlicher Kommunikation sollen neben offener Freundlichkeit, Charme, Lächeln und Höflichkeit vor allem eins vermitteln: Man versucht so oft es geht, nach außen hin eine erkennbare, wenn auch oft nur vermeintliche Ausgeglichenheit zu zeigen und damit das Gesicht und Ansehen zu wahren. Dazu gehört auch die von Ausländern gern als „Verhaltens-Wahrzeichen“ erkannte, aber längst nicht immer richtig verstandene „mora mora“-Einstellung (wörtlich: langsam, immer mit der Ruhe). Hektik, die es natürlich in Großstädten en masse gibt, Drängeln und laute Sprache sind Verhaltensweisen, die generell als unhöflich empfunden werden und deshalb auch von Besuchern möglichst vermieden werden sollten. So kann auch der/die vazaha („weiße(r) Fremde(r)“)seine Gelassenheit beweisen und bringt weder sich noch sein Gegenüber in Verlegenheit. Mehr zu diesem Thema findet sich in den Kapiteln „Mit Ruhe das Gesicht wahren“ (s. S. 165) und „Etikette, Körpersprache, Anrede“ (ab S. 266).
Armut und Bettler: Kommentare wie „Die Armut ist schlimmer als ich sie in Indien gesehen habe!“ oder „Unfassbar, dass die Leute trotz ihrer Misere so fröhlich sind!“ zeigen, wie unterschiedlich und schlichtweg ratlos wir auf die in der Tat für die Mehrheit der Madagassen prekären Lebensumstände reagieren. Noch größer scheint die Verwirrung, wenn schon vor dem ersten Hotel und bei fast jedem Halt des Fahrzeugs Frauen mit Kindern und Alte den Fremden ihre Hände entgegenstrecken und um Almosen, Seifenstückchen oder Kleidung bitten. Da mögen die Tipps in Reisehandbüchern („Bettelnden Kindern nie etwas geben“, „Kein Geld an Bettler, lieber Lebensmittel kaufen und verteilen!“ „Besser an eine Hilfsorganisation spenden!“) manchem wie die Erlösung aus dem Gewissensdilemma vorkommen, für andere klingen sie angesichts des hautnahen Elends eher wie hohle Scheinheiligkeit.
Der Autor dieses Buches hat kein Patentrezept für den Umgang mit den sozial Schwächsten in einem der weltweit ärmsten Länder parat, plädiert aber für ein Geben nach „gesundem“, also menschlichem, „Bauchgefühl“: So wenig ein Almosen – abgesehen von der Beruhigung des eigenen Gewissens – eine nur annähernd nachhaltige Linderung für den individuellen Empfänger bringt, so wenig wird die eigene Reisekasse darunter leiden, wenn man armen Alten, Blinden und Behinderten, die unfähig sind, durch Arbeit Geld zu verdienen, mal ein paar Hundert Ariary zusteckt. Und wenn die bettelnde Frau mit ihrem sichtbar kranken oder unterernährten Kind nach Geld für Essen und/oder Medikamente fragt – wer will da wirklich hart bleiben, ihr womöglich die Adresse einer wohltätigen Einrichtung in die Hand drücken? Zweifellos sind aber seriöse Hilfsvereine, NGOs und Privatsponsoren eher in der Lage, gezielt und dauerhaft mehr Bedürftige, auch mit der Hoffnung auf Selbsthilfe, zu unterstützen als es spontane Gaben en passant, am Straßenrand vermögen.
Ausländer/Touristen:Vazaha nennen uns Madagassen landauf, landab, egal, ob die „weißen Fremden“ Frauen, Männer, Touristen oder im Land lebende Ausländer sind. Allen gemeinsam ist die Eigenschaft des Anderseins, des Andersdenkens, das zunächst jedenfalls anzunehmende Unverständnis für die madagassische Lebensart. Konsequenterweise, so besteht zuweilen der Eindruck, passen vazaha, egal welchen Alters und Geschlechts, auch nicht in das lokale Werte- und Respektschema. Das merkt jeder, der sieht, wie respektvoll Kinder und Jugendliche sich den (madagassischen) Erwachsenen gegenüber verhalten und im Vergleich dazu die Fremden „locker-frech“ ansprechen und wegen Geschenken oder zum Zweck eines Verkaufsgeschäfts „anmachen“. Pauschal scheinen alle Fremden reich zu sein, allein schon, weil sie von weit her angereist sind, vornehm wohnen und speisen. Der Eindruck lässt sich vor allem bei weniger gebildeten Menschen kaum entkräften, die beobachten, dass der Tourist allein für seine täglichen Getränke ein Vielfaches dessen ausgibt, was ihnen am Tag zur Verfügung steht, oder wenn sie die komfortablen Karossen sehen, in denen ausländische Mitarbeiter von Hilfsorganisationen unterwegs sind. Zum Hintergrund der Bezeichnung vazaha und zum Verhältnis zwischen Ausländern und Madagassen siehe das Kapitel „,Bonjour vazaha‘ – das Bild vom Touristen und von den Deutschen“ ab S. 261.
Baden/Nacktbaden: Ohne Eintauchen ins Meer, in Seen und erfrischende Naturpools ist ein Madagaskaraufenthalt nur halb so schön, die angebrachte Vorsicht hinsichtlich Strömungen, Seeigeln und Parasiten vorausgesetzt. Aber es gilt neben regionalen, stets vor Ort zu erfragenden Fady-Geboten (z. B. darf man im Norden der Insel Sainte Marie einen bestimmten Strand nur barfuß betreten; was in den geheiligten Kraterseen von Nosy Be Baden wiederm verboten ist) auch Anstandsregeln zu beachten. So ist öffentliches Nackt- und für Frauen Oben-ohne-Baden wie textilfreies Sonnenbaden absolut verpönt. Als leicht zu verstauender Umkleidevorhang vor und nach dem Baden leistet ein „lamba“, eines der überall erhältlichen Wickeltücher, hervorragende Dienste. Wer sich dennoch vor aller Augen entblößt, erntet schnell voyeuristische, wenn nicht erzürnte Blicke. Andererseits wird der/die Reisende selbst zum Voyeur, wenn er Madagassen fotografiert, die sich im Freien waschen. Der Respekt vor der Intimsphäre versteht sich zu gut, wenn man sich die Situation einfach umgekehrt vorstellt.
105ma-as
Auf örtlichen Märkten wie hier in Ambalavao haben Schneiderinnen ihren Stammplatz
Bekleidung: Sehen Sie sich an einem Sonntag, Feiertag und auch schon am Samstag, wenn für verschiedene christliche Konfessionen Gottesdienst angesagt ist, um und Sie werden über die vielen fein und adrett gekleideten Menschen staunen. Ob Arm oder Reich, alle wollen farbenfroh ihr bestes Outfit zeigen. Ähnlich ist das Bild, wenn irgendwo in den Städten oder auf dem Land eine Musik- oder Sportveranstaltung steigt. Der Wochenmarkt dient ebenso dem Sehen und Gesehen werden, entsprechend putzen sich die Besucher heraus. Da mag sich mancher Tourist in bequemen, durch Straßenstaub und Schweiß oft etwas schmuddeligen Klamotten deplatziert fühlen. Natürlich soll die gewählte Reisekleidung komfortabel und den Witterungsbedingungen angepasst sein. Leichte Baumwoll- oder adäquate, hygienisch einwandfreie Kunststofftextilien sind zu empfehlen, Polo- und kurzärmelige Hemden, lange, halblange und nicht zu kurze Hosen können Sie im Reisealltag ohne besondere Einschränkungen tragen. Doch neben Badelatschen, T-Shirts und Trekkingstiefeln sollten ein nicht zu aufreizend geschnittenes Kleid, geschlossene Schuhe und ein, zwei Hemden in eher dezenten Farben auch noch Platz im Gepäck finden. Solche Kleidung steht zweifellos demjenigen gut, der zu Behördengängen muss oder einer Einladung ins Haus der Gastgeber oder zu einer Feier folgen möchte. Notfalls hilft zur angebrachten Kleiderordnung der Rat eines entsprechend erfahrenen Bekannten, bieten größere Orte Nachschub an Schuh- und Textilwaren, außer denen in XXL-Größen. Viele Unterkünfte bieten einen Wasch- und Bügelservice an. Da die meisten Bewohner europäisch-westliche Mode tragen, bewundern und sich bei dem überall auf Märkten angehäuften Inhalt ausländischer Kleidersammlungen bedienen, sind die von uns getragenen Kleidungsstücke eigentlich nie exotisch und finden in der Regel bei weniger wohlhabenden Menschen auch als Geschenk willkommene Abnehmer. Wenn es irgendwie möglich ist, sollten solche „Spenden“ im Sinne der Höflichkeit nicht als zu entsorgendes Übergepäck angekündigt werden, tragbar und vorher gewaschen sein.
Beleidigungen: Jeder kann in Situationen geraten, die zu Unmut und Gereiztheit verleiten, sei es im Straßenverkehr, der besonders in der Hauptstadt immer aggressiver wird, anlässlich einer irrtümlich (oder absichtlich) falsch ausgestellten Rechnung oder eines offensichtlich überteuerten Warenpreises. Madagassen reagieren in vergleichbarer Lage auch nicht immer zurückhaltend und haben, wie ein alltagstauglicher Sprachführer bezeugen wird, ihren Fundus an Schimpfwörtern und beleidigenden Ausdrücken parat. Für den mit den vielen Nuancen der lokalen Kommunikation kaum vertrauten Besucher empfiehlt es sich, Missverständnisse erst einmal auf höfliche Art zu klären und auch die Körpersprache nicht aggressiv wirken zu lassen – also nicht die Fäuste in die Hüften stemmen, nicht mit der Faust auf den Tisch hauen, nicht Schreien und mit langem Zeigefinger vorm Gesicht des Gegenübers fuchteln – und gar nicht erst an die obszöne Mittelfinger-Geste denken. Bei hartnäckigen Auseinandersetzungen sollte man auf jeden Fall eine madagassische oder zumindest mit den Gepflogenheiten vertraute Vermittlerperson hinzuziehen. Auch in zwischenmenschlichen Krisensituationen bewahrheitet sich meistens die landesübliche „Weisheit“: In Madagaskar tauchen immer wieder Probleme auf, doch es gibt auch stets irgendwie (und irgendwann) eine Lösung! Siehe auch die Informationen im Kapitel zum Thema Konfliktverhalten ab S. 281.
Berührungen/Körperkontakt: Kontaktfreudig sind Madagassen allemal, herzliche Umarmungen und der dreimalige Wangenkuss unter Freunden und Verwandten sind häufig zu beobachten; der höfliche, also nicht zu feste Händedruck ist an der Tagesordnung. Allerdings gebietet es bei Begegnungen zwischen nicht allzu vertrauten Männern und Frauen der Anstand, dass der Mann seine Hand erst reicht, wenn die Frau die ihre zum Gruß anbietet. Die reine (rechte) und die unsaubere (linke) Hand kennt man auch aus anderen Ländern. So sollte die linke Hand, die in der Regel beim Toilettengang die Reinigung übernimmt, nicht zum Geben, Nehmen und Essen benutzt werden. Eine höfliche und sehr überzeugende Art, etwas zu reichen oder anzunehmen, und auch beim Handschlag ist, wenn die linke Hand, die von der Seite des Körpers kommt, wo das Herz schlägt, die eigene rechte Hand oder den rechten Arm berührt. Manchen mag es reizen, kleine Kinder zu streicheln, ihnen an den Kopf zu fassen. Der Versuch wird jedoch sehr häufig mit Schreien, Weinen und Flucht quittiert, weil viele der Kleinen Angst vorm weißen Mann und der weißen Frau haben. Gleichwohl trauen sich etwas ältere Kinder schon mal, die helle Haut der vazaha zu berühren. Diese Kontaktaufnahme kann sehr lustig sein. Ein beiderseitiger Spaß ist auch, wenn sich (vorwiegend) Kinder etwas von der Sonnencreme der vazaha auf die eigene Haut schmieren (lassen). Und wir können noch so oft betonen, dass es unsere empfindlichen Körper vor Sonnenbrand schützen soll: Der Glaube hält sich hartnäckig, dass das weiße Wunderzeug irgendwann auch dunkle Haut „schöner“, weil heller werden lässt.
Öffentlich demonstrierte Liebkosungen wie das Austauschen von Küssen sind wenig verbreitet; das sollten Ausländer, hetero- wie homosexuelle, beherzigen. Siehe auch das Kapitel „Etikette, Körpersprache, Anrede“ ab S. 266.
Bestechung/Schmiergelder: „Bakshisch“, „Donation“ (Spende), „Cadeau“ (Geschenk), die mehr oder weniger euphemistischen Umschreibungen für Bestechungs- oder Schmiergelder sind vielfältig und in aller Munde. Vielseitig sind auch die Anlässe, die vom Falschparken über bessere Schulnoten für den lernunwilligen Sohn bis zur Bevorzugung bei der Konzessionsvergabe bei Bergbauprojekten und dem Schmuggel gestohlener Zeburinder so ziemlich alle Lebens- und Wirtschaftbereiche umfassen. Selbst ausländische Firmenvertreter, die nach außen hin ihre hohe Moral verteidigen, zweigen hier und da „besondere Zuwendungen“ vom Budget ab, um es bei Behörden, Politikern und im Konkurrenzkampf leichter zu haben. Richtig widerlich zeigt sich das anscheinend unausrottbare Geschwür der Korruption, wenn sogar Hilfsorganisationen direkt oder indirekt zur Kasse gebeten werden, damit sie ihre Materialen aus dem Zoll heraus bekommen, oder wenn der Ortsvorstand in einem Dorf am Pangalanes, wo er u. a. ein Restaurant betreibt, sich von dem alljährlich anreisenden ausländischen Arzt die Benutzung von Tischen bezahlen lässt, damit dieser im Ort kostenlos Kranke und Verletzte darauf behandeln kann. Beispiele gibt es zuhauf. Jeder, der einmal im Taxi-Brousse unterwegs war, wird es erlebt haben: Der Fahrer reicht brav bei den alle paar Kilometer kontrollierenden Ordnungshütern die Kfz-Papiere aus dem Fenster, in denen garantiert ein oder zwei Ariary-Scheine sozusagen als „Lesezeichen“ die Inspektion erleichtern. Schilder wie „Halte la corruption“ oder „Tsy mety kolikoly“ („Schmiergeld funktioniert nicht“) sind hin und wieder zu sehen, haben aber meist rein optische Wirkung. Reisende, denen gegenüber sich Beamte und Gesetzesvertreter in der Regel mehr zurückhalten, sollen sich ausdrücklich nicht ermuntert fühlen, in dieser Hinsicht die Madagassen nachzuahmen. Ob sie es jedoch immer, gerade in etwas brenzligen Situationen (Reisepass im Hotel gelassen, das Taxi zum Flughafen muss unbedingt dem Stau entkommen) durchhalten können, ist fraglich. Weitere Details zum unerschöpflichen Thema finden Sie im Kapitel „Auf verwinkelten Amtswegen“ ab S. 172.
106ma-as
„Stoppt die Korruption“ – so ein Straßenschild lässt Madagassen schmunzeln
Blickkontakt: Alle Augen sind auf uns, die vazaha gerichtet, das gilt vor allem abseits der Touristenzentren und größeren Ortschaften. Da rufen Kinder, aber auch Erwachsene häufig „Salut vazaha!“ oder „Bonjour vazaha!“ und erwarten, dass wir reagieren, sie entdecken, den Gruß erwidern, wenigstens Blickkontakt aufnehmen und lächeln. Offene Blicke sind in Madagaskar nicht ungewöhnlich, je nach Situation drücken sie Erstaunen, Neugier oder, in Gegenden, wo Fremde selten auftauchen, auch Furcht und Misstrauen aus. Im letzteren Fall helfen auf jeden Fall ein entspanntes Lachen und ein paar Worte in Malagasy dabei, den Bann zu brechen. Jemanden anzustarren, gilt bei Madagassen als unhöflich, also sollten wir uns davor hüten, derart aufdringlich und verunsichernd dreinzublicken.
Bürokratie: Der nur kurze Zeit im Land reisende Besucher hat in der Regel kaum bürokratische Hürden zu fürchten oder gar zu überwinden. Außer Ein- und Ausreiseformalitäten sowie hier und da Schlange stehen in Banken bleibt er von Papierkram und Klinkenputzen verschont. Dass es auch anders läuft und zwar oft sehr langsam und nervig, dass wissen im Land lebende vazaha und vor allem Madagassen zu berichten. Mehr dazu findet sich im Kapitel „Auf verwinkelten Amtswegen“ ab S. 172. Jedenfalls empfiehlt es sich, das bestehende System erst einmal zu akzeptieren. Der Vergleich mit heimatlichen Verwaltungsapparaten ist müßig. Bei Besuchen in madagassischen Amtsstuben sollte man stets neben angemessener Kleidung (Badelatschen, T-Shirt und kurze Hose sind beispielsweise ein No-Go!) möglichst die erforderlichen Papiere, Nachweise und, neben den für anfallende Gebühren zu entrichteten Ariary-Scheinen, einen ordentlichen Vorrat an Zeit mitbringen.
Drogen: Madagaskar hat sich in den vergangenen Jahren den Ruf einer Drehscheibe des Drogenhandels zwischen Asien, Afrika, den Inseln des Indischen Ozeans und Europa erworben. Der Konsum von vorwiegend leichten, für relativ wenig Geld erschwinglichen Rauschmitteln wie Cannabis, das auch lokal angebaut wird, ist unter jüngeren Madagassen und im Land lebenden Ausländern verbreitet. Härtere Stoffe und Modedrogen haben bei einer wohlhabenden Klientel auch ihren Markt. Wer beim Dealen oder Konsumieren erwischt wird, muss mit empfindlichen Gefängnisstrafen rechnen.
Einkaufen/Märkte: Abgesehen von sehr kleinen Siedlungen finden sich in jedem Ort mehrere Läden und Kioske („Boutique“), wo es diverse Dinge wie bei uns früher im „Tante-Emma-Laden“ zu kaufen gibt: Seife, Batterien, Zahnbürsten, Kekse, Getränke, Speiseöl usw. Abhängig von der Saison werden Früchte und Gemüse oft entlang der Straßen und Wege angeboten, ebenso wie Holzkohle, gebrauchte Kleidung, Treibstoff und Ackergeräte. All dies und noch viel mehr füllen selbstverständlich die kunterbunten, städtischen Märkte, die täglich (auch sonntags) geöffnet sind. Für unsereins regelrecht exotisch sind die Wochenmärkte auf dem Land, die wie im Kapitel „Mode und Zeitgeschmack“ ab S. 233 dargestellt, außer einem Umschlagplatz für Waren, Vieh, traditionelle Handwerkskunst und Medizin auch Kommunikations- und Kontaktplattformen sind. Wie eine andere Welt wirkt dagegen für die Mehrheit der Madagassen – wenn sie jemals die Gelegenheit hat, dort vorbeizuschauen – ein Supermarkt oder gar eine Shoppingmall, wie es sie inzwischen in Antananarivo gibt. Das Kapitel „Einkaufen – Handeln, aber mit Niveau!“ (s. S. 280) gibt u. a. darüber Auskunft, warum, wie und wo man landesüblich den Preis „besprechen“ sollte.
Einladungen: Wem die Ehre zuteil wird, ins Haus oder in die Wohnung einer/eines Bekannten eingeladen zu werden, sollte die Einladung ernst nehmen. Sei es das einfache Zuhause eines Fischers oder das vornehme Appartement der Mitarbeiterin im Ministerium, eine nette Aufmerksamkeit als Geschenk für den/die Gastgeber/in ist auf jeden Fall angebracht. Das kann ein Mitbringsel von der Reise (z. B. Obst, Gebäck, Süßigkeiten) durch eine vorher besuchte Region, aber auch ein Getränk, eine Delikatesse aus dem Supermarkt oder ein Souvenir aus der eigenen Heimat sein. Wenn Kinder dort, wo man eingeladen ist, zu Hause sind, findet sich eigentlich immer etwas Passendes, was letztlich allen Freude bereitet. Mehr zu den Feinheiten anlässlich einer Einladung lesen Sie in den Kapiteln „Gastfreundschaft“ (s. S. 271) und „,Mandrosoa tompoko‘ – ‚Bitte eintreten!‘ Zu Gast in der Familie“ (s. S. 273).
Fady: Als „Tabu“ oder „Verbot“ wird von Reisenden und vielen von ihnen zu Rate gezogenen Informationsquellen dieser Ausdruck oft, aber nicht ganz korrekt übersetzt. Denn was als fady die madagassische Lebensweise bestimmt, ist ein recht komplexes und vielschichtiges Verhaltens- und Respektsystem, dem sich das Kapitel „‚Fady‘ – ein Netz, das einengt, aber auch auffängt“ (s. S. 121) eingehender widmet. Relativ kompliziert erscheint der Fady-Kodex – auch für Madagassen – vor allem dadurch, dass er nur mit wenigen seiner zahlreichen Anwendungen überall im Land, bei allen ethnischen Gruppen und Schichten der Gesellschaft gültig ist. Zu groß ist die regionale Vielfalt: Eine bestimmte Handlung, eine Farbe, die in einem Gebiet verboten ist oder Unglück bringt, kann in der Nachbarethnie völlig akzeptiert und erlaubt sein. Besucher sollten sich also nach den örtlich angesagten Fady-Regeln erkundigen, besonders, was Gräber, Quellen, Flüsse und Seen betrifft. Auch wenn den vazaha (Fremden) so mancher Fauxpas großzügig nachgesehen wird, das absichtliche Übertreten eines fady (z. B. das Verrichten der Notdurft in der Nähe einer Grabstätte) sehen lokale Bewohner als grobe Beleidigung an. So manche Regel mutet uns unverständlich an, mag zu humorvollen Bemerkungen verleiten, doch wir sollten uns nicht zu respektlosen Äußerungen und Handlungen hinreißen lassen, denn die würden traditionsbewusste Madagassen verärgern und möglicherweise eine (finanzielle) Wiedergutmachung nach sich ziehen.
Fotografieren: „Afaka maka sary ve?“ („Darf ich ein Foto machen?“) Gerade in Zeiten des leider oft hemmungslosen Ablichtens von allem und jedem ziemt es sich, wenn Personen aufs Bild sollen, vor dem Druck auf den Auslöser höflich zu fragen. Selten wird der/die Fotograf(in) eine Absage erhalten. Kinder, allzeit beliebte Motive, rennen schon mal weg, um dann doch im Kreis der Spielkameraden zu posieren. Ältere Menschen und Markthändler verhalten sich manchmal verunsichert und lehnen ab, was man respektieren sollte. Wer die ergatterten Bilder im Display herumzeigt, erntet viel Heiterkeit und Dank, noch größer ist die Freude allerdings, wenn man die Fotografierten um ihre Adresse bittet und ihnen dann Papierabzüge oder Email-Dateien der Aufnahmen zukommen lässt. Fotos von Objekten wie Flugplätzen, Militäranlagen und Ministerien sind in der Regel nicht erlaubt. Auch Uniformierte dürfen nicht ohne Erlaubnis fotografiert werden.
Gespräche: Im Allgemeinen sind Madagassen unter sich, aber auch im Kontakt mit Fremden sehr kommunikationsfreudig – wenn da in Bezug auf die vazaha nicht die Sprachbarriere wäre. Kommt man sich jedoch entweder über etwas Französisch oder dank einiger Grußworte (siehe „Etikette, Körpersprache, Anrede“, S. 266) in Malagasy etwas näher, dann steht einer kurzen, fröhlichen Unterhaltung nichts im Weg. Mit Zeit für einen kleinen Schwatz sollte auch der ausländische Passant nicht geizen. Bei Gesprächen mit mehr Tiefgang, die bisher Unbekannte miteinander führen, halten sich Besucher im Land, aber auch jüngere und in der Sozialhierarchie tiefer stehende Personen mit zu persönlichen, eventuell unangenehmen Themen zurück – dazu gehört auch unverblümte Kritik an politischen, sozialen und kulturellen Zuständen. Ist dem/der Anderen an einem Austausch zu solchen Inhalten gelegen, dann kommt er/sie schon selbst darauf zu sprechen.
107ma-as
Beim Gruppenfoto herrscht Zutrauen gegenüber dem Fotografen
108ma-as
Ein Familienfest bietet reichlich Gesprächsstoff
Heilige Bäume, Königsgräber und -paläste, die Kraft spenden: Sei es der Rova (Königspalast) in Ambohimanga oder der von Ambositra, dort, wo einst Könige gelebt haben und nun begraben sind, üben sie ihre spirituelle Macht weiter aus. Noch heute kommen Madagassen an die heiligen Orte, um sich mittels kleiner Opfergaben (Kerzen, Getränke und Süßigkeiten, gelegentlich wird auch ein Huhn geschlachtet) Kraft zu holen oder sich für in Erfüllung gegangene Wünsche zu bedanken. Woanders sind alte Bäume (z. B. Banyan) wie der „Arbre Sacré“ bei Hellville (Nosy Be) Horte der metaphysischen Ausstrahlung, die auch von christlichen oder muslimischen Madagassen frequentiert werden. Ausländische Besucher sind dort stets willkommen, wenn sie die dort geltenden Fady-Regeln (s. S. 121) beachten.
Homosexualität: Gleichgeschlechtliche Beziehungen sind selten, Schwule und Lesben werden, wenn sie sich überhaupt als solche outen, häufig sozial ausgegrenzt. Sexuelle Kontakte unter homosexuellen Partnern stehen nicht unter Strafe, vorausgesetzt, beide Partner sind mindestens 21 Jahre alt (bei heterosexuellen Beziehungen liegt das gesetzliche Mindestalter bei 14 Jahren).
Kriminalität: Leider zählt Madagaskar zu den Ländern, die in unseren Medien oft nur anlässlich von Negativnachrichten auftauchen. Wer zum Thema Kriminalität genauer nachforscht, stößt tatsächlich auf Untaten wie Banditentum, brutale Lynchmorde, Sexualdelikte und Entführungen von (meistens indo-pakistanischen) Geschäftsleuten, Verbrechen, die die madagassische Öffentlichkeit Jahr für Jahr in Atem halten, die reisenden Besucher in der Regel aber nicht betreffen. Sie sollten sich allerdings vor Taschendieben in Acht nehmen, die vor allem in besonderen Gebieten der Großstädte, in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Touristenzentren ihre Zielgruppen auf geschickte Weise angehen. Solche potentiellen Risikofaktoren sind auch Thema im Kapitel „Trau, schau, wem – von ‚dahalo‘ und anderen ‚schrägen Vögeln‘ (Sicherheit)“ (s. S. 284).
Prostitution: Das Sex-Geschäft, dessen Motor hauptsächlich die Armut, aber häufig auch das Hoffen auf ein besseres Leben im Ausland ist, spielt sich in der Hauptstadt, in Großstädten und in einigen Touristenzentren wie auf der Insel Nosy Be, an der Bucht von Ifaty sowie im Umkreis von Bergbau- und anderen Industriegebieten ab. Prostituierte haben weder Gewerkschaft noch weitreichende Schutzinstitutionen. Sie bieten ihre Dienste vorwiegend ohne Zuhälter sowohl in Vollzeit wie auch nur gelegentlich und in Diskotheken, am Strand sowie in Städten auch auf dem Straßenstrich an. Bei Weitem nicht alle lassen sich regelmäßig auf Geschlechtskrankheiten untersuchen, ab und zu sind sie in Raubdelikte verwickelt und werden auch selbst Opfer von Gewalt. Noch immer gilt Madagaskar unter Päderasten als „Geheimtipp“; auch hier machen die miserablen Lebensbedingungen vieler Familien diese abstoßende Variante der Prostitution möglich. Das lokale Strafrecht sieht bis zu 20 Jahren Zwangsarbeit als Strafe für sexuellen Missbrauch von Kindern und Minderjährigen vor.
Pünktlichkeit: Die von Besuchern oft missverstandene Lebenseinstellung mora mora („gemach“, „immer mit der Ruhe“) bedeutet mitnichten, dass Madagassen unpünktlich sind oder sein wollen. Davon können z. B. Fahrer und Guides berichten, die im Gegensatz zu manchen ihrer ausländischen Kunden zur vereinbarten Zeit zuverlässig zur Stelle bzw. abfahrbereit sind. Verabredungen auf privater Ebene können da schon lockerer gehandhabt werden. Mehr dazu im Kapitel „Verabredungen und Ausgehen“ (s. S. 275).
Rauchen: Antirauchkampagnen sind auf dem Vormarsch, in Restaurants und vielen Hotely (einfachen Schnellgaststätten) herrscht schon seit einigen Jahren Rauchverbot, ebenso in öffentlichen Gebäuden und Privatunternehmen. Viele Hotels, auch der Mittel- und gehobenen Klasse, erlauben dennoch weiterhin den Nikotinkonsum in den Zimmern. Siehe auch das Kapitel: „Die Muntermacher – Freude und Fluch“ ab S. 227.
Schutzsymbole und -attribute: Die Furcht vor bösen Geistern und Hexe(r)n ist höchst lebendig. Tierische Hinterlassenschaften sollen davor schützen. So dienen z. B. die Panzer von großen Krabben und Schildkröten über oder vor der Haustür der Abwehr von nächtlichen Gefahren. Bestimmte Pflanzen wie Hasina vor dem Haus sollen den Bewohnern Glück und Gesundheit bringen. Vielerlei Amulette um den Hals oder am Handgelenk getragen (Armreife oder Münzen aus Silber, kleine, in Stoff gewickelte, auch menschliche, Knochenstücke) versprechen je nach ethnischer Zugehörigkeit der Menschen ebenfalls Schutz, Selbstvertrauen und Wohlergehen.
Trauer, Tod und Gräber: Verständlicherweise haben insbesondere westlich-moderne Besucher Berührungsängste mit dem, was alle Madagassen vereint: die intensive Beschäftigung mit dem Komplex Tod und Ehrerbietung den Verstorbenen gegenüber (siehe auch Verhaltenstipp „Ahnenverehrung“). Und doch kommt kein Fremder, der durch die weiten Hochplateauregionen reist, an dem Thema vorbei, sind dort doch die Familiengräber prominente Wahrzeichen der Landeskultur. Hier lernt man meist zum ersten Mal, dass die strengen Verhaltensgebote (fady, s. S. 121) jeden betreffen, auch Nicht-Madagassen. Die allgegenwärtige Präsenz von Tod und dem Leben danach und vor allem die ausgelassenen Graböffnungsfeiern (Famadihana, auch mit dem eher schaurigen Begriff „Totenumwendungsfest“ übersetzt), die in den Monaten Juli bis Oktober von den Hochlandbewohnern veranstaltet werden, verleiten den einen oder anderen Reisenden zu der Frage, ob Madagassen denn auch „richtig“ trauern. Ganz sicher, denn der Tod, der Verlust eines geliebten Verwandten oder Freundes geht allen Menschen gleichermaßen nahe und bringt neben dem Seelenleid viele Familien in größte wirtschaftliche Not, wenn z. B. der/die Ernährer(in) verstorben ist. Nachbarn, Bekannte und Kollegen sehen es als ihre moralische Pflicht an, ins Trauerhaus zu eilen, um der Trauerfamilie oder einem ihrer Mitglieder ihr Beileid auszusprechen und einen Umschlag mit einem angebrachten Geldbetrag (selbst 5000 Ariary bedeuten Wertschätzung) zu übergeben. Auch Ausländer, die von einem Todesfall im Freundes- oder Bekanntenkreis erfahren, bekunden auf diese persönliche Weise ihre Kondolenz. Mehr zum Thema „Familiengrab, Totenumwendungsfest“ steht im Kapitel „Famadihana – Rendezvous mit den Ahnen“ ab S. 148.
109ma-as
Diese beiden Vezo-Mädchen schützen sich mit einer Gesichtsmaske aus gestampftem Holz gegen Hitze und Sonne
Trinkgeld: „Pour boire“ („fürs Trinken“) ist der allgemein gebräuchliche französische Ausdruck im Land für das gewisse Extra, das außer in manchen Restaurants der gehobenen Klasse, wo die Rechnung eine Servicegebühr ausweist, zwar nicht obligatorisch ist, aber in der Regel vom Gast erwartet wird. Touristen und im Land lebende Ausländer stehen auf der Liste der potentiellen Geber verständlicherweise weit oben, doch auch unter bessergestellten Madagassen ist es üblich, z. B. die Rechnung in der Gasstätte aufzurunden, den Gepäckträgern in der Unterkunft ein paar Ariary-Scheine zuzustecken, dem Taxichauffeur, der geschickt und sicher den Stau umfahren hat, etwas mehr als das vereinbarte Fahrgeld zu geben. Busfahrer und Reiseleiter, die mehrere Tage lang die Gruppe von Touristen durchs Land, über Stock und Stein befördert und betreut haben, erwarten am Ende der Reise zu Recht eine Anerkennung, die ihr eher bescheidenes Salär aufwertet. Der Exkurs „Anerkennung oder Anmaßung – das verflixte Trinkgeld“ (s. S. 276) geht auf dieses zugegebenermaßen unter (besonders deutschen) Reisenden oft strittige Thema genauer ein.
Geologischer und geschichtlicher Hintergrund
Die Wurzeln
Der Fuß Gottes
Lage und Form eines Landes bereichern Fantasie und Mystik, wenn es darum geht, die Heimat als Mittelpunkt oder – wie bei Inselbewohnern beliebt – als Ursprung der irdischen Welt zu verstehen. Im Fall Madagaskar ähnelt der Umriss einem riesigen linken Fuß. Und dieser Fußabdruck, davon sind zumindest die Anhänger der „Madagaskar-ist-der-Nabel-der-Welt-Theorie“ überzeugt, ist der des Schöpfergottes Zanahary, der mit dem somit auserwählten Flecken Erde die Entwicklung auf dem Globus „losgetreten“ haben soll.
Die Position des Inselstaates ist das Resultat Jahrmillionen währender Erdplattentektonik. Nachdem Bewegung in die Landmasse des Urkontinents Pangea gekommen war, lösten sich Madagaskar, Indien und Australien – bis dahin mit Südamerika, Afrika und der Antarktis im gewaltigen Südkontinent Gondwanaland vereint – vor rund 250 Millionen Jahren nacheinander von Afrika. Die Abspaltung Madagaskars begann recht „spät“ vor etwa 200 Millionen Jahren, seit mindestens 60 bis 65 Millionen Jahren ist das Land durch die Straße von Mosambik von Afrika getrennt, blieb aber weiterhin mit der geologischen Struktur der Afrikanischen Platte verbunden. „Große Insel“ oder „Großes Land“ wird Madagaskar genannt, nicht nur weil es mit fast 590.000 km2 die viertgrößte Insel der Erde ist, sondern weil es außer vielfältigen Landschafts- und Klimazonen einmalige Naturschätze beherbergt. Dank der langen Isolation und speziellen Genese von Fauna und Flora haben hier Urzeitarten überlebt, die woanders längst ausgestorben sind.
Die Schöpfungsgeschichte auf Madagassisch
„Lang, lang ist es her,“ erzählt man in Madagaskar, „da war Zanahary allein auf dem Berg Ankaratra spazieren gegangen. Er war sehr traurig und einsam, denn es gab kein menschliches Wesen, mit dem er sich unterhalten konnte. So hatte er sich an einen seiner Vertrauten gewandt: ‚Lass uns lebendige Wesen auf dieser Erde schaffen, damit wir jemanden besuchen können, wenn wir zur Erde kommen.‘ Und Zanahary zeichnete auf den Boden einige menschliche Figuren. Dann warf er vom Himmel aus einige Pfeile darauf, und die getroffenen Figuren wurden lebendig. Dies war der Anfang aller lebenden Wesen in Madagaskar …“
(aus: Razafindramiandra, „Märchen aus Madagaskar“)
003ma-as
Auf den Spuren der ersten Siedler überquerte 1985 „Sarimanok“ den Indischen Ozean zwischen Indonesien und Madagaskar
Die ersten Madagassen (ca. 2. Jh. v. Chr.–ca. 1000 n. Chr.)
Für die Forscher ist gesichert, dass die ersten Madagassen von auswärts gekommen waren. Wann das genau gewesen sein könnte, bleibt allerdings weiterhin ein Rätsel. Es wird sogar für möglich gehalten, dass König Salomon in Madagaskar nach Gold suchen ließ. Schließlich waren bereits vor rund 3000 Jahren seefahrende Völker des Mittelmeerraumes und Anrainer des Indischen Ozeans in der Lage, über das offene Meer zu reisen.
Verlässt man sich nur auf die spärlichen Funde der Archäologen, könnte man vermuten, dass die ersten Menschen erst ab dem 8. Jh. n. Chr. hier gelandet sein dürften. Doch können menschliche Siedlungen nicht nur anhand von Scherben, Werkzeugen oder Knochen, sondern auch aufgrund von pflanzlichen Spuren nachgewiesen werden. So datiert Prof. H. Straka aus Kiel, einer der bekanntesten Pollenanalytiker (Palynologen), aufgrund langjähriger Forschungen an unterirdisch abgelagerten Reispollen am Itasy-See im madagassischen Hochland, zwei „Einwanderungswellen“: vom 2. Jh. v. Chr. bis ca. 1000 n. Chr. und noch einmal ab dem 15. Jh. n. Chr. Vieles spricht dafür, dass die ersten Menschen, die in so früher Zeit die Insel erreichen konnten, aus dem fernen Asien kamen und nicht, wie die geografische Nähe suggeriert, direkt aus Afrika.
Extrainfo 1(s. S. 9): Beitrag zur Erforschung von Pflanzenfossilien und deren Bedeutung für die Besiedlungsgeschichte Madagaskars (englisch)
Die „vazimba“ – Ureinwohner oder Fabelwesen?
In Legenden und in Reiseberichten sind sie oft erwähnt, die geheimnisvollen „vazimba“ („die, die schon immer da waren“). Mal werden sie als pygmäenhafte Jäger und Sammler beschrieben, mal als Ackerbauern. Für die einen sind sie dunkelhäutig, andere Berichte erzählen von scheuen, weißen Waldmenschen. Der Hautfarbe und anderer Körpermerkmale wegen wurde ihre Herkunft mal in Afrika, mal in Asien und immer wieder auch im Reich der Fabelwesen vermutet. Da helfen die Erkenntnisse der Linguisten weiter: Frühe wie spätere Einwanderer, Afrikaner wie Asiaten hätten sich stets in der austronesischen, also malayo-polynesischen Sprache verständigt. Demnach seien die „vazimba“ höchst wahrscheinlich aus einer Vermischung von frühen malaiischen Siedlern mit später eingewanderten Afrikanern bzw. mit Bantu-Gruppen entstanden.
Die Ur-Madagassen ziehen Forscher und Abenteurer magisch an. Wie die Ethnologin Lotte Schomerus-Gernböck, die 1966 in ihrem Buch „Im unerforschten Madagaskar“ berichtet: „… dass sie (die ‚vazimba‘, Anm. d. Autors) nach der Überlieferung der jetzigen Bewohner des Hochlandes, in der Gegend der heutigen Hauptstadt Antananarivo gewohnt haben sollen. Sie seien wild und kriegerisch gewesen, hätten aber dennoch von den ‚Hova‘ (die Klasse der Freien bei den Merina, Anm. des Autors) verdrängt werden können … Nachkommen von ihnen sollten heute noch ‚irgendwo’ im Westen leben. Auf dem Hochland selbst hatten die ‚vazimba‘ Eigenschaften von Geistern angenommen, die den Menschen Gutes oder Böses antun können und jeden, der sie beleidigt, mit Krankheit und Tod bestrafen.“
Der Amerikaner Mark Eveleigh, der den Ureinwohnern erfolglos nachgespürt hatte, musste einsehen: „In einem Land, in dem das tägliche Leben von übernatürlichen Mächten beherrscht wird, darf es nicht verwundern, wenn man zu hören bekommt, dass die ‚vazimba‘ von heute unsichtbar sind, telepathische Fähigkeiten besitzen und die Macht haben, ahnungslose Wanderer mit einem Fluch zu belegen, wenn diese ihrem Versteck zu nahe kommen.“ (aus: Mark Eveleigh „Madagaskar, der sechste Kontinent“)
Auch wenn es die „vazimba“ höchst wahrscheinlich seit dem 17. Jh. als eigene Ethnie nicht mehr gibt, leben diese Ureinwohner im Traditionsglauben und in Sprichwörtern fort. Und da sie für die meisten Hochlandbewohner als die ältesten Vorfahren gelten, rangieren sie in der Ahnenverehrung ganz oben. Sogar einige der ersten Merina-Könige sollen von ihnen abstammen. Noch heute führen sich vereinzelte Merina-Klans wie die Antehiroka auf die „vazimba“ zurück. Die Spuren der Ureinwohner finden sich vielerorts im Land. In der Hauptstadt und sogar im UNESCO-Schutzgebiet von Bemaraha ist man auf Vazimba-Gräber gestoßen.
Das asiatische Erbe – die weite Anreise über den Indischen Ozean
Im Jahr 1985 erregte die spektakuläre Fahrt der „Sarimanok“ weltweites Aufsehen, vor allem in Madagaskar, dem Ziel ihrer Reise. Das Boot kam von Indonesien aus 7000 km weit über den Indischen Ozean gesegelt, um in der Frage „Woher und wie kamen die ersten Menschen nach Madagaskar?“ neue Antworten zu ermöglichen. Der internationalen Crew aus Seeleuten und Wissenschaftlern unter Leitung von Bob Hobman – darunter ein Experte für Gestirnnavigation, eine Ernährungsexpertin als einzige Frau und der Autor dieses KulturSchock-Bandes – war nach mehr als sieben abenteuerlichen Wochen auf hoher See und unter annähernd vorzeitlichen Bedingungen der Nachweis gelungen, dass eine direkte Überquerung des drittgrößten Weltmeeres auch schon vor rund 2000 Jahren praktikabel war.
Wie die austronesischen Vorbilder hatten sich die neuzeitlichen Migranten auf der „Sarimanok“ Sonne, Mond, Sternen, dem Passatwind und der südäquatorialen Meeresströmung anvertraut. Diese konstante Kraft von Ost nach West (einige Breitengrade nördlich des Äquators wirkt ein Strom in umgekehrte Richtung) ist ein zuverlässiges Argument für eine Einwanderung über das offene Meer. Hat sie doch im Jahr 1883 sieben Wochen nach Ausbruch des Krakatau vor Westjava Bims- und Aschepartikel bis an Madagaskars Ostküste geschwemmt! Überdies war die „Sarimanok“ als Auslegerboot in der bewährten Mehrrumpfbauweise konstruiert, die sie philippinischen und indonesischen Bootsbauern verdankte. Die wiederum hatten ihre Fertigkeiten von den Vorfahren geerbt. (Unter einem Auslegerboot versteht man meist einen Einbaum, mit dem ein oder zwei Schwimmkörper bzw. Nebenrümpfe durch Ausleger verbunden sind, quasi eine Grundform von Katamaran bzw. Trimaran.) Den asiatischen Einfluss auf die bis heute in ostafrikanischen Gewässern präsente Bootsbautechnik stellt Hermann Winkler in seinem umfassenden Buch „Segler vor Ostafrika“ (2009) heraus: „Es gilt … als erwiesen, dass die afrikanischen Auslegerkonstruktionen von malaiischen Einwanderern nach Madagaskar gebracht worden sind, um sich dann später auch entlang der Festlandküste des Kontinents zu verbreiten.“
Warum Südostasiaten diese weite Reise gen Westen erstmals unternommen haben, bleibt auch weiterhin ein Rätsel. Man geht davon aus, dass die Austronesier Madagaskar sowohl auf der direkten Route über den Indischen Ozean als auch in Etappen entlang der Küsten von Sumatra, Indien und der Arabischen Halbinsel erreicht haben. Bis zu dem Zeitpunkt, als die „Sarimanok“ dort vor Anker gehen konnte, hatten Wissenschaftler eher der zweiten Variante den Vorzug gegeben.
Extrainfo 2(s. S. 9): Hintergrund zur Besiedlung Madagaskars, neue wissenschaftliche Daten und Erkenntnisse sowie Links zu weiteren interessanten Beiträgen (englisch)
Die Überquerung des Indischen Ozeans gilt als eine der bemerkenswertesten Wanderungsbewegungen der Menschheit. In der Fachwelt wird seit der Fahrt der „Sarimanok“ wieder angeregt diskutiert. Viele offene Fragen warten weiterhin auf Antworten – oder müssen ungeklärt bleiben.
Fest steht, dass die mutigen Seefahrer aus dem Osten im Lauf der gezielten Einwanderung, die, wie oben erwähnt, in mehreren „Wellen“ stattgefunden haben muss, allerlei für eine Besiedlung nützliche Dinge und Kenntnisse an Bord hatten. Neben organischen Mitbringseln wie Bergreis, Taroknollen, Jamswurzeln, Süßkartoffeln, Brotfrucht, Kokosnuss, Bananen und anderen Agrarfrüchten waren das Musikinstrumente (z. B. eine Bambuszither, valiha, und eine Bambusflöte, sodina) und Werkzeuge, Fischerei- und Handwerkstechniken (die Auslegerbootkonstruktion, das Prinzip des rechteckigen Haus- und Gräberbaus, die Ausrichtung der Hauslängsachse von Nord nach Süd, das für die indonesische Schmiedetechnik typische Zweizylindergebläse etc.).
Und die Asiaten brachten wichtige, bis heute in Madagaskar fest verankerte soziale und kulturelle Komponenten mit, an erster Stelle die Ahnenverehrung und Bestattungsriten. Ebenso weisen das Errichten von Steinsäulen und Grabskulpturen zum Gedenken an die Vorfahren sowie das Verwandtschaftssystem, Höflichkeitsformen und Ausdrucksweisen der mündlichen Literatur in die indonesische Richtung. Nicht zuletzt ist das Malagasy, die Sprache der Madagassen, ein austronesisches Erbe. Als einheitliche Sprache hat es sich in seiner Grundform behauptet, trotz der im Lauf der Zeit erfolgten Anpassung u. a. an afrikanische Bantu-Einflüsse.
Drehscheibe der Kulturen – Asien trifft Afrika (ca. 3. Jh. n. Chr.–13. Jh. n Chr.)
Die Mehrzahl der gesellschaftlich und technologisch bedeutsamen Elemente in Madagaskar ist eindeutig indonesischer Herkunft. Doch auch die Kontakte mit Afrika hinterließen prägnante Spuren. Im physischen Erscheinungsbild des Menschen dominieren Komponenten, die die Verwandtschaft mit dem Nachbarkontinent nahelegen. Das fällt besonders bei einigen Volksgruppen wie den Bara, Sakalava und Tsimihety auf. Sie verdanken der Bantu-Kultur neben verschiedenen Musikinstrumenten und Nutzpflanzen auch wichtige sozialrelevante Einflüsse wie Anteile am Vokabular und sprachliche Ausdrucksformen, die Bedeutung des Rindes, die Verehrung von Königen und das Phänomen der tromba (Trance, Besessenheit und die entsprechenden Heilverfahren), das hauptsächlich bei den Sakalava und Bara zu beobachten ist.
Laut Robert Dick-Read, Autor von „The Phantom Voyagers“ (2005), haben frühe asiatische Seefahrer ihre Spuren auch in Zimbabwe und im heutigen Nigeria hinterlassen. Ein Großteil der afro-indonesischen Entwicklung, die in Madagaskar zu finden ist, hätte demnach schon vorher in Ost- und Westafrika stattgefunden.
Als Vasco da Gama 1498 den Seeweg nach Indien fand, waren zwischen Indien und Ostafrika schon seit gut einem Jahrtausend asiatische Handelsschiffe auf eingefahrenen Routen unterwegs, deren östliche Abzweigungen China und den indonesischen Archipel abdeckten. Es ist also nicht abwegig, dass sich in Folge dieser Geschäftsbeziehungen malaiische Migranten mit Bantu-Menschen mischten. Die Bantu sind vom 5. bis 8. Jh. aus dem Innern des Kontinents an die ostafrikanische Küste gewandert und Ende des 8. Jh. unter arabisch-islamischen Einfluss geraten.
Arabische Einflüsse: Gewürze, Sklaven, Astrologie und Koran (ca. 8. Jh.–16. Jh. n. Chr.)
„Salamo!“ Landauf, landab ist der Gruß zu vernehmen. Er klingt vertraut, steckt doch darin das arabische Wort „salām“ für „Frieden“. Einer von vielen Begriffen im Malagasy, die auf afrikanisch-arabische Ursprünge zurückgehen. Eine große Zahl der madagassischen Moral- und Taburegeln, der fadys, leitet sich von der islamischen Lehre ab. (Siehe dazu auch das Kapitel „Glaube, Religion und Kirche“ ab S. 113)
Ab dem frühen 8. Jh. n. Chr. bis ins 16. Jh. waren die Häfen an der madagassischen Nordwest-, Nord- und Nordostküste begehrte Ziele für swahilisch-arabische Händler, die weniger die Verbreitung des Islam als vielmehr neue Märkte für Edelhölzer, Gewürze, Textilien und später auch für Sklaven anvisierten. So befindet sich beispielsweise in Mahalika, südwestlich von Ambanja gelegen, die älteste Moschee Madagaskars. Andere islamisierte Gruppen gründeten Königreiche im Inselsüden und siedelten auf der Insel Sainte Marie sowie an der südlichen Ostküste.
Heutige Reisende schauen sich in dem Städtchen Ambalavao gern die Vorführung der traditionellen Papierherstellung auf Antaimoro-Art an. In Kurzversion erfahren sie, dass die Vorfahren der im Osten Madagaskars lebenden Antaimoro („Menschen des Ufers“) arabische Seefahrer waren, die mittels der Schöpftechnik ihre Koranbücher erneuern konnten.
Die Einwanderung der Araber im 15./16. Jh. löste einen enormen Zivilisationsschub aus: dank ihrer exzellenten astrologischen Kenntnisse, ihres lebendigen Wissens um die Magie und – ein für die weitere Entwicklung höchst wertvolles Kulturgut – dank ihrer Schrift. (Siehe auch „Die halbe Welt auf einer Insel – Zusammensetzung der Bevölkerung“ ab S. 96.)
005ma-as
Im späten 15. Jahrhundert erscheint Madagaskar auf der Weltkarte
Spätestens jetzt leuchtet ein, wie sehr Madagaskars Besiedlung und kulturelle Entwicklung einem bunten, verwirrenden Mosaik gleicht. Daher soll auch der Sklavenhandel als Einwanderungsquelle erwähnt werden. Die öfter vernehmbare Pauschalisierung, die negriden Züge vieler Madagassen seien mit den „zwangsweise eingewanderten“ Afrikanern zu erklären, greift schon deswegen nicht, weil der Menschenhandel im großen Stil eher von Madagaskar ausging, als dass er im Lande florierte. Es waren die Portugiesen, die in diesem Geschäft ab dem frühen 16. Jh. zu ernsthaften Konkurrenten für die Araber wurden. Sie verschifften Madagassen nach Indien, verkauften sie auf den Märkten von Mauritius und Réunion, ja sogar in Amerika. Auch für einige weiße Piraten und Händler war Menschenware aus Madagaskar ein lukrativer Posten und es mangelte nicht an Nachschub. Besonders die Merina, in deren Sozialsystem die Klasse der Sklaven fest verankert war, profitierten davon. Sklaven waren für sie der drittwichtigste Exportartikel – nach Rindern und Reis. Auch die kriegerischen Sakalava handelten bei den Weißen ihre Leibeigenen gegen moderne Waffen ein. Abgeschafft wurde die Sklaverei in Madagaskar erst 1896 mit Beginn der französischen Kolonialherrschaft.
Der Traum des Marco Polo (ca. 1294–1500)
Schon in der Antike strebte die Sehnsucht südwärts. Herodot berichtet, dass Pharao Necho um 600 v. Chr. eine Flotte ausgesandt hatte, die durch das Rote Meer und rund um Afrika segeln sollte. Offenbar mit Erfolg, denn nach drei Jahren kehrte die Expedition – über die Straße von Gibraltar – ins Mittelmeer zurück. Später transportierten griechische und römische Schiffe Elfenbein und Gewürze aus Ostafrika herbei. Ptolemäus (ca. 100 bis ca. 175 n. Chr.) erwähnt die Insel Menouthias. Einige Gelehrte halten sie für Madagaskar, weitaus mehr Kollegen tippen jedoch auf Sansibar.
Zweifellos wartete „da unten“ etwas Verlockendes. Das muss auch Marco Polo (ca. 1254 bis 1324) inspiriert haben, als er um 1294 über das geheimnisvolle „Madeigascar“ schrieb, ohne jemals dorthin gekommen zu sein. Wie gern hätte er die rukhs, die damals dort wohl noch lebenden Riesenvögel gesehen, von denen er in Arabien gehört hatte: „Sie sind so mächtig, dass einer allein einen Elefanten hoch in die Lüfte tragen kann, um ihn dann auf die Erde fallen zu lassen, wo er das zerschmetterte Tier dann leicht verspeisen konnte.“ (Er schrieb von dem inzwischen ausgestorbenen 3 m hohen Vogel Aepyornis Maximus, auch „Elefantenstrauß“ genannt, der noch vor rund 800 Jahren die Insel durchstreifte.) Doch aufgrund des inzwischen in der Region erstarkten Islam trauten sich europäische Kapitäne zu Marco Polos Zeiten nicht mehr in die Gewässer zwischen Arabien und Ostafrika, und so musste der berühmte Venezianer sowohl auf „Madeigascar“ wie auch auf „Mogelasio“ verzichten. Mit beiden Namen, so wird angenommen, meinte er wahrscheinlich Mogadischu.
Jedenfalls überdauerte Madagaskar als Traumziel europäischer Seefahrer die folgenden zwei Jahrhunderte. 1492 fügte der Nürnberger Martin Behaim (1459–1507) die „Madagascar Insula“ gewissermaßen unbesehen seinem berühmt gewordenen „Erdapfel“ (Globus) hinzu. Mittlerweile waren auch andere Bezeichnungen für die Insel im Umlauf, wie Phebol, Manuli, Matecassi und Qmor („Insel des Mondes“, wie im arabischen Raum die Komoren genannt wurden). Es war übrigens ein Araber, der Geograf Edrici, der 1153 die älteste bekannte Karte des Landes zeichnete.
Als 1498 die Portugiesen im Indischen Ozean die arabische Vorherrschaft herausforderten, rückte die unbekannte Insel deutlicher ins europäische Visier. Zwei Jahre später ging der weiße Mann dort an Land – allerdings eher unbeabsichtigt. Diego Diaz war mit seinem Schiff vom Kap der Guten Hoffnung weit nach Nordosten abgetrieben worden. Am 10. August 1500 kam Land in Sicht und Diaz stellte überrascht fest, dass er nicht vor Mosambiks Küste, sondern vor einer großen Insel ankerte. Und da es der Festtag des St. Lorenz war, taufte er sie „São Lourenço“. In Lissabon erregte die Nachricht Aufsehen, schnell erinnerte man sich an den Kaufmann aus Venedig – das musste es sein, Marco Polos „Madeigascar“! Allerdings bürgerte sich die Bezeichnung „Madagaskar“ erst im 17. Jh. ein. Auf der Insel selbst, wo man sich bislang mit den jeweiligen Königreichen identifiziert hatte, wurde der Name offiziell noch später eingeführt – im Jahre 1819 unter König Radama I., der sich fortan Radama Mpanjaka Madagasikara („Herrscher von Madagaskar“) nennen ließ.
Häuptling oder König?
In den historischen Quellen, die (abgesehen von den „sora-be“) in schriftlicher, chronologischer Form erst seit Eintreffen der Weißen vorliegen, verschwimmt zuweilen die Grenze zwischen den Begriffen „Häuptling“, im Sinne von Führer einer sich von einem gemeinsamen Vorfahren ableitenden, auf eher kleinem Areal siedelnden Verwandtschaftsgruppe, auch „Klan“ oder „Stamm“ genannt, und „König“, der zumindest nach unserem Verständnis Herrscher über ein ausgedehntes Reich und Untertanen verschiedenster Herkunft ist.
Dies ist jedoch nur ein Beispiel dafür, wie die europäisch-westliche Betrachtungsweise fremder Kulturen die indigene Terminologie im Kolonialinteresse ignoriert oder verändert hat und sie dann, angepasst an die eigene Weltsicht, den Zeitgenossen in den beschriebenen Kulturen zurückgibt. Die Fachliteratur ist reich an solchen Fällen, schließlich hat die damalige „Völkerkunde“ (Ethnologie) der Kolonialpolitik in sehr effizienter Weise zugearbeitet. (Siehe dazu auch im Kapitel „Die halbe Welt auf einer Insel – Zusammensetzung der Bevölkerung“ u. a. die kritischen Bemerkungen des Historikers Dr. Solofo Randrianja auf S. 96).
Prägende Geschichtsereignisse (1500–1947)
Die Begründung der Merina-Dynastie (ca. 1500 n. Chr.)
„Ny mpanjaka toy ny afo: raha halavirina mangatsiaka,
ary raha akkezina mahamay.“
„Der König ist wie das Feuer: Bleibt man ihm fern, friert man;
kommt man ihm zu nahe, verbrennt man sich.“
(Madagassisches Sprichwort)
Als an der Nordspitze Madagaskars die Portugiesen auftauchten, lebte einige Hundert Kilometer südlich im Dorf von Imerimanjaka, nahe des heutigen Antananarivo, die Vazimba-Frau Rangita. Von ihr berichtet eine der tantaran’ny andriana