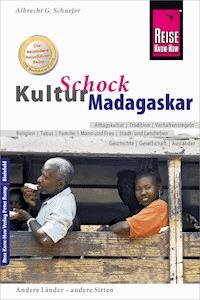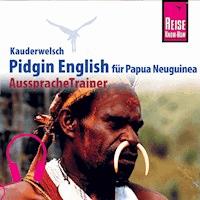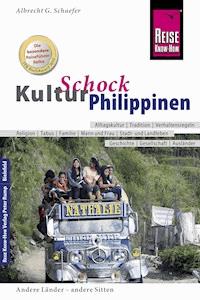
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reise Know-How Verlag Peter Rump
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Kulturschock
- Sprache: Deutsch
KulturSchock Philippinen ist der informative Begleiter, um die Philippinen und ihre Bewohner besser zu verstehen. Er erklärt die kulturellen Besonderheiten, die Denk- und Verhaltensweisen der Menschen und ermöglicht so die Orientierung im fremden Reisealltag. Unterhaltsam und leicht verständlich werden kulturelle Stolpersteine aus dem Weg geräumt und wird fundiertes Hintergrundwissen zu Geschichte, Gesellschaft, Religion und Traditionen vermittelt. Dazu: Verhaltenstipps A-Z mit vielen Hinweisen für angemessenes Verhalten, Verweise auf ergänzende und unterhaltsame Multimedia-Quellen im Internet, Literaturempfehlungen zur Vertiefung … Eine Welt aus Wasser und Land - auf den 7107 Inseln des Archipels zeigt sich die Lebensart der Menschen extrem vielschichtig. Bedingt durch eine lange Kolonialzeit findet man auf den Philippinen sowohl Spuren der westlichen wie der östlichen Kultur. Um Investoren und Touristen zu locken, wirbt man gerne mit den Folgen der weltweit längsten Kolonialzeit, die zweifellos das Verhalten und Wertesystem der Menschen beeinflusst hat. Doch die westlich geprägte Komponente ist sehr oft Putz, Fassade einer ethnisch stark gemischten Gesellschaft mit Ursprüngen in vielen Teilen Asiens – und Europas. Wer in dem landschaftlich ausgesprochen reizvollen Land unterwegs ist, erlebt ein kulturelles Gemenge der besonderen Art. Besucher der philippinischen Inselwelt stellt der Kultur-Spagat vor die spannende Herausforderung, hinter der vermeintlich vertrauten, westlichen Fassade die asiatischen Wurzeln zu erkennen, um nicht über sie zu stolpern. Dieser Band bietet nicht nur einen kompakten Einblick in Geschichte und Gegenwart des Landes, sondern zeigt mit viel Einfühlungsvermögen auch Hintergründe der aktuellen gesellschaftspolitischen Problemfelder auf und macht dabei Lust, die gastfreundlichen Menschen selbst kennenzulernen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 530
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Vorwort
Eine Welt aus Wasser und Land, insgesamt 300.000 Quadratkilometer groß und von über 100 Millionen Menschen bevölkert, bietet eine kaum vorstellbare Vielfalt an Landschaftseindrücken. Nicht weniger abwechslungsreich ist das kulturelle Spektrum, das den Besucher erwartet. Die Philippinen waren nicht nur seit Jahrtausenden Ziel und Ausgangsbasis für Wanderungsbewegungen im südostasiatischen und pazifischen Raum, sondern auch Objekt der Begierde für europäische Seefahrer, was eine über drei Jahrhunderte währende Herrschaft der Spanier begründete und damit die am längsten währende Kolonialzeit, die ein Land je zu erdulden hatte. Die neuere Geschichte des südostasiatischen Staates, in dessen Landesnamen weiterhin der spanische König Philipp seinen Platz behauptet, brachte anschließend, unterbrochen durch die japanische Besatzung während des Zweiten Weltkrieges, eine erneute koloniale Abhängigkeit: 50 Jahre lang fühlten sich die USA berufen, die philippinischen Menschen auf den „rechten Weg der modernen Zivilisation zu geleiten“.
Entsprechend vielschichtig zeigt sich die Lebensart, die den Fremden in dem aus 7107 Inseln bestehenden Archipel erwartet. Die Philippinen sind kein Ziel des Massentourismus, auch wenn es zu bestimmten Jahreszeiten mancherorts danach aussehen mag. Hierzulande haben nur wenige Veranstalter das Inselreich im Angebot. Die sich wiederholenden Naturkatastrophen, die darauf folgenden Negativschlagzeilen, aber auch die vermeintlich größere „Exotik“ anderer Länder der Region Südostasien mögen Gründe dafür sein. Umso mehr liegt der Reiz für Philippinenreisende im Entdecken und Erkennen der eigenständigen Kultur, deren augenfälligstes Merkmal paradoxerweise darin liegt, dass sie sich in vier Jahrhunderten Kolonialgeschichte eine westliche Fassade zugelegt hat. Eben diese ruft bei Fremden zunächst Verwunderung, manchmal Verwirrung hervor. Hinter sie zu blicken, ist aber auch die Herausforderung, für die der Autor dieses Buches, zusammen mit den hoffentlich zahlreichen zwischenmenschlichen Begegnungen unterwegs, den Reisenden Anreize geben möchte. Denn die westlich-moderne Attitüde vieler Filipinos und deren freundliche Toleranz auch dem Fehlverhalten anderer gegenüber, mag Ausländer aus Europa, Amerika oder Australien dazu verleiten, den eigenen kulturellen Hintergrund, die vertraute Gefühlswelt auf die besuchten Menschen zu übertragen, zu erwarten, dass diese direkt verstanden wird.
„Filipino“ ist nicht nur der Name der nationalen Sprache, sondern auch die Nationalitätsbezeichnung und wird im nachfolgenden Text i. d. R. als „gemeinsamer Nenner“ für alle Bewohner – männliche wie weibliche – verwendet. Den zu erwartenden Erfahrungen der meisten Leser angepasst, stellt das Buch insbesondere Eigenheiten der „Tiefland-Filipinos“ vor und hinterfragt sie. Einige Kapitel beschäftigen sich darüber hinaus mit indigenen Bevölkerungsgruppen.
Auch wenn vieles, erleichtert durch die landesweit recht gut kommunizierbare englische Sprache, vertraut erscheinen mag, gibt es jede Menge lokaltypischer Kulturfacetten. Dabei zu helfen, sie auszumachen, zu verstehen und sich ihnen entsprechend zu nähern, ist ein wichtiges Anliegen des „KulturSchock Philippinen“. So gelingt es hoffentlich, Berührungsängste abzubauen und den global dringend benötigten „sanften“ Tourismus – namentlich durch Geduld, Höflichkeit, Toleranz und Zurückschrauben eigener Ansprüche sowie Wertmaßstäbe anzustoßen. Sicher wird die Bereitschaft, sich mit den kulturellen Eigenarten anzufreunden, mit der Länge des Aufenthaltes im Gastland steigen. Doch auch die Besucher, die nur ein paar Wochen in den Philippinen reisen oder arbeiten, sind eingeladen, sich dem Kulturschock zu stellen. Es ist ein echtes Abenteuer, weil es anregt, auch die eigenen Normen und ethischen Grundlagen, Essgewohnheiten und Gesten zu hinterfragen. Wer wagt gewinnt!
Zur Entstehung des Buches: Einige Recherchen und eigene Erlebnisse des Autors fielen in die Zeit während des Übergangs zwischen zwei Regierungen, von denen die aktuelle vieles besser und anders machen will, auf teilweise sehr drastische Weise. Nicht auf alle dieser angekündigten und teilweise schon umgesetzten Neuerungen kann an dieser Stelle genauer eingegangen werden. Nichtsdestotrotz empfehle ich Philippinenreisenden das aktuelle Tagesgeschehen, gerade vor dem Hintergrund der derzeitigen Entwicklungen im Land, in den Medien zu verfolgen.
Ich wünsche Ihnen eine kurzweilige Lektüre!
Albrecht G. Schaefer
Dank
In dankbarer Erinnerung an Estelita Sevillo „Esteling“, die selbst an materiellen Gütern nie viel besaß und doch so viel geben konnte – an Verständnis und Menschlichkeit.
Extrainfos im Buch
ergänzen den Text um anschauliche Zusatzmaterialien, die vom Autor aus der Fülle der Internet-Quellen ausgewählt wurden. Sie können bequem über unsere spezielle Internetseite www.reise-know-how.de/kulturschock/philippinen17 durch Eingabe der jeweiligen Extrainfo-Nummer (z. B. „#1“) aufgerufen werden.
Inhalt
Verhaltenstipps von A bis Z
Die geschichtlichen Wurzeln
Ein rastloser Vogel zwischen Himmel und Erde
Erste Siedler, Vorfahren der heutigen „Ureinwohner“ (ab ca. 250.000 v. Chr.)
Prägende Geschichtsereignisse und Personen (1521–1935)
Die jüngere Geschichte
Geschichtstabelle
Der kulturelle Rahmen
Zusammensetzung der Bevölkerung
Religion und Kirche
Glaube und Aberglaube
Feste, Bräuche, Traditionen
Denkweisen und Verhaltensformen
Die Gesellschaft heute – Staat, Politik und Wirtschaft
Politische Landschaft in Asiens ältester Demokratie
Staatsaufbau, Gesetz, Korruption, Militär
Wasserbüffel und Mega-Malls: zur Wirtschaftslage und Konjunktur
Die soziale Pyramide, Privilegierte und Unterprivilegierte
Einkommensverhältnisse und Sozialsysteme
Fremde im eigenen Land – ethnische Minderheiten
Inseln der Hoffnung – Einwanderungs- und Fremdenproblematik
Separatismus, Terrorismus und Kriminalität
Geschlechter und Familie
„Malakas“ und „maganda“ – Mann und Frau
Frauen in der Gesellschaft
Hochzeit und Familie
Kinder in der Gesellschaft
Der Lebenszyklus: Geburt, Jugend, Alter, Tod
Der Alltag
Arbeitsleben – drei Beispiele
Flüssige und rauchende Laster
Gesundheit und Hygiene
Kino, Musik und Theater
Imitation und indigenes Erbe – Mode und Zeitgeschmack
Natur- und Umweltschutzdenken
Blick über den Horizont – Rundfunk, TV, Internet und Presse
Das Leben ist ein Spiel – mancher verspielt es
Sport, Freizeit, Urlaub
Sprache, Schrift, Literatur
Sehen und gesehen werden – Treffpunkte
Haus, Hütte oder Villa – Wohnen
Als Fremder im Kulturkreis
Das Bild von Touristen und von Deutschen
Was dem Fremden sofort auffällt
Begegnungen, Begrüßungen, Verabschiedung
„Haben Sie schon gegessen?“ – Gastfreundschaft
Verabredungen und Ausgehen
Zu Gast in der Familie
Reisen geht durch den Magen – Ess- und Trinkkultur
Namen und Anrede
Wer das Wort hat – Gesprächsverhalten
Wenn zwei sich streiten, vermittelt der Dritte – Konfliktverhalten
Umgang mit Behörden und Polizei
Schlagzeilen aus dem „wilden Osten“ – die Sicherheitslage
Der Weg ist das Ziel – Verkehr und Transportmittel
Anhang
Literaturtipps
Informatives aus dem Internet
Register
Übersichtskarte Philippinen
Der Autor
Exkurse zwischendurch
Rote Mützen, roher Reis, Kanonendonner – die erste Begegnung
Der Galeonenhandel – Drehscheibe zwischen Asien, Amerika und Europa
Mi Último Adiós
Auserwähltes Land des Morgens
Climaco, der Held von Zamboanga
„Ich sagte Paoay, nicht Hawaii“
Pinatubo – ein Vulkan mischt sich ein
Präsident Rodrigo Duterte – mehr als ein Poltergeist?
Geist- oder Wunderheiler, Scharlatanerie oder Naturheilkunde
Kollektive Lebensfreude auf Rädern – der Jeepney
Landreform – eine unendliche Geschichte
Die Stufen zum Himmel – die Ifugao-Reisterrassen
Begegnung der Revolverhelden
Die ewige Nummer zwei
Sungka – das Brett für den (kühlen) Kopf
Verhaltenstipps von A bis Z
Aberglaube: Unter modernen, westlich-christlich erzogenen Filipinos scheinen metaphysische Erscheinungen wie nächtliche Geister oder die Wirksamkeit von Amuletten und Zeichen höchstens mit einem Lächeln registrierte Phänomene zu sein, die sie eigentlich nicht betreffen. Doch wie so vieles im Verhalten der Menschen ist diese Reaktion oberflächlich. Immer noch werden Kinder mit der Warnung vor blutsaugenden aswang (s. S. 108) am Abend ins Haus gerufen, auch Hochschulabsolventinnen erscheint manchmal in der Nacht eine white lady (s. S. 106) und oft genug denkt mancher sich versehentlich auf die Lippe beißende Politiker ernsthaft darüber nach, wer gerade wohl schlecht über ihn spricht. Wenn ein Löffel während der Mahlzeit zu Boden fällt und tatsächlich ein weiblicher Gast auftaucht, freut man sich, dass die Sprüche der Großeltern doch nicht ganz von gestern sind. Alte Bräuche und mit Traditionen eng verknüpfte Aktivitäten wie der Hausbau, die Aussaat und Ernte, die Beschneidung, der erste Haarschnitt oder der Hahnenkampf gehen auch in den Philippinen des dritten Jahrtausends immer noch einher mit Ritualen und Prozeduren, die wir „abergläubisch“ nennen würden. Auf dem Land und besonders bei verschiedenen ethnischen Gruppen ist sehr oft keine klare Unterscheidung zwischen Aberglaube und Glaube an die Mächte der Natur und der Vorfahren zu treffen (siehe auch das Kapitel „Glaube und Aberglaube“ ab Seite 106, insbesondere „Von Blutsaugern, Hexern und Heilern“ ab Seite 108).
Ahnenverehrung: Indigene Filipinos identifizieren sich eindeutig mit ihrer genealogischen Herkunft, d. h. die Ahnen, die ihnen Land, Kultur und Religion hinterlassen haben, verlangen unaufhörlich nach Respekt und Achtung. Prominent sind die Bergvölker im Norden von Luzon, wo allein beim Anblick der seit Jahrtausenden bestehenden Reisterrassen jeder Besucher den Einfluss spürt, den die frühen Filipinos auf ihre Nachfahren ausüben. Zuweilen lernen Fremde dabei auch, wie sehr Konflikte zwischen Ahnenverehrung und modernen, bürokratischen und auf ökonomische Erfolge abzielenden Interessen die Gesellschaft spalten. Themen wie Landraub, Abholzung, Vertreibung durch Minengesellschaften oder Staudammprojekte haben leider auch in den postkolonialen Philippinen Tradition. Darauf geht u. a. das Kapitel „Fremde im eigenen Land – ethnische Minderheiten“ ab Seite 171 mit den Unterkapiteln „Die ersten Filipinos auf den hinteren Plätzen“ ab Seite 173 sowie „Im Fadenkreuz der Mächtigen“ ab Seite 176 ein. Auch die sogenannten „Tiefland-Filipinos“, eine andere Bezeichnung für die modernen, mehrheitlich christianisierten Bewohner der Inseln, halten ihre durch die Kolonialgeschichte zuweilen sehr gemischte Abstammungsgeschichte in Ehren. Das drückt sich z. B. in großen Familienzusammenkünften, der Pflege der Familiengrabstätten, dem gemeinhin zu verteidigenden Landbesitz aus und in der traditionell oral vermittelten Historie der Vorfahren, die oft bis zum Beginn der spanischen Kolonisation oder noch weiter zurückreichend erzählt werden kann.
AIDS: Mehr als zuvor stellt die seit 1984 im Land festgestellte, global präsente Krankheit in den Philippinen ein sehr ernstes Problem dar. Nachdem die neue Bedrohung unter der Marcos-Diktatur kaum ernst genommen wurde, gehen seit den 1990er-Jahren staatliche Institutionen, kirchliche und gesellschaftliche Gruppen mit offensiven Aufklärungskampagnen an die Öffentlichkeit. Die weite Verbreitung von Prostitution vor allem in urbanen und touristischen Zentren sowie in Hafenstädten liefert eine schwierig zu kontrollierende Ansteckungsbasis. Als der philippinische Kongress noch zu Regierungszeiten von „Noynoy“ Aquino auf Druck der katholischen Kirche – zumindest mit ihrer wohlwollenden Zustimmung – den kostenlosen Zugang zu Verhütungsmitteln wie Kondomen stoppte, stieg die Zahl der Neuinfizierten besonders in den armen Bevölkerungsteilen sprunghaft wieder an. Der Anstieg der Infizierten unter Jugendlichen bereitet nun auch dem Gesundheitsministerium der Duterte-Regierung Sorge. Dieses plant, ab 2017 Kondome in Schulen gratis zu verteilen. 2016 warnten UN, staatliche wie private Gesundheitsinstitutionen und Experten bereits vor einer schweren HIV-Krise im Land. Von 1984 bis Oktober 2016 wurden insgesamt rund 38.000 HIV-Infektionen registriert, darunter allein zwischen 2011 und 2016 über 10.000 Fälle in der Altersgruppe der 15- bis 24-Jährigen. Vor allem unter jungen Männern ist der Anteil an Neuinfizierten auffallend hoch: Von den rund 22.800 HIV-Fällen im Zeitraum von 2010 bis 2015 machten Männer 95 % aus. Das soll die Gefahr im Kontakt zwischen heterosexuellen Sexualpartnern nicht verharmlosen, Vorsicht und Vorsorge sind auf jeden Fall dringend geboten.
Alkohol: Das Angebot ist groß und für fremde Besucher teilweise exotisch und verlockend. Die fröhliche Runde beim einheimischen Bier, der Sonnenuntergang über dem südchinesischen Meer oder der Visayas-See mit dem unvermeidbaren „Sundowner“ in der Hand, bei einer Fiesta mit lokalem Rum mal so richtig einen draufmachen, das sind Situationen, die Touristen und auf den Inseln lebende Ausländer ausgiebig erfahren können. Abgesehen von der weitverbreiteten Alkoholsucht im Land, die in allen Gesellschaftsschichten – bei Frauen, aber mehrheitlich unter Männern – zu finden ist, spielen hochprozentige Destillate aus Reis, Palmensaft und Zuckerrohr auch bei ethnischen Gruppen eine rituelle Rolle. Vorsicht ist ratsam, wenn es in einer trinkfreudigen Gruppe allzu laut zugeht und Aggressivität spürbar wird. Bei Einladungen zum Umtrunk mit Unbekannten sollte dem Fremden stets bewusst sein, dass in den Getränken nicht nur alkoholische, sondern vielleicht betäubende Zutaten enthalten sein können (siehe auch die Kapitel „Schlagzeilen aus dem ‚wilden Osten‘ – die Sicherheitslage“ ab Seite 332 und „Flüssige und rauchende Laster“ ab Seite 248).
Amulette, Schutzgeister: Ein Kruzifix oder ein Miniatur-Reisgott an der Halskette, beide Symbole sollen ihren Träger schützen, ihm Glück bringen, sei es beim Examen, beim Hahnenkampf oder in der Hoffnung auf eine gute Ernte. Amulette und Talismane wirken bei indigenen Gruppen authentisch und sind deswegen begehrte Mitbringsel, die – wer weiß – einem selbst sogar Schutz spenden werden. Fromme katholische Filipinos schwören auf Kreuz und Rosenkranz, philippinische Muslime schöpfen Kraft aus der kunstvoll gearbeiteten Darstellung des legendären Wundervogels Sarimanok. Die Igorot, Bontoc und andere Bergvölker von Nordluzon vertrauen Bulul, dem Schutzgott der Reispflanze – alles eine Frage von Glaube und Überzeugung. Gleichwohl boomt der Markt mit derlei „Ethno Art“, wie man beispielsweise rund um die weltberühmten Reisterrassen von Banaue und Bontoc, im Bergstädtchen Sagada, in Zamboanga an der Sulusee oder anhand der Kunst der Batak auf Palawan sehen kann. Solange diese „indigenen“ Souvenirs als lokale Produkte und nicht als Chinaimporte angeboten werden, haftet dem Geschäft mit dem Übersinnlichen wenigstens etwas von philippinischer Originalität an.
060kp-ags
Der Beistand des Jesuskinds stärkt das Selbstvertrauen des jungen Steuermanns
Anrede: „Sir“ und „Ma’am“ hören ausländische Besucher von freundlichen Filipinos sehr oft, nicht selten auch das philippinische, für beide Geschlechter zutreffende Pendant „pò“, das in jedem höflich formulierten Satz Anwendung findet. Das weltweit zunehmend lokale Grußformeln ersetzende „Hallo“ bzw. „Hello“ ist auf den Inseln auch in die Alltagssprache eingegangen und hat mancherorts das aus der amerikanischen Kolonialzeit stammende „Hey Joe“ (angewendet für weiße Mitmenschen beider Geschlechter) verdrängt. Wer diesen „Hello“-Trend nicht immer und überall mitmachen will, sollte sich ein kleines Repertoire an Filipino- und regionalen Grußformeln zulegen. Damit erntet er auf jeden Fall Sympathie und noch mehr Freundlichkeit. Gerade beim Kontakt mit Angehörigen der indigenen Gruppen, in denen man Englisch als Lingua franca der Nationalsprache häufig vorzieht, kommen die lokalen Grüße immer gut an. Als praktische Sprachführer empfehlen sich die Bände „Tagalog“ und/oder „Cebuano“ der Reihe „Kauderwelsch“ aus dem REISE KNOW-HOW Verlag (auch als Audioausgaben verfügbar).
Ansehen, Gesicht wahren: Darum dreht sich alles – in der zwischenmenschlichen Kommunikation, im eigenen sozialen Verhalten und in der Wahrnehmung des Verhaltens der anderen. Das Bestreben, das eigene Gesicht stets zu wahren, soll unbedingt dem Ansehen der Familie nützen (siehe auch die Kapitel „‚Hiya‘ – Selbstachtung, Schande, Scham – was denn nun?“ ab Seite 117 und „‚May mukha‘ – Gesicht haben, ehrenhalber“ ab Seite 119). Umso unangenehmer fällt es auf den Einzelnen zurück, wenn er durch sein Fehlverhalten der Reputation der Familie schadet. Für den Fremden empfiehlt es sich nachdrücklich, dieser Mentalität Rechnung zu tragen, auch wenn das äußerlich westlich und aufgeschlossen wirkende Verhalten vieler Filipinos dazu verleiten kann, ihre Reaktionen nach eigenen Normen und Wertemustern einzustufen.
Ansprechen: Vielen ausländischen Besuchern geht es zwar irgendwann auf die Nerven, doch das Ansprechen, die Fragen nach dem Namen, dem Familienstand, den Kindern, der Herkunft etc. ist für Filipinos in erster Linie ein Resultat guter Erziehung und ein Gebot der Höflichkeit. Damit soll dem Fremden gezeigt werden, dass er wahrgenommen und ihm notfalls geholfen wird. Zudem sollen die erhofften Antworten sicherlich auch die Neugier stillen. Damit haben viele Westler, die einen eher von Anonymität und Distanz gekennzeichneten sozialen Umgang mit Fremden gewohnt sind, oft Schwierigkeiten. Der gute Rat in solchen Situationen: Lassen Sie ein paar der Fragen über sich ergehen, antworten Sie mit Geduld und Höflichkeit und vergessen Sie das Lächeln nicht. Dann, vorausgesetzt, Sie haben Zeit und wollen sich „revanchieren“, drehen Sie die Situation um und fragen ebenso lächelnd und höflich den philippinischen „Interviewer“ nach seinen „Eckdaten“. Sie werden staunen, dass Sie in den meisten Fällen lehrreiche Informationen zum Alltagsleben erhalten (siehe auch die Abschnitte „Wohin, woher Fremder? Ich bin hier!“ und „Die höfliche Hand“ ab Seite 308). Zu den möglicherweise schlechten Absichten von allzu neugierigen Gesprächspartnern siehe das Kapitel „Schlagzeilen aus dem ‚wilden Osten‘ – die Sicherheitslage“ ab Seite 332.
Armut und Bettler: Wer sich nach Ankunft an einem internationalen Flug- bzw. in einem Seehafen gleich zu einem exklusiven Strandresort fliegen, mit Privatfahrer in ein Fünf-Sterne-Hotel chauffieren lässt oder einen der Kreuzfahrt angepassten Ausflug gebucht hat, wird von Bettlern und auch von durch Armut geprägten Stadtvierteln zunächst wenig, vielleicht sogar gar nichts wahrnehmen. Andere Besucher empfinden die auf den von Wolkenkratzern gesäumten Straßen schlafenden, im Müll nach Essen und verwertbaren Wohlstandsresten suchenden, in Kartonverschlägen oder auf Friedhöfen hausenden Menschen zweifellos als Kulturschock. Bettelnde Straßenkinder können unbestritten lästig werden, zumal sie sehr früh in Kontakt mit Kriminalität wie Taschendiebstahl, Betrügereien, Prostitution und Drogenabhängigkeit kommen. Die Bekämpfung der Armut findet sich in jedem Aktionsplan der sich abwechselnden Regierungen wieder, schließlich sind auch die Ärmsten der Armen wahlberechtigt und schenken in ihrer Existenzangst den Versprechen der Wohlhabenden immer wieder aufs Neue Glauben. Naturkatastrophen und Vertreibung aus aufgrund ihrer Bodenschätze interessant gewordenen Gebieten und allgemeine Landflucht mehren die Massen der Armen unaufhörlich (siehe auch die Kapitel „Die Schere klafft“ ab Seite 166 und „Einkommensverhältnisse und Sozialsysteme“ ab Seite 169). Vor jeder Kirche, insbesondere wenn Gottesdienste abgehalten werden, kauern Arme und Behinderte, oft ältere Leute, die die Hände nach Almosen ausstrecken. An Straßenkreuzungen vor Ampeln warten bettelnde Kinder und Erwachsene auf aus dem Fenster gereichte Münzen, zuweilen bieten Jungs an, die Windschutzscheibe gegen einen Obolus zu reinigen. Die Gelegenheiten, milde Gaben zu geben oder zu verweigern, sind vielfältig. Manch ein Reisender lehnt es ab, bettelnden Kindern etwas zukommen zu lassen, da sie, so vermutet man nicht immer unberechtigt, von den Eltern zum Betteln geschickt würden. Andere verteilen Lebensmittel an Straßenkinder. Es ist schwer und an dieser Stelle kaum gerechtfertigt, verlässliche Faustregeln im Umgang mit Armen und Bettlern zu verfassen. Wer sein Gewissen ab und zu beruhigen will, sollte sich beim Geben vor allem um die Alten, Gebrechlichen und Behinderten, die kaum zu einer „anständigen“ Arbeit in der Lage sind, kümmern. Wer objektiv unterscheiden kann, ob die Frau mit dem Kind auf dem Arm zu den „Profis“ gehört oder wirklich in großer Not ist, wird seinem gesunden Menschenverstand entsprechend handeln. Andere mögen sich in guter Absicht vor oder nach einer Reise in die Philippinen erkundigen, wo und welche Hilfsorganisationen sich um die Armen, auch um Kinder kümmern, und dort einen Beitrag leisten wollen.
Ausländer/Touristen (generelles Verhältnis, Ansehen): Dem seit vielen Jahrhunderten bestehenden, wenn auch nicht immer freiwilligen Kontakt mit Menschen aus anderen Teilen der Welt ist es geschuldet, dass Ausländer i. d. R. freundlich aufgenommen werden (siehe u. a. das Kapitel „Inseln der Hoffnung – Einwanderungs- und Fremdenproblematik“ ab Seite 185). Auch der hohe Anteil an im Ausland lebenden Filipinos begünstigt eine generell hohe Akzeptanz von Fremden im eigenen Land. In fast jeder Familie gibt es jemanden, der in anderen Staaten Geld verdient und hin und wieder Produkte oder Ideen mitbringt. Das bedeutet allerdings nicht, dass die Kenntnisse über dortige Lebensumstände immer der Realität entsprechen. Generell gelten Ausländer als reich, schon allein deswegen, weil sie sich die weite Reise und die für die Mehrheit der Filipinos im Land unerschwinglichen Aufenthalte leisten können. Das gilt genauso für sogenannte Backpacker-Touristen, die allzu gerne aufgrund ihres eher lässigen Habitus meinen, sich dem einfachen Lebensstil der Filipinos besser annähern zu können. Nachlässige Kleidung und geiziges Verhalten kommen allerdings bei den Bewohnern der Philippinen gar nicht gut an und leicht resultiert die verächtliche Reaktion auf einzelne Touristen in der Pauschalierung einer ganzen Nationalität. Ähnlich verallgemeinernd, idealisierend stuft man die in den reichen Industriestaaten hergestellten Waren, Kleider und Geräte ein, die seit Kolonialzeiten als schlichtweg besser gelten und allzu gerne als Statussymbole genutzt werden. Wer mit Ausländern in näheren Kontakt kommt, wie Angestellte in der Fremdenverkehrswirtschaft, Firmenkollegen etc., kann sicher zwischen den einzelnen Nationalitäten und deren typischen Eigenschaften unterscheiden. Gelegentlich spielen Ressentiments eine Rolle, die sich ähnlich wie bei uns Europäern aus Erfahrungen beispielsweise aus der kriegreichen Vergangenheit begründen, die aber auch nach Jahrzehnten immer noch Vorurteile nähren (siehe das Kapitel „Das Bild von Touristen und von Deutschen“ ab Seite 302). Touristen sind pauschal Menschen, die Geld ins Land und möglichst direkt zu ihren Gastgebern, Bootsleuten, Jeepneyfahrern etc. bringen und sich hier und da ein Fehlverhalten erlauben dürfen. Überheblichkeit, Arroganz, beleidigende, herrische Attitüden quittieren Filipinos verständlicherweise mit zunächst stillem, „heruntergeschlucktem“ Ärger, der sich eventuell bei wiederholter Erniedrigung auch aggressiv Luft machen kann.
Baden/Nacktbaden: Im katholischsten Land Asiens überrascht es nicht, dass es am Strand und beim Baden in Pool, See oder Fluss zuweilen recht konservativ, ja geradezu prüde zugeht. Zumindest kommt es uns Westlern so vor, wenn Frauen in T-Shirt und Shorts auf und ins erfrischende Nass eintauchen. Oder unter dem Schutz eines langen Handtuchs oder Sarongs bis an den Rand des Wassers gehen, um nur nicht zu viel ihres Körpers zu zeigen. Häufig erklärt man diese Gewohnheit auch mit der Scheu vor Sonnenlicht, das die Haut dunkeln lässt. Philippinische Männer sind da schon freizügiger in Badehose oder mangels dieser in Unterhose zu sehen. Ausländer, vor allem solche, die knappe Badekleidung gewohnt sind, finden die „zugeknöpfte“ Bademode philippinischer Frauen und heranwachsender Mädchen manchmal belustigend. Denen, die zu Hause oder in anderen Urlaubsländern der Freikörperkultur frönen, mag es schwerfallen, sich dem allgemeinen Nacktbadeverbot auf den philippinischen Inseln zu unterwerfen. Teilweise erscheint es höchst paradox, dass in einem Land, das immer noch als Mekka für Sextouristen gilt und wo in zahllosen Bars spärlich bekleidete Frauen an der Stange tanzen, diese eingeschränkte Badekleiderordnung herrscht. In der Regel hat niemand etwas gegen die Bikinis und knapp sitzenden Badehosen von Touristen einzuwenden, auch sich modern verhaltende Filipinos und Filipinas folgen in der Hinsicht häufig den westlichen Vorbildern. Und wenn eine Ausländerin beim Sonnenbaden am Strand den Oberkörper entblößt, wird auch nicht gleich die Sittenpolizei gerufen. Allerdings darf man sich nicht wundern, wenn sich bald kichernde Kinder und gaffende Männer in der Nähe aufhalten wollen. Die Betreiber mancher Beach Resorts genehmigen übrigens, sozusagen in Eigenverantwortung, an abgeschirmten Strandnischen das textilfreie Baden.
Begrüßung/Verabschiedung: Sich per Handschlag zu begrüßen ist üblich, aber nicht zwingend.
Männer sollten einer ihnen zunächst unbekannten Frau nicht sofort die Hand reichen. Wenn die Frau von sich aus die Handbegrüßung einleitet, ist es natürlich höflich, diese mit der eigenen rechten Hand zu erwidern. Manch ein Filipino will dem Westler imponieren, indem er beim Handschlag Druck ausübt. Doch landestypisch ist eher eine kurze, spürbare, aber nicht feste Berührung. Umarmungen zur Begrüßung und Verabschiedung sind auch unter guten Freunden und Verwandten in den Philippinen seltener als bei uns. So sollte der Fremde dieses gewohnte Ritual nicht unbedingt an den Mann oder die Frau bringen wollen. Küsschen links und rechts auf die Wangen werden nur sparsam verteilt, unter Männern allerdings gar nicht, zwischen Erwachsenen und kleinen Kindern schon eher. Für Kinder wird es manchmal zur ungeliebten Mutprobe (die eigene Kindheit lässt grüßen), wenn die älteren Verwandten sie auffordern, dem fremden Besucher ein Küsschen aufzudrücken und sich eins abzuholen. Da ist die gute alte Sitte, den rechten Handrücken des höher stehenden Erwachsenen – und diesen Rang kann ein ausländischer, einigermaßen vertrauter Besucher ebenfalls erlangen – an die eigene Stirn zu legen, vielen Kindern angenehmer. Generell lächeln die Menschen zur Begrüßung und zum Abschied. Tränen der Freude oder der Betrübtheit fließen, wie am Flughafen häufig zu sehen ist, auch schon mal in Strömen. Für weitere Details hierzu siehe auch das Kapitel „Begegnungen, Begrüßungen, Verabschiedung“ ab Seite 307.
Bekleidung: Schuluniformen, adrett, sogar richtig fein gekleidete Kirchgänger aller Altersstufen, sauber gekleidetes Personal … allerorten fällt auf, wie viel Wert Filipinos auf ein attraktives Äußeres legen. Selbst die Armen halten stets gewaschene und gebügelte Kleidung unter ihren wenigen Habseligkeiten bereit, falls sie mal für einen Behördengang, eine Geburtstags- oder Trauerfeier gebraucht wird. Andererseits wirkt es auf uns etwas befremdlich, wenn Männer gerne ihr Hemd oder Shirt bis zu den Brustwarzen hochkrempeln und ihren oft dicken, nackten Bauch zwecks Abkühlung zur Schau tragen. Komisch muten mitunter auch die eigentlich feschen Uniformen von Polizisten an, wenn sie sich über die von viel Bier und Schweinefleisch aufgeblähten Bäuche ihrer Träger spannen. Doch unangenehm bis peinlich ist manchmal auch die Kleidung von Touristen, die meinen, weil sie in einem warm temperierten Land unterwegs sind, im vermeintlich coolen Schlabberhosen-, Fransen- oder Hippielook mit Badelatschen oder womöglich ganz asketisch barfuß, in verschwitzen Hemden, ohne BH und in superknappen Shorts auftreten zu müssen. Geradezu unhygienisch wirkt es, wenn sich aufgekratzte Mückenstiche entzündet haben und diese den Mitmenschen im Jeepney oder im Restaurant an nackten Füßen, Beinen oder Armen präsentiert werden. Niemand wird sie deswegen kritisieren oder anfeinden, doch die befremdeten Gefühle der Filipinos lassen sich oft am stummen, eingefrorenen Lächeln ablesen. Begibt sich ein Westler allerdings in derart lässiger und provozierender Weise gekleidet auf einen Behördengang, z. B. zur Einwanderungsbehörde, um das Visum verlängern zu lassen, wird er die Ablehnung sehr bald spüren und manchmal auch eine Mahnung hören. Dass ein Restaurant nicht mit nacktem Oberkörper und sakrale Orte wie Kirchen, Gebetsstätten, Friedhöfe etc. in dezenter Kleidung besucht werden sollen, muss hier nicht explizit erwähnt werden. Oder doch? Manch ein Globetrotter hängt vielleicht heute noch dem naiven Trugschluss an, dass seine einfache Kleidung ihn den Menschen auf der Straße näherbringen und ihn vor Betrug schützen würde …
Beleidigungen: Beiträge von Philippinenkennern und Leuten, die sich dafür halten, geben in Internetforen Kenntnis davon, dass auch Reisende auf den Inseln hin und wieder von Beleidigungen und Beschimpfungen durch Einheimische berichten. Doch es dürften ganz sicher Ausnahmen sein, denn jemanden zu beleidigen, bedeutet gemäß guter philippinischer Erziehung einen gehörigen Gesichtsverlust und der schadet dem Beleidigenden oft mehr als dem Beleidigten. Andererseits liefert das derzeitige Staatsoberhaupt wiederholt den Gegenbeweis: Seine Schimpftiraden und rüpelhaften Kommentare, die weder den Papst noch ausländische Politiker aussparen, scheinen ihm sogar Sympathisanten im eigenen Land einzubringen. Doch sollte diese in der Tat kuriose Auslegung von Diplomatensprache nicht auf den Umgang im Alltag übertragen werden. Im Band „Tagalog/Filipino“ der Kauderwelsch-Reihe aus dem REISE KNOW-HOW Verlag zitieren die Autoren ein paar deftige Schimpfworte für den Fall der Fälle, den es aber zu vermeiden gilt! Denn eine, wenn auch unachtsam geäußerte Beleidigung z. B. in einer alkoholisierten Gruppe kann blitzschnell in blutige und im schlimmsten Fall sogar tödliche Streiterei ausarten.
Berührungen/Körperkontakt: Enger Körperkontakt mit völlig Fremden scheint Filipinos wenig auszumachen; das kann man täglich in vollbesetzten Bussen, Jeepneys und Tricycles beobachten. Dass mehrere Personen zusammen in einem Bett schlafen, ist ebenfalls normal und ausdrücklich erwünscht. Ältere Geschwister tragen kleinere Brüder und Schwestern oft stundenlang herum, von klein auf spüren Menschen die körperliche Nähe zu anderen. Dennoch sind physische Demonstrationen der Zuneigung in der Öffentlichkeit ausgesprochen selten und verpönt. Innige Umarmungen und Küsse erregen peinliche Aufmerksamkeit, derartige Körpersprache gehört ausschließlich an private Orte. Daher sollten ausländische Reisende es den Landesbewohnern gleichtun und sich mit Zärtlichkeitsbekundungen vor aller Augen zurückhalten, um sich nicht lächerlich zu machen. Das Anfassen des Gesprächspartners unterliegt nach philippinischer Etikette bestimmten Regeln, wonach der soziale Status vorgibt, wer z. B. wem auf die Schulter klopfen oder wen am Ellbogen berühren darf. Näheres dazu findet sich im Kapitel „Wer das Wort hat – Gesprächsverhalten“ ab Seite 327. Verwirrend mag es auf Fremde wirken, zwei Männer oder Jungen zu sehen, die Hand in Hand gehen. Obwohl sich Schwule in den Philippinen überhaupt nicht verstecken müssen (siehe das Kapitel „Toleranz für Schwule und Lesben – ja. Respekt – na ja…“ ab Seite 221), bringt dieses Händchenhalten jedoch i. d. R. lediglich eine enge (nicht sexuell motivierte) Freundschaft zum Ausdruck.
Bestattung/Tod: Särge, die am Straßenrand zur Schau gestellt werden, sind im philippinischen Alltag ein vertrautes Bild. Mindestens einen funeral parlor, ein Bestattungsunternehmen, hat jeder größere Ort, oft finden sich gleich mehrere in ein und derselben Straße. Wie bei uns sind die Angestellten dieser Institute mit dem Herrichten der Verstorbenen beschäftigt einschließlich der christlichen Sitte des Einbalsamierens. Denn es vergehen oft Tage, wenn nicht Wochen, bis die eigentliche Bestattung, in noch seltenen Fällen die Kremation stattfinden kann. Verwandte und Freunde von Nah und Fern, häufig aus dem Ausland, werden erwartet. Je nach sozialem Stand und Wohlstand wird eine große und teure Feier mit vielen Gästen vorbereitet. Der Vermögenslage entsprechen auch die Bestattungsfahrzeuge, die Musikbegleitung, die Todesanzeigen in den Medien etc. Zuweilen sieht der Reisende unterwegs eine kleine Prozession, die einen von Männern getragenen oder auf einem Handkarren gezogenen Sarg zum Friedhof geleitet. Woanders halten Polizisten den Verkehr zurück, damit ein Korso aus großen Edellimousinen und Kleinbussen die Bestattungskarosse (bevorzugt sind amerikanische Straßenkreuzeroldtimer aus vergangenen Jahrzehnten) zur vornehmen Gräber- und Mausoleenparkanlage begleiten kann, die Memorial Haven, Peace Garden oder ähnlich feierlich heißen kann. Wie unterschiedlich die mit Tod und Bestattung verbundenen Bräuche im Land sind, versucht das Kapitel „Der letzte Weg – Alter, Tod und Trauern“ ab Seite 235 aufzuzeigen.
009kp-ags
Das Kreuz über dem Dalton-Pass erinnert an den massenhaften Tod, den der Zweite Weltkrieg über die Inseln brachte
In Zeiten des allseits verfügbaren und einsatzbereiten Smartphones mit eingebauter Kamera wird aus den Reihen der Trauergesellschaft fleißig fotografiert. Ob nun der zufällig anwesende Tourist das für ihn zunächst exotische Geschehen, die Prozession, die Bestattung einfach so als Urlaubsfotomotiv „mitnehmen“ muss, soll jeder selbst entscheiden. Die Grenzen zwischen ernstem Interesse und pietätlosem, voyeuristischem Jagdfieber können bekanntlich fließend sein.
Bestechung/Schmiergelder: Korruption ist ein Dauerthema in Politik und Gesellschaft der Philippinen (siehe das Kapitel „Das geliebte Übel – die Korruption“ ab Seite 153). Im Land lebende Ausländer haben mit diesem „Krebsgeschwür“ sicher eher zu tun als Reisende – ob als Nutznießer oder Leidtragende. Mancher fühlt sich vielleicht versucht, im offiziell ausgebuchten Linienbus mittels eines zusätzlichen Geldscheins noch einen Platz zu bekommen oder dem Beamten der Einwanderungsbehörde einen Deal vorzuschlagen, damit die Urlaubsplanung wegen eines abgelaufenen Visums nicht durcheinanderkommt. Und schon wäre er am alle Lebensbereiche durchziehenden System der Bestechung beteiligt und würde sich laut Gesetz strafbar machen. Also Vorsicht – nicht jeder Bestechungsversuch bringt den erhofften Erfolg, denn hier und da verrichten die Verantwortlichen ihren Job aufrichtig. Man sollte besser davon ausgehen, dass Reisenden i. d. R. keine Schmiergeldforderungen gestellt werden, und es tunlichst vermeiden, jemanden dazu zu ermuntern.
Blickkontakt: Mit den Augen zu sprechen, ist auch in den Philippinen eine weitverbreitete Art der Kommunikation. Wie sie zu verstehen und anzuwenden ist, beschreibt das Kapitel „Mit Augenbrauen und offenem Mund – die Körpersprache“ ab Seite 291. Unterhält sich jemand mit unstetem Blick oder versucht gar, jeglichen Blickkontakt zu vermeiden, ist meist große Schüchternheit, Unsicherheit oder übertriebene Unterwürfigkeit der Grund. Starrt eine schwangere Frau Sie offen an, so hofft sie darauf, dass ihr Kind hübsch aussehen wird, sie macht Ihnen damit also ein indirektes Kompliment. Ansonsten halten Filipinos das ungenierte Anstarren anderer Menschen für unhöflich, ungebildet oder gar für aggressiv bzw. feindselig.
Bürokratie: Im Gegensatz zu den Landesbewohnern und eingewanderten Ausländern hat der „normale“ Tourist i. d. R. wenig bis gar nichts mit dem in der Tat weit in den Alltag reichenden Bürokratieapparat zu tun. Sollte dennoch ein Behördengang notwendig werden, sind neben möglichst vollständigen Unterlagen viel Geduld und ordentliche Kleidung (z. B. lange Hosen, feste Schuhe, die Schultern bedeckende Bluse) ausdrücklich ratsam. Eine höfliche, nicht fordernde Ausdrucksweise erleichtert die Prozedur außerdem und vielleicht kommt man mit etwas Small Talk dem zügigen Ende der Amtshandlung näher – jedenfalls eher als mit mürrischem Gesichtsausdruck und dauerndem Blick auf die Uhr.
Drängeln: Das „Problem“ ist in den Philippinen sicher nicht so groß wie in anderen asiatischen Ländern, doch hin und wieder vergessen auch Filipinos ihre anerzogene Höflichkeit und drängen sich vor, in der Schlange beim Eincheckschalter am Flughafen oder bei der Abfertigung zur Inselfähre, in einem Selbstbedienungsrestaurant, beim Einsteigen in einen schon ziemlich gut besetzten Jeepney etc. Wenn es bei einem oder zwei „Ausreißern“ bleibt, sollte man das gelassen hinnehmen. Wird man jedoch regelrecht weggedrängt, kann man ruhig die gleiche Taktik einschlagen und sich nach vorne manövrieren, notfalls unter Einsatz von Händen, Ellbogen und vernehmlichem „Sorry pò, excuse me pò!“.
Drogen: Das „heiße“ Thema, das seit Amtsantritt von Präsident Duterte die Berichterstattung im In- und Ausland beherrscht, ist seit vielen Jahren ein großes Problem (siehe auch die Kapitel „Aufgeputscht“ ab Seite 189 und „Schlagzeilen aus dem ‚wilden Osten‘ – die Sicherheitslage“ ab Seite 332). In den ganz und gar nicht einladenden Gefängnissen einiger Städte sitzen auch Ausländer ein, die wegen Drogenhandels (ob durch eigene Initiative oder falsche Beschuldigungen) bzw. unerlaubten Besitzes von Rauschmitteln angeklagt wurden. Noch ist kein Fall bekannt, bei dem Ausländer von Polizei- oder Killerkommandos getötet wurden, doch Vorsicht ist absolut geboten. In aller Deutlichkeit: Wie auch immer man zu den brutalen Maßnahmen der Behörden stehen mag, den von der Regierung ausgegebenen Schlachtruf „Null Toleranz“ sollte jeder, der – animiert von tropischen Vollmondnächten am Strand oder verlockender Gesellschaft – mit dem Gedanken an einen Joint oder andersartigen Drogenrausch spielt, direkt auf sich beziehen. Auch das eigene Gepäck betreffend, gilt das Vorsichtsgebot, denn ein Päckchen mit verdächtiger Substanz ist schnell zugesteckt und wer sich dann darauf verlässt, einer Verhaftung durch ein saftiges „Lösegeld“ entgehen zu können, wählt eine äußerst riskante Option.
006kp-ags
Das Angebot eines Public Market reicht von Gemüse und Fisch bis zu Brühwürfeln
Einkaufen, Märkte, Handeln: Das Angebot in den Geschäften, auf den Märkten und natürlich in den Shoppingmalls, von denen inzwischen fast jede Kleinstadt eine hat, ist üppig bis schier unglaublich vielfältig. Das mag den Reisenden, der bereits viel an Armut und Bedürftigkeit im Land gesehen hat, überraschen und auch irritieren. Die Auswahl an Kunsthandwerk und anderen mehr oder weniger geschmackvollen Souvenirs beeindruckt. In touristischen Zentren, an Busbahnhöfen und – haltestellen, an beliebten Strand- und Ausflugsorten haben oft angereiste Verkäufer ihre Stände aufgebaut oder ziehen mit ihren Artikeln beladen umher. Bei diesen Anbietern ist Handeln meist angebracht und vielfach wird der Kunde dazu aufgefordert. Dabei sollte man nicht zu zaghaft vorgehen, aber auch den Wunschpreis nicht zu tief ansetzen, damit der/die Verkäufer/in sich noch ernst genommen fühlt. Eine grobe Faustregel hat sich bewährt: Wenn man an dem Gegenstand wirklich interessiert ist und einen besseren als den genannten Preis erzielen will, kann ein Betrag, der in etwa bei der Hälfte des Erstpreises liegt, eine vernünftige Ausgangsbasis für ein erfolgreiches, Gesicht wahrendes Ergebnis sein. Genaues Prüfen der Ware ist ebenso anzuraten wie ein ausreichender Vorrat an Kleingeld. Wer zusammen mit Filipinos auf einem der örtlichen Märkte einkaufen gehen will, wird möglicherweise gebeten, Abstand zu halten, denn die Präsenz eines Ausländers löst bei Händlern zuweilen den „Reflex“ einer plötzlichen Preissteigerung aus. Manch einen Besucher ärgert das verständlicherweise, auch wenn es nur ein paar Pesos Unterschied macht. (Es sei angemerkt, dass wenige Filipinos, Ehepartner von Ausländern eingeschlossen, sich in aller Öffentlichkeit auf eine Grundsatzdiskussion über gleiche Rechte und Preise einlassen wollen.)
Einladungen: Filipinos haben gerne Gesellschaft, auch von Ausländern. Diese werden es zwar kaum erleben, dass sie von der Straße weg ins Haus eingeladen werden und sollten bei solch einem eher ungewöhnlichen Angebot vorsichtig sein (siehe das Kapitel „Schlagzeilen aus dem ‚wilden Osten‘ – Sicherheitslage“ ab Seite 332). Doch wenn man sich näher bekannt gemacht hat oder durch einen Dritten vorgestellt wurde, kann man die Einladung getrost annehmen. Zu den entsprechenden Vorbereitungen und Verhaltensregeln geben die Kapitel „‚Haben Sie schon gegessen?‘ – Gastfreundschaft“ ab Seite 310 und „Zu Gast in der Familie“ ab Seite 315 hilfreiche Auskunft. Weder sind Geschenke obligatorisch noch wird eine strenge Kleiderordnung gefordert. Doch das eine oder andere pasalubong, vorzugsweise ein Mitbringsel von der Reise oder von zu Hause, Süßigkeiten, Gebäck für die Kinder oder Obst und saubere, dezente Kleidung kommen immer gut an (siehe auch den Verhaltenstipp „Geschenke“, S. 29). Ist der Anlass der Einladung eine große Feier (Hochzeit, Trauerzeremonie etc.) gilt selbstverständlich eine anspruchsvollere Etikette.
Ess- und Trinksitten: Allgemein sind Filipinos begeisterte Esser, in Restaurants genauso wie an den Essständen der Markthallen, an ambulanten Garküchen und an Bushaltestellen. Dabei geht es i. d. R. recht ungezwungen und im Gegensatz zu anderen Ländern nicht besonders geräuschvoll zu. Schmatzen, Schlürfen und Rülpsen gehören nicht zum „guten Ton“. Die rechte Hand ist häufig im Einsatz, nach philippinischer Philosophie schmeckt es besser, wenn das Essen, vor allem der etwas klumpig gekochte Reis, direkt von der Hand in den Mund kommt (siehe auch das Kapitel „Reisen geht durch den Magen – Ess- und Trinkkultur“ ab Seite 317). Manch ein Landesbewohner betet vor dem Essen oder/und danach. Die Formel „Guten Appetit“ ist dagegen weitgehend unbekannt. Dass der Gast seine heimischen Sitten besser nicht an einen philippinischen Tisch überträgt und z. B. beginnt, das Geschirr zusammenzustellen oder abzutragen, ist im Kapitel „Zu Gast in der Familie“ ab S. 315 nachzulesen.
Fahrer/Guides: Wer sich für eine Rundreise oder örtliche Ausflüge selbst auf die Suche nach einem Reiseführer und/oder Fahrer macht, sollte Vorsicht walten lassen. Am besten ist es, derartige Dienstleistungen über eine Agentur, die örtliche Fremdenverkehrsbehörde (Department of Tourism, DOT) oder durch Vermittlung eines vertrauenswürdigen Bekannten zu akquirieren. Zu viele schwarze Schafe sind in dem Gewerbe unterwegs, die sich unter Umständen vorher alles bezahlen lassen, ohne die erwartete Arbeit dann zuverlässig zu erfüllen oder die mehr Zeit mit der Reparatur als mit dem Steuern des Fahrzeugs verbringen, wenn dieses nicht gar ganz den Geist aufgibt. Auch ein sogenannter badge, ein registrierten Fahrern und Guides offiziell ausgestellter Identifikationsausweis (ID) lässt sich fälschen. Ist jedoch alles in Ordnung, können informative, geschulte und hilfsbereite Chauffeure und Guides eine wahre Bereicherung des Reiseerlebnisses sein. Man sollte sich nicht wundern, wenn Führer und/oder Fahrer trotz einer Einladung durch die Kunden manchmal lieber separat essen wollen. Meistens ist es höfliche Zurückhaltung, manchmal die Furcht, an der Unterhaltung am Tisch nicht in vollem Umfang teilnehmen zu können, zuweilen allein die praktische Überlegung, dass das Servieren des Essens für eine größere Gruppe länger dauert, als wenn nur ein, zwei Personen bedient werden müssen. Wenn sich ein Fahrer also nach mehreren Stunden am Steuer auf ein verdientes, schnelles, i. d. R. günstiges oder gar kostenloses Essen freut, sollte der Reisende für diesen Wunsch Verständnis aufbringen. Gelegenheiten, dem Guide und/oder Fahrer Anerkennung zu zeigen, gibt es immer mal wieder: ein erfrischendes Getränk hier oder eine gemeinsame Obstpause da und schließlich die sehr deutlich praktizierte Sitte des Trinkgelds (s. S. 40).
007kp-ags
Gläubige ziehen bei der Fiesta die prunkvoll geschmückte Marienstatue aus der Kathedrale von Bolinao
Feiern/Fiesta: Egal zu welcher Jahreszeit die Philippinen das Reiseziel sind, irgendwo wird immer eine der typischen Dorffiestas gefeiert, denn die Gedenktage für die Schutzheiligen liegen über das ganze Jahr verteilt. Eine erhöhte Frequenz von Festen ist zwischen Weihnachten und dem Monat Mai mit dem katholischen Höhepunkt der Semana Santa, der Karwoche, zu verzeichnen (siehe das Kapitel „Feste, Bräuche, Traditionen“ ab s. S. 112). Fröhlich, ausgelassen und richtig laut geht es dabei zu, von den Karfreitagsriten mal abgesehen. Aber auch wenn Passionsspiele, Trauer, Tod, wie an Allerheiligen und Allerseelen, im Vordergrund stehen, muss das mithilfe von Lautsprechern und Kirchenglocken, eventuell Großbildschirmen für Public Viewing zu hören sein. Filipinos feiern mit der Absicht, Aufmerksamkeit auch außerhalb der eigenen Familie oder Gruppe zu erregen. Fiestas sind Gelegenheiten, sich im Gedränge auf den Straßen und Plätzen näherzukommen. Nicht immer steckt allein die freundliche Neugierde dahinter, Taschendiebe feiern besonders gerne mit. Je weniger an Wertsachen der Festbesucher bei sich trägt, desto frustrierter sind die Langfinger. Gerne posieren Filipinos für Fotos und wenn sie sich dazu mit einem Ausländer gruppieren, ist der Spaß besonders groß.
Fotografieren:„Hey Joe, give me a Kodak, give me a shot!“ Die Zeiten, dass der weiße Fremde derart unverblümt aufgefordert wurde, die Kamera zu zücken und ein Foto zu schießen („Kodak“ war lange der Pauschalbegriff für „Foto“/„Fotografieren“), sind vorbei, außer in einigen sehr abgelegenen Gebieten, in denen Handy, Smartphone und die einschlägige digitale Technik noch keinen Einzug gehalten haben. Heute fotografieren Filipinos mindestens genauso ungehemmt und wahllos drauflos wie die Touristen. Nach wie vor sind sie ganz und gar nicht fotoscheu und nicht selten rufen sie noch andere aus ihrer Gruppe, Schulklasse oder Familie herbei. Schnappschüsse von Menschen in einem unbeobachteten, möglicherweise peinlichen Moment (beim Essen, bei der Körperwäsche etc.) sind jedoch tabu. Wer erst einmal Vertrauen zu seinen „Statisten“ aufgebaut hat, wird sicher auch Bilder komponieren können, die nicht allzu gestellt wirken. Auf Märkten gilt es ebenfalls, sensibel mit der Kamera umzugehen, nicht alle Verkäufer geben ihre Erlaubnis, sie und/oder ihre Waren abzulichten. Tabu sind auf jeden Fall auch Schnappschüsse von Uniformierten, es sei denn, dass diese selbst um ein Foto bitten. Militärische Anlagen und Fahrzeuge dürfen offiziell nicht aufs Foto, auch auf Flughäfen kann ein Fotografierverbot herrschen. Selbst in einigen Geschäften, insbesondere in Schmuckläden bspw. in den chinesischen Vierteln der Städte, dürfen keine Fotos gemacht werden. Potenzielle Räuber könnten diese ja in Auftrag gegeben haben …
Geduld:Dahan-dahan ist nur ein Ausdruck für „langsam“, „immer mit der Ruhe“, den vor allem der Ausländer beherzigen sollte, der meist an eine von der Uhr bestimmte Lebensweise gewöhnt ist. Auch wenn moderne, vor allem digitale Technik den Rhythmus in den philippinischen Städten zunehmend beschleunigt, trifft man doch sehr häufig auf Situationen, in denen Geduld enorm wichtig ist. Der Hinweis auf das eigene Heimatland, in dem alles viel schneller geregelt werde, bringt einen nur selten weiter und beschert dem Ungeduldigen i. d. R. sture Reaktionen und Gesichtsverlust (siehe auch die Kapitel „‚Come back tomorrow‘ – die Tücken der Bürokratie“ ab Seite 135 und „Umgang mit Behörden und Polizei“ ab Seite 330).
Gesprächsthemen, bevorzugte und problematische: Wie bei oberflächlichen, kurzen Begrüßungen und beim Smalltalk auf der Straße kommen Fragen und Neuigkeiten zur Familie auch während längerer Unterhaltungen immer positiv an. Fragen und Auskünfte zur globalen politischen Lage können unter Umständen mehr und intensiveren Gesprächsstoff liefern als die Innenpolitik der Philippinen. Oft trifft der nicht amerikanische Ausländer auf offenes, interessiertes Staunen, wenn er über genauere Situationen, das Klima, die Bildungspolitik, das Gesundheitswesen, die Arbeitslosigkeit etc. in seinem Heimatland berichtet. Denn vielen, besonders unter den ärmeren, weniger gebildeten Bevölkerungsschichten ist nur oberflächlich bis gar nicht bewusst, dass es außer den USA noch andere, sogenannte reiche, industrialisierte Länder gibt. Mancher Besucher fühlt sich irritiert durch die mit Präsident Duterte in Gang gesetzte brutale Verfolgung von Drogenhändlern und – konsumenten. Doch diese Problematik sollte man mit Vorsicht und nicht mit dem „erhobenen Zeigefinger“ angehen. Man sollte lieber warten, bis der philippinische Gesprächspartner das Thema von sich aus anspricht. Ähnlich zurückhaltend sollten Fremde mit Kritik an ihnen möglicherweise unverständlich anmutenden Bräuchen sozialer und religiöser Art, Aberglauben oder Essgewohnheiten sein. Nicht zu vergessen: Auch wenn Filipinos im Gespräch über ihnen peinliche und unangenehme Dinge lachen, empfinden sie die Meinung des anderen nicht immer als lustig oder angebracht. Selbstverständlich stehen diese hier geäußerten Empfehlungen zur verbalen Zurückhaltung und zur diplomatischen Unverbindlichkeit im Zusammenhang mit einer geringen oder erst wachsenden Vertrautheit. Ist das Verhältnis enger, findet sich auch ein „direkterer Draht“, über den offener kommuniziert werden kann.
Geschenke: Filipinos sind sehr empfänglich für Mitbringsel (pasalubong) von einer Reise. Der Besucher kann es natürlich in der Hinsicht nicht mit den Auslandsfilipinos aufnehmen, die oft weder Übergepäcknoch Zollgebühren scheuen, um den Lieben in der Heimat Geschenke mitzubringen. Doch Kleinigkeiten, die man unterwegs an Leute verschenken kann, mit denen man ein gewisses Freundschaftsverhältnis (z. B. anlässlich einer Einladung, einer netten, hilfreichen Geste, als Reaktion auf erfahrene Gastfreundschaft) ausdrückt, sind überall zu kaufen. Bei Kindern denken viele Reisende gleich an Bonbons, Süßigkeiten und Luftballons. Doch es gibt auch, ohne missionarisch-eifernd klingen zu wollen, sinnvollere, nachhaltigere Artikel wie Schulmaterialien, Spielzeug, Obst. Bei Besuchen von indigenen Gruppen wie beispielsweise den Batak auf Palawan oder den Mangyan auf Mindoro regen die Führer meistens dazu an, bestimmte Lebensmittel wie Reis, Salz oder Kerzen und Batterien einzukaufen, die die Besuchten dann unter sich aufteilen. Wer zu einem Geburtstag oder einer anderen Familienfeier eingeladen ist, wird sich vernünftigerweise vorher bei Bekannten oder Angehörigen der Gastgeber erkundigen, was als Geschenk angebracht sein kann. Meistens zählt die Geste und teure Errungenschaften werden nicht erwartet. Blumen als Geschenk mitzubringen, das wird eigentlich als fauxpas angesehen, denn sie sind als Schmuck, aber vor allem für traurige Anlässe vorbehalten. Doch auch hierin scheinen die Regeln aufzulockern und sich dem westlich-europäischen Einfluss anzunähern.
Gesten und Mimik: Dass man mit der Handfläche bzw. den Fingern nach unten winkt, die hochgezogenen Augenbrauen unterschiedliche Signale aussenden, vor der Brust verschränkte oder in die Hüften gestemmte Arme abweisend wirken und vieles mehr an für uns ungewohnter oder in ihrer Semantik kaum noch wahrgenommener körperlicher Kommunikation, steht u. a. in den Kapiteln „Mit Augenbrauen und offenem Mund – die Körpersprache“ ab Seite 291, „Die höfliche Hand“ ab Seite 308 und „Lächle dich durchs Leben“ ab Seite 124.
Die rechte Hand oder beide Hände zusammen bei vorgebeugtem Oberkörper vor sich Richtung Boden gehalten, – so zeigen Filipinos ihren Respekt, wenn sie an für sie sozial höherstehenden Personen und Älteren vorbeigehen wollen bzw. müssen. Z. B. Sie sitzen als Gast im Wohnzimmer einer Familie und die Angestellte geht an Ihnen vorbei. Auch wenn unsereinem derartig unterwürfig anmutendes, hierarchisches Verhalten fremd ist, sollten wir es respektieren und anwenden, z. B. wenn wir in einem Raum an älteren Filipinos vorbeigehen. Doch sollten wir diese Geste nicht veralbern und durch Übertreibung ins Lächerliche ziehen, indem wir sie selbst unangebracht anwenden, beispielsweise unter uns westlichen Besuchern. Auch wenn wir Jüngere und Kinder passieren, sind eine gebeugte Haltung und die vorgehaltene Hand fehl am Platz. Im Zweifelsfall verhält man sich besser so, wie man es gewohnt ist. Filipinos sehen meist tolerant über gelegentliche Unaufmerksamkeiten hinweg.
Hand – die unreine und die reine: In vielen Ländern oder Kulturkreisen kommt die linke Hand bei der Intimtoilette zum Einsatz, sei es mit Papier oder wie auch für die meisten Filipinos mit Wasser. Sie gilt daher als die „unreine“ Hand und sollte möglichst nicht zum Geben und Annehmen benutzt werden und schon gar nicht beim Essen in direkten Kontakt mit dem eigenen oder wie beim Füttern von Kindern mit dem Mund eines anderen kommen. Das sind die Aufgaben der rechten, „reinen“ Hand. Diese sinnvolle und strenge Regel lernen Kinder schon sehr früh. Doch Ausnahmen sind täglich zu beobachten: Hier traktiert ein Mann mit links per Zahnstocher seine Zähne, dort holt sich ein Mädchen mit der unreinen Hand den Kaugummi aus dem Mund, um ihrem kleinen Bruder die Hälfte davon abzugeben. Da muss man es sich fairerweise selbst nicht strengstens verbieten, den verschmutzten Pesoschein mit der Linken zu übergeben bzw. anzunehmen.
Hierarchien/Höhergestellte: In der Arbeitswelt, im Haushalt mit Angestellten, im Erziehungswesen und vor allem auch in der Familienstruktur sind deutliche Hierarchien lebendig. Wie in den Kapiteln „Zu Gast in der Familie“ ab Seite 315 und „Geborgenheit und Anspruch der Familie“ ab Seite 206 sowie im Kapitel „Wer das Wort hat – Gesprächsverhalten“ ab Seite 327 aufgeführt, sind Funktion von Hierarchien und ihr Einfluss auf das Verhalten des Einzelnen deutlich spürbar. Wenn der Besucher sich dessen bewusst ist, wird es ihm leichter fallen, sich z. B. als Gast in der ihm zugeteilten Rolle anzufreunden, sich bedienen zu lassen, auch wenn ihm das eigentlich gemäß der eigenen Erziehung nicht vertraut, ja unangenehm ist. Andererseits muss auch der ausländische Besucher sich selbstverständlich höherstehenden Personen gegenüber, sei es bei Behörden oder auch in befreundeten Familien, respektvoll verhalten.
Homosexualität:Bakla, womit inzwischen Homosexuelle wie auch Transgender und Transsexuelle gemeint sind, leben ihre „Andersartigkeit“ in der Gesellschaft ziemlich offen aus. Oft sind ausländische Besucher regelrecht überrascht, wie unverhohlen sich die bakla durch Gestik und Kleidung in der Öffentlichkeit „outen“. Trotzdem sind sie oft Sticheleien und diskriminierenden Bemerkungen ausgesetzt. Lesben (abwertend tomboy genannt) haben es im Vergleich zu männlichen Homosexuellen wesentlich schwerer, in der weitgehend von Machismo und katholischer Moral durchdrungenen Gesellschaft akzeptiert zu werden. Das Thema wird insgesamt im Kapitel „Toleranz für Schwule und Lesben – ja. Respekt – na ja…“ ab Seite 221 näher beleuchtet. Ausländische Homosexuelle werden sicherlich als solche wahrgenommen und müssen sich nicht „verstecken“. Mit dem Austausch von Zärtlichkeiten in der Öffentlichkeit sollten sie sich allerdings genau wie heterosexuelle Paare zurückhalten.
Hygiene: Ein Thema, bei dem man zwischen öffentlicher und persönlicher Sauberkeit unterscheiden muss. Stinkende Müllhaufen, streng riechende öffentliche Toiletten oder als Aborte benutzte Mauern und dunkle Straßenecken, aus dem fahrenden Bus geworfene Windeln, schmierige Tischplatten in Restaurants – das ist eine Seite des Hygieneverhaltens, das durch wiederholte öffentliche und private Kampagnen aufgebessert werden soll. Die mehrmals täglich stattfindende Körperwäsche, peinlich saubere, möglichst nie nach Körperschweiß riechende und gebügelte Kleidung, mit trocknender Wäsche behängte Zäune und Hecken – das ist jedoch die andere Seite, mit der Filipinos ausländischen Reisenden zuweilen etwas vormachen können (siehe auch das Kapitel „Gesundheit und Hygiene“ ab Seite 251).
008kp-ags
Die Philippinen – ohne fröhliche Kinder unvorstellbar
Kinder: Neben der Hundesteuer sind das Kinder- und Elterngeld – uns allzu vertraute Einrichtungen – etwas, über das Filipinos gerne herzhaft lachen, wenn sie davon erfahren. Geld, damit man Kinder haben will und großziehen kann? Das hätten die meisten im Land auch gerne, doch sie sehnen sich auch ohne finanzielle Anreize nach Nachwuchs, der einfach zum Leben gehört wie die Luft zum Atmen. Auch wenn vielen Filipinos die Belastung durch Gesundheitsfürsorge, Schulgeld, Ausgaben für Kleidung etc. anzumerken ist, auch wenn vor allem bei der gebildeteren und besser verdienenden Schicht das Familienmodell mit zwei bis drei Kindern gängiger geworden ist, bedeuten Kinder hauptsächlich Glück, Freude und Erfüllung. Kinderlosigkeit gilt weitgehend als Strafe oder Fluch. Mehr Hintergrund, auch zur Rolle der Kirche in Fragen der Geburtenkontrolle und zu Kindern als Opfer von Ausbeutung und Armut, ist im Kapitel „Kinder in der Gesellschaft“ ab Seite 216 ausführlich beschrieben.
Kriminalität: Unter dem Einfluss der mit Amtsantritt von Präsident Duterte begonnenen Verfolgung von Drogenkriminellen beherrscht das Thema „Kriminalität“ die Berichterstattung über und aus den Philippinen. Zweifellos passieren alltäglich Gewaltverbrechen, werden Leute bestohlen. Entführungen sind sarkastisch ausgedrückt Tradition, die mit ausländischen Opfern machen auch außerhalb des Landes Schlagzeilen. Von Umweltkriminalität wird kaum berichtet, obwohl sie allerorten vorkommt. Ein gesundes Maß an Vorsicht und Menschenkenntnis sollte jeder Reisende walten lassen und auch die Ratschläge und Sicherheitswarnungen vertrauenswürdiger Menschen wie Behörden ernst nehmen. Einige Empfehlungen und Erfahrungen sind im Kapitel „Schlagzeilen aus dem ‚wilden Osten‘ – die Sicherheitslage“ ab Seite 332 nachzulesen.
Lärm: Autohupen, knatternde Reismühlen, krähende Hähne (auch nachts), mit kraftvollen Lautsprechern übertragene Litaneien und AveMarias aus katholischen Kirchen – die Beschallung auf den Inseln – in Städten wie auf dem Land – kann vielfältiger und ohrenbetäubender nicht sein. Filipinos lieben es geräuschvoll, wollen gehört, wahrgenommen werden. Wer mal so richtig zur Ruhe kommen will, muss schon ziemlich weit weg in die Einsamkeit der Bergwelt, in die geheimnisvolle Stille eines Museums oder auf eine einsame Insel (von denen es im Archipel ja glücklicherweise genug gibt) ausweichen. Doch auch dort kann es passieren, dass ein laut knatterndes Motorboot um die Ecke biegt und eine ganze Großfamilie oder eine barkada den Strand belegt – natürlich mit der fast unverzichtbaren Musikanlage, die dank Auto-batterie oder Generator so richtig zur Entfaltung kommen kann. Die Philippinen, so lautet die mit Augenzwinkern formulierte Bilanz, sind kein Land für Leute, die auf Lärm allergisch reagieren.
Müll: Lange Zeit war der sog. „Smokey Mountain“, eine riesige, ununterbrochen schwelende Müllhalde bei Manilas Elendsstadtteil Tondo, ein unrühmliches Wahrzeichen der Hauptstadt. Noch immer offenbaren die von Müll überquellenden Kipplaster, die in vielen Orten die Abfallbeseitigung erledigen, das nach unseren Maßstäben völlig unterentwickelte Müllentsorgungssystem auf den Inseln (siehe auch das Kapitel „Natur- und Umweltschutzdenken“ ab Seite 267). Viel Verantwortung bzw. deren Vernachlässigung liegt in den Händen der Gemeinden: Hier besticht erfrischende Sauberkeit der Strandpromenade, im nächsten Ort begrüßen den Besucher qualmende Müllhaufen links und rechts des Highways. Da inzwischen der nachlässig-verantwortungslose Gebrauch von Plastiktüten eingeschränkt worden ist, können Reisende sich getrost von zu Hause ein paar Stofftragetaschen mitbringen, sie gebrauchen und eventuell bei Ende der Reise verschenken. Auch das Recyceln von Kunststoffflaschen ist in den Philippinen keine Utopie mehr, dennoch zeigen manche Strände, dass viel zu viel Müll weiterhin dem Meer anvertraut wird. Ähnlich problematisch und vergiftend landen Batterien, von Knopfzellen bis LKW-Akkus, in der Natur. Jeder, auch der nur ein paar Wochen im Land verweilende Ausländer, kann sich an der Umweltsituation verdient machen, indem er z. B. sich nach Entsorgungsmöglichkeiten für Giftmüll erkundigt und beim Einkauf auf unnötige Verpackung verzichtet.
Ramadan: Den Fastenmonat begehen die im Land lebenden Muslime, philippinische wie ausländische, in aller Konsequenz und Frömmigkeit. Da die Gläubigen inzwischen in immer mehr Städten im Archipel, also keineswegs nur in den traditionell vom Islam geprägten Regionen von Mindanao und der Sulusee leben, wirken sich die Riten und Regeln des Ramadan auch eingeschränkt auf das Alltagsbild in von Christen dominierten Landesteilen aus. Zu der Zeit finden mehr Gebetsaktivitäten in den Moscheen statt, das Ende des Fastenmonats krönt der Festtag Idul Fitri. Die Medien widmen dieser islamischen Tradition i. d. R. eine beachtliche Berichterstattung. Wer, soweit es die Sicherheitslage zulässt, in muslimischen Regionen unterwegs ist, wird gut beraten sein, sich über respektvolles Verhalten zu erkundigen.
Rauchen: Seit langer Zeit rauchen sowohl Mann als auch Frau in den Philippinen traditionell gefertigte Pfeifen, edle und rustikale Zigarren und Tabakstängel sowie die Industriezigaretten nach ausländischem Vorbild. Menthol scheint den meisten Rauchern der bevorzugte Zusatzstoff zu sein. Während Frauen einiger ethnischer Kulturgruppen ungeniert Pfeife oder Zigarre qualmen, ist Rauchen für gut erzogene Filipinas der modernen Gesellschaft kein gutes Benehmen, schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Doch emanzipierte Frauen haben sich auch in der Hinsicht mehr Freiräume geschaffen. Nun ist seit einigen Jahren der blaue Rauch wie in den meisten Ländern geächtet, die Steuern wurden – für lokale Verhältnisse – drastisch erhöht, das Rauchen auf Plätzen, in Restaurants und öffentlichen Gebäuden sehr eingeschränkt bzw. verboten. Der vom Nikotin abhängige Reisende muss in zahlreichen Unterkünften nach Raucherzimmern fragen und sich ansonsten an die geltenden Regeln halten (siehe auch das Kapitel „Tabak, Betelnuss und Schnaps“ ab Seite 250).
Religion: In Asiens Hochburg des Christentums, des Katholizismus im Besonderen, sind dessen Symbole und Monumente unübersehbar. Spanische Namen und fromme bis frömmelnd-fanatische Bräuche muten oft mittelalterlich an. Geburtenkontrolle, Empfängnisverhütung und seitens der katholischen Kirche noch immer verbotene Ehescheidung sind Dauerthemen in der sozialpolitischen Auseinandersetzung. Dazu kommen von beiden Seiten provozierte Querelen zwischen Christen und Muslimen, die wie woanders in der Welt gerne mit religiösem Machtanspruch erklärt und gepflegt werden. Im Gespräch mit Filipinos ist es ratsam, das Thema Religion mit gebührender Distanz zu behandeln und auf abfällige, zynische Bemerkungen zu verzichten. In persönlicherem Umgang kann jedoch auch von philippinischer Seite das eine oder andere kritische Wort zur allmächtigen Kirche (siehe das Kapitel „Religion und Kirche“ ab Seite 101) oder zum christlich-islamischen Konflikt der andauernden Mindanao-Krise (siehe die Kapitel „Inseln unter dem Halbmond“ ab Seite 47 und „Die Mindanao-Misere“ ab Seite 192) fallen. Andersgläubige treffen i. d. R. auf Toleranz, wohingegen erklärte Atheisten eher Unverständnis oder Befremden, aber keine unverhohlene Ablehnung oder gar Feindschaft erfahren.
Respekt: Zebrastreifen, auf denen die Fußgänger nur sicher sind, wenn eine rote Ampel oder ein Polizist die Fahrzeuge zurückhält; sich in öffentliche Verkehrsmittel oder an Marktständen drängelnde Menschen oder auf der Straße liegende Menschen, an denen andere achtlos vorbeilaufen, wenn nicht gar über sie steigen. Bei diesen Bildern stellt sich zu Recht die Frage: „Wo bleibt der zwischenmenschliche Respekt?“ Andererseits wird der Ausländer, der erst ein paar Tage im Land ist, beispielsweise die Achtung vor älteren Menschen leicht feststellen können. Sicherlich gibt es Situationen, in denen man sich wie zu Hause bei Schulschluss von entgegenkommenden, schwadronierenden, mit sich selbst zu sehr beschäftigten Jugendlichen überrannt zu fühlen scheint. Doch mindestens genauso oft ist zu beobachten, dass Kinder im Jeepney oder im Bus von sich aus aufstehen, um für einen älteren Passagier – ob Filipino oder Ausländer – den Platz frei zu machen. Nicht wenige in die Philippinen ausgewanderte pensionierte Westler nennen den größeren Respekt vor dem Alter als einen der Gründe für den Ortswechsel. Altersheime sind weitgehend unbekannt, Alte bleiben so lange wie möglich, i. d. R. bis zum Tod, im Familienverband. In Sachen Respekt können ihrerseits rücksichtsvolle Reisende zweifellos eine gute Portion lehrreicher Erfahrungen mit nach Hause nehmen. Vor Ort sollten sie also die geltenden Essgewohnheiten tolerieren, nicht ohne Einladung in die Kochtöpfe gucken, das servierte Essen nicht kritisch mit der Nase prüfen … Die im Land geltenden Gesten wie bspw. das Heranwinken mit nach unten gerichteter Handfläche zu übernehmen, ist auch ein Beweis für die eigene Bereitschaft, sich dem Verhalten der Besuchten anzunähern.
Schlepper/„Fixer“: Touristen – nicht nur ausländische – sind immer wieder beliebte Ansprechpartner für selbsternannte Guides, Transportvermittler und „Einkaufsberater“, die natürlich vorgeben, die allerbesten Angebote parat zu haben. Wie schon unter dem Tipp „Fahrer/Guides“ empfohlen (s. S. 26), sollte man sich vor diesen Offerten hüten und sich an offizieller Stelle nach akkreditierten Dienstleistern erkundigen. Auf Ämtern wird zwar vor ihnen gewarnt („beware of fixers“) dennoch sind diese überaus hilfsbereit erscheinenden Damen und Herren aktiv, wollen den Wartenden an der Schlange vorbei beschleunigt zur Amtsstube und zur Erledigung der sonst wahrscheinlich langwierigen Angelegenheit bringen − gegen Bezahlung unter der Hand, die sie sich selbstverständlich und ebenso diskret mit der Person am anderen Ende der Amtshandlung teilen. Wer sich darauf einlässt, läuft gleichwohl Gefahr, wegen Korruptionsversuchs angezeigt zu werden und zusätzlich zum Schmiergeld noch mehr berappen zu müssen. Neben Anbietern eines günstigen Devisenwechselkurses sind auf den Straßen der Großstädte und in den Touristenzentren auch Typen unterwegs, die gezielt Männer gesetzteren Alters auf Potenzmittel ansprechen. Ganz anrüchig und obwohl strengstens verboten immer noch an der Tagesordnung sind Vermittler, Frauen wie Männer, die Kinder zum Sex anbieten, von den vielen Offerten seitens zwielichtiger Taxifahrer, Hotelangestellter und sonstiger „freundlicher“ Passanten, die sich um das sexuelle Wohlergehen männlicher Ausländer sorgen und chicks (junge Frauen) vermitteln wollen, ganz zu schweigen.
Schuhe: Die Fußbekleidung gilt im traditionellen Umgang der Menschen Asiens untereinander als unrein, gleichzeitig sind sie, ob elegante Ausgehschuhe oder modern gestylte Sportschuhe, Statussymbol. Die Höflichkeit gebietet es dem Gast in einem Privathaus allemal, sie vor dem Betreten auszuziehen, dies zumindest anzubieten. Oft, ebenso aus Höflichkeit, gestatten die Gastgeber es, dass man die Schuhe anbehält. Im Gegensatz zu Moscheen behalten die Besucher und Gläubigen in Kirchen ihre Schuhe an. Auch Szenen wie in Thailand oder Indonesien, wo z. B. vor der Türschwelle zu einem Internetcafé oder Telefonshop mehrere Paare Sandalen und Schuhe liegen, weil alle Besucher barfuß eintreten, findet man in den Philippinen ganz selten. Sehr höflich ist es wiederum, wenn man vor Betreten eines Hauses von indigenen Filipinos, wo das Barfuß-Gebot noch viel stärker beachtet wird, die Schuhe auszieht.
010kp-ags
Schuhputzer und Schuster finden sich in jedem größeren Ort
Sex als Geschäft: Aufgrund einseitiger Berichterstattung und wenig kritischem Informationsverhalten assoziieren viele Ausländer die Philippinen mit besonderer Freizügigkeit in sexuellen Dingen. Auch Reiseberichte aus früheren Jahrhunderten, die den Bewohnern anlässlich bestimmter, im prüden Europa unvorstellbarer Sexualpraktiken einen Status der Unsittlichkeit verpassten, mögen zu dem Image beigetragen haben. Dann setzte der Vietnamkrieg dem noch eins drauf, als dank der Unterstützungspolitik des Marcos-Regimes zigtausend GIs regelmäßig zur „Erholung“ ins Land kamen. Wie das in der Praxis aussah, konnten neugierige Reisende noch bis in die späten 1980er-Jahre nahe bei den damals noch operierenden US-Stützpunkten in den Städten Angeles City und Olangapo City nachempfinden.
Abseits vom Rotlicht-Gewerbe und Amüsement nimmt Sex natürlich eine wichtige Rolle ein, aber längst nicht in der Dimension, wie es verschiedene Seiten gerne darstellen und sehen wollen. Die Medien räumen Sex und Sexualität nach westlich-amerikanischem Vorbild einen nicht zu übersehenden Platz ein, (fast) nackte Fotomodels und Starlets zieren die Seiten der Boulevardpresse, Telenovelas und Talkshows nehmen sich des scheinbar unerschöpflichen Themas an. Das „einladende“ Umfeld und die Nightlife-Szene der Städte mögen vor allem allein reisende Männer dazu animieren, in einschlägigen Bars und im Umgang mit Prostituierten ihre Landeskenntnisse zu vertiefen. Die meisten der Beschäftigten im Milieu – das reicht vom Straßenstrich bis zur Call-girl-/-boy-Agentur - versuchen aus sozialer Not heraus so den Lebensunterhalt für sich und die Familie zu sichern. Oft mit dem Wunschziel, einen „liebenswerten“ Partner zu finden und ihm ins Ausland zu folgen. Doch die Gefahren solcher Kontakte sind nicht zu unterschätzen: Betrug, Raub, Geschlechtskrankheiten. Den besten Schutz gewährt Abstinenz. (Siehe zum Thema auch die Kapitel „Frauen in der Gesellschaft“ ab Seite 200 und „Früh übt sich … was Ausbeutung heißt“ ab Seite 217.)
059kp-ags
Buddhistische Devotionalien zieren die Auslagen vieler Geschäfte in Manilas Chinatown
Souvenirs: Das Angebot ist riesig und kann hier nicht detailliert aufgeführt werden. Während asiatische Touristen als Mitbringsel vornehmlich die preisgünstigen Artikel der Einkaufszentren bevorzugen, also Kleidung, Schuhe, Lebensmittel, soweit für die Ausfuhr gestattet etc., finden Westler oft Gefallen an Kunsthandwerk, Muschelschmuck, Schnitzereien und Kirchenkunst. Nicht alles ist echt und wenn, kann ein Ausfuhrverbot gelten. Dazu sollte man sich an kompetenter Stelle informieren: beim Fremdenverkehrsamt, der Zollbehörde, Naturschutzverbänden. Gerade bezüglich der attraktiven Seeschnecken und Korallengebilde herrscht Verwirrung und Desinformation vor. So verkaufen Händler in Puerto Galera oder auf Boracay völlig öffentlich höchst bedrohte Schneckengehäuse, die schon seit Jahren auf der Roten Liste des Washingtoner Artenschutzabkommens stehen. Auch alte Heiligenstatuen, die immer wieder in Antiquitätengeschäften angeboten werden, können am Flughafen mit saftiger Strafgebühr konfisziert werden. Dann schon lieber eine gute Imitation erwerben und sich vom Verkäufer eine entsprechende Bestätigung ausstellen lassen. Vorsicht ist auch geboten beim Mitnehmen von frischem Obst, die philippinischen Mangos liegen als Mitbringsel auf der Beliebtheitsskala ganz oben. Weil sie jedoch intensiv riechen und unterwegs faulen können, sind in getrockneten Scheiben oder Streifen verpackte Mangos als Reisesouvenirs den frischen Früchten vorzuziehen. Außerdem dürfte der heimische Zoll die Einfuhr von außereuropäischen Lebensmitteln nicht so einfach akzeptieren. An den Transport von Durian, der durchdringend riechenden, sehr nahrhaften und angeblich als Aphrodisiakum einsetzbaren „Stinkfrucht“, braucht man gar nicht erst zu denken (höchstens in Form von verpackten Bonbons). Denn die in Teilen von Mindanao gedeihenden Durianfrüchte dürfen nicht einmal in Hotels oder ins Gepäck bei Inlandflügen mitgenommen werden.
Statussymbole: