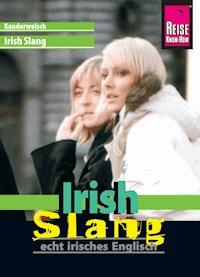
Reise Know-How Sprachführer Irish Slang - echt irisches Englisch: Kauderwelsch-Band 191 E-Book
Elke Walter
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reise Know-How Verlag Peter Rump
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Kauderwelsch
- Sprache: Deutsch
Dieser unkonventionelle Sprachführer erklärt die Sprache des irischen Alltags – so, wie sie normalerweise nicht im Wörterbuch steht: Sprüche, Floskeln und Frotzeleien, Sprichwörter, Trinksprüche, Schimpf- und Kosewörter, Verballhornungen, Kraftausdrücke und noch viel mehr. Schon James Joyce konnte sich das eine oder andere "fuck" in "Ulysses" (1922) nicht verkneifen. Eine umgangssprachliche Ausdrucksweise gilt in Irland als weniger anrüchig als anderswo, gelten die Iren doch als die unflätigste Nation Europas und (neben den Australiern) als die besten Flucher der englischsprachigen Welt. +++ Kauderwelsch Slang verrät die lockeren und flapsigen Ausdrücke der Alltagssprache, die saftigen Flüche, mit denen die Menschen ihrem Ärger Luft machen, die Sprache der Szene und der Straße. Mit Kauderwelsch Slang kann man den landestypischen Humor verstehen, in den Jargon der nächtlichen Großstadt eintauchen, Einheimische beeindrucken und natürlich Leute kennenlernen. Auch Fortgeschrittene können hier noch viel Neues entdecken. Im Register sind etwa 1000 Slang-Begriffe aufgelistet, die in klassischen Wörterbüchern kaum zu finden sind. +++ Kauderwelsch Sprachführer von Reise Know-How: handlich, alltagstauglich, für über 150 Sprachen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 118
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Inhalt
Inhalt desbegleitenden Tonmaterials(separat erhältlich)
Vorwort / Einleitung
Track 1
Begleitendes Tonmaterial
Slang – Wozu?
Irish Slang – Wozu?
Hinweise zu diesem Buch
Karte des Sprachgebiets
So spricht man’s
Track 2
Kleiner Grammatikvergleich
Track 3
Der Slang
How’s the craic?
Track 4
– wie Iren sich begrüßen und verabschieden
Grand days & dirty ould days
Track 5
– das Wetter
Up to Dublin & Down the country
Track 6
– Örtliches
Dead on two
Track 7
– Zeitliches und wichtige Tage
Fair dues & Away with ye!
Track 8
– Wechselbad der Gefühle
Gostering
Track 9
– Tratsch & Klatsch auf die irische Art
Blather, loopers & headers
Track 10
– Quatsch, Dumme & Verrückte
The man above & cup-tossing
Track 11
– Glaube & Aberglaube
Keeping the bones green
Track 12
– das blühende Leben / nicht auf der Höhe sein
Snapper, proontach & harrow-bones
Track 13
– Gören, Dicke & Dünne
Heelers & skivers
Track 14
– in Arbeit & arbeitslos
Bowls, flats & punters
Track 15
– Sport, Kartenspiel & Wetten
Just for the craic
Track 16
– Spaß & Outfit, Musik & Film
A cup an a slice
Track 17
– die größten Teetrinker & ihre Esskultur
Out on the piss
Track 18
– vom Trinken & Saufen
The jacks
Track 19
– auf dem Lokus
The troubles
Track 20
– der Nordirlandkonflikt
Effin and blindin
Track 21
– des Iren Vorliebe fürs Fluchen
Having kissed the Blarney Stone
Track 22
– vom ersten Schmeicheln bis zum Traualtar
The bold thing
Track 23
– vom Sex & seinen Folgen
Anhang
Literatur- & Surftipps
Register
Die Autorin
Impressum
Vorwort
Wie fluchen Iren? Wie beginnen Iren ein Gespräch, lassen Iren Dampf ab, lästern Iren? All das und viel mehr soll in diesem Buch interessieren, auf dass der bereits ins Englische Eingeweihte auch im Pub oder auf dem Markt, an der Bushaltestelle oder im Nachtklub nicht nur Bahnhof versteht, sondern mitreden kann.
Die in Dublin aufzuschnappende Lautfolge Dyeknowwharrimean? könnte vom ungeschulten Ohr vorschnell als Nicht-Englisch oder aber als völlig unbekannte Vokabel wahrgenommen werden. Weit gefehlt, denn es verbirgt sich ein ordinäres „Do you know what I mean?“ dahinter. Schwieriger noch, wenn ungewohnte Aussprache gepaart mit unbekannter Verwendung daherkommt. Der Satz I threw me ring up klingt beispielsweise zunächst einmal nach einem klaren Sachverhalt. Stattdessen weiß der Eingeweihte, dass sich der Sprecher tüchtig übergeben musste und nicht etwa den Nachmittag damit verbrachte, seinen Ring in die Luft zu werfen.
Doch mithilfe der großen Offenheit der Iren wird man sich recht schnell „einhören“ und Sprache wie Leute lieben lernen, sollte man dem Charme der grünen Insel nicht schon längst verfallen sein.
Viel Spaß beim Lesen, Ihre
Elke Walter
Begleitendes Tonmaterial
Zu diesem Buch ist begleitendes Tonmaterial aus der Kauderwelsch AUDIO-Reihe erhältlich. Es ist als MP3-Download erhältlich unter https://www.reise-know-how.de/produkte/kauderwelsch-aussprachetrainer-und-audio/audio-irish-slang-mp3-1272
Kauderwelsch AUDIO enthält alle Sätze und Redewendungen, die in diesem Buch vorkommen, ohne Wiederholung und ohne deutsche Übersetzung.
Hörproben: In ausgewählten Kapiteln im Konversationsteil dieses Buches können Sie sich unter den dort angegebenen Links Ausschnitte aus Kauderwelsch AUDIO anhören.
Irish Slang – Wozu?
Warum neben dem Kauderwelsch-Band „British Slang“ ein separater „Irish Slang“? Weil das irische Englisch in seiner Verwendung von Slang-begriffen erheblich vom britischen Englisch abweicht.
Es existieren ausreichend typisch irische Slangbegriffe, um von irischem Slang reden zu können. Diese Tatsache beruht nicht zuletzt auf dem immensen Einfluss des Gälischen auf das irische Englisch, auf Aussprache und Sprachmelodie, doch auch auf Wortschatz und Ausdrucksweise. Schließlich zählt ein großer Teil der irischen Bevölkerung Gälisch-Sprecher zu seinen Ahnen, und selbst jene Iren, die von Schotten und Engländern abstammen, zeigen diese Einflüsse, da sie seit langem mit Gälischstämmigen interagieren.
Überschneidungen zwischen dem britischen und irischen Englisch entstehen unter anderem durch Emigration nach Großbritannien und den sprachlichen Einfluss der Rückkehrer bzw. Besucher, die britische Slangausdrücke mitbringen. Deshalb gibt es natürlich große Schnittmengen, insbesondere zwischen dem stärker britisch beeinflussten Nordirland und Großbritannien.
Berücksichtigt werden hier vor allem Wörter und Wendungen, die typisch irisch sind. Doch es fließen auch einige ein, die ebenfalls im britischen Englisch zu finden sind. Sehr viele Begriffe und Wendungen des britischen Slangs werden in Irland zwar angewendet, diese aber auch zu benennen, würde hier jedoch den Rahmen sprengen.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die Iren und Nordiren mehr neue Slangbegriffe als die Engländer prägen. Das gilt insbesondere für junge Leute in Dublin und Belfast. Dublin verdient besondere Aufmerksamkeit, da hier mit 1 Mio. Einwohnern etwa ein Drittel der Bevölkerung der Republik bzw. ein Fünftel der gesamtirischen Bevölkerung lebt.
Das irische Englisch ist durch eine gewisse Einheitlichkeit gekennzeichnet. Die größten regionalen Unterschiede bestehen zwischen Ulster und dem südlichen Teil der irischen Insel. Das zeigt sich unter anderem in der Tatsache, dass Sprecher aus Ulster im Rest des Landes meist an ihrer Sprache erkannt werden. Auf regionale Besonderheiten wird im Buch durch ein entsprechendes Kürzel hingewiesen.
Ulster wird im Rahmen dieses Buches nicht politisch verstanden, sondern bezeichnet die historische Provinz im Norden Irlands (sechs nordirische Grafschaften und drei Grafschaften der Republik Irland).
Nicht alle Slangbegriffe werden von allen Sprechern gleichermaßen verwendet. Manche sind beschränkt auf eine bestimmte Region, andere auf eine bestimmte soziale Schicht oder eines der beiden politischen Lager in Nordirland. In vielen Fällen jedoch bedienen sich verschiedenste Gruppen der gleichen Begriffe, sowohl in der Stadt als auch auf dem Lande.
Hinweise zu diesem Buch
Irischer Slang wird in diesem Buch verstanden als der für die Republik Irland sowie Nordirland typische Alltagsjargon, nicht als Abbild aller gebräuchlichen Slangbegriffe. Gemeint ist nicht nur die Jugendsprache, sondern die Umgangssprache, die ebenso von Erwachsenen der verschiedensten Altersgruppen je nach sozialer Schicht und Sprechsituation verwendet wird. Slang und Umgangssprache werden vor allem mündlich, oftmals von Angehörigen der gleichen Alters- oder Berufsgruppe und in vertrauten Gesprächen verwendet, also innerhalb der Familie und des Freundeskreises. Die derberen Beispiele (gekennzeichnet mit *) werden, anders als die Umgangssprache, nur in ausgewählten Situationen benutzt. Sie werden in diesem Buch nur zur Information und der Vollständigkeit halber vorgestellt, sollten aber, wenn überhaupt, nur mit äußerster Vorsicht angewandt werden.
Ein herzhaftes „fuck“ ist mehr als verbreitet in Irland – und weniger anrüchig, als es uns unser Sprachempfinden vielleicht gebietet. In Irland ist eine umgangssprachliche Ausdrucksweise eben nicht so anstößig wie anderswo, vor allem in Ulster, wo soziales Prestige nicht an einer hochsprachlichen Norm festgemacht zu werden scheint. Wirklich vulgär sind hingegen die mit einem Sternchen gekennzeichneten Wörter und Wendungen.
Da Slang ein vorwiegend mündliches Phänomen ist, existieren verschiedene Schreibweisen der einzelnen Slangbegriffe. In diesem Buch wird versucht, die jeweils üblichste Schreibweise wiederzugeben bzw. die Variante zu wählen, die die Aussprache am besten zu reflektieren scheint. Bei Verkürzungen wie -in(= -ing), an(= and), o(= of) wird auf einen Apostroph verzichtet.
Damit man zumindest einen Eindruck bekommt, wie das irische Englisch ausgesprochen wird, sind im nachfolgenden Kapitel die vom Standardenglischen abweichenden Laute beispielhaft erklärt und mit einer leicht zu lesenden Lautschrift „lautlich übersetzt“.
Nebst dem für die Republik Irland sowie Nordirland typischen Alltagsjargon werden auch regionale Slangbegriffe vorgestellt: Ulster-Begriffe sind in diesem Buch jeweils mit einem hoch gestellten u markiert, Dubliner Begriffe jeweils mit d, Belfaster Begriffe mit b und Cork-Begriffe mit einem c, z. B.:
to be dead nuts on somethingu
total verrückt auf etwas sein
auf hundert sein, etwas stark ablehnen
Alle erklärungsbedürftigen Begriffe sind in kursiver Schrift wörtlich übersetzt. Dies mag manchmal etwas eigenartig anmuten, ist aber notwendig, um den Hintergrund zu erhellen. Das trifft vor allem auf die Begriffe zu, die auf den ersten Blick wie Standardeng-lisch wirken, tatsächlich aber vom irischen Gälisch oder Schottischen abgeleitet wurden und eine andere als die scheinbar offen-sichtliche Bedeutung haben. So wird beispielsweise im Falle des Begriffes bean-jacks(Damenklo) deutlich, dass bean nichts mit „Bohne“ zu tun hat, sondern aus dem Irischen kommt und einfach „Frau“ heißt.
Fehlt eine wörtliche Übersetzung, trifft die deutsche Übersetzung den Nagel auf den Kopf oder aber die Herkunft der Wendung ist bislang noch ungeklärt.
Karte des Sprachgebiets
So spricht man’s
Sprecher des irischen Englischs verwenden meist eine Mixtur der erläuterten Aussprachemerkmale. Grundsätzlich gilt, dass die Wahrscheinlichkeit des Auftretens der einzelnen Merkmale steigt, je mehr man sich in der sozialen Hierarchie abwärts bewegt. In Klammern finden Sie u. a. eine einfach zu lesende Lautschrift. Das durchgestrichene th dient zur Wiedergabe des englischen gelispelten „Tie-Äitsch“, und das durchgestrichene w steht für das englische mit gerundeten Lippen gebildete „Dabbelju“, also für Laute, die es im Deutschen nicht gibt.
Selbstlaute (Vokale)
a
1) wie in engl. up bzw. dt. „Masse“:
butcher (batsche(r)Fleischer), bullet (balletKugel);
2) statt „i“: thang (thängDing)
ay
wie in engl. day bzw. dt. „hey“:
bake (bäjkSchnauze), tay (täjTee), mate (mäjtFleisch)
az
wie in engl. azure bzw. dt. „Esra“
ez
statt „z“ wird „az / ez“ gesprochen:
azoo (esuuZoo), ezed (esädBuchstabe Z)
e
wie in engl. Africa bzw. dt. „Masse“:
ye(jedu / ihr), deffo (däffodefinitiv)
ee
wie in engl. see bzw. dt. „Fliege“:
eejit(iidschittIdiot), wee(wiiklein)
i
wie in engl. it bzw. dt. „Ritt“:
tin (tinnzehn), min (minnMänner), divil (diwilTeufel), yit(jittschon / noch)
oi
wie in engl. boy bzw. dt. „ahoi“:
boit (bojtbeißen), loik (lojkmögen)
Mitlaute (Konsonanten)
ck
weich wie engl. packet bzw. dt. „packen“:
pagget (päggit, Packung)
d
1) wie in engl. mad bzw. dt. „Bäder“;
2) stumm nach „l“ und „n“:
oul’ (oulalt), foun (faungefunden);
3) wie in engl. deal bzw. dt. „das“ statt stimmhaftes „th“:
dis (dissdies);
4) „d“ statt „t“:
Prodisan (prodissanprotestantisch, Protestant)
h
1) weich wie in engl. huge;
2) vor „w“ im Anlaut:
which (hwitschwelche), whether(hwätherob)
j
1) wie in engl. yard bzw. dt. „Jade“;
2) zwischen „g“ bzw. „c“ und „a“:
gjarden (gjaardenGarten), cjar (kjaarAuto)
pp
weich wie engl. pepper bzw. dt. „Lappen“:
pebber (päbbe(r)Pfeffer)
sch
1) wie in engl. ship bzw. dt. „schön“;
2) statt „s“ im Anlaut:
city (schittiiCity), six (schickssechs)
t
1) wie in engl. fit bzw. dt. „glatt“;
2) stumm nach „p“:
kep (käppbehalten), slep (släppgeschlafen);
3) statt „th“ wie in engl. tea bzw. dt. „Tunnel“:
tink (tinkdenken), tirty-tree (törti trii33)
4) „d“ statt „t“:
budder (badde(r)Butter)
th
1) stimmhaftes „th“ wie in engl. father;
2) bleibt stumm:
fa’er (faae(r),Vater), wea’er (wäe(r)Wetter)
Zwischen zwei Mitlauten wird manchmal ein „e“ zur Ausspracheerleichterung eingefügt: arrem(Arm), fillem(Film).
Eine Besonderheit des irischen Englisch ist auch die vom britischen Englisch abweichende Betonung verschiedener Wörter, so z. B. im Fall von discipline, lamentable und architecture.
Sonderfall Nordirland
Angehörige der nordirischen Arbeiterklasse können anhand ihrer Sprache dem katholischen bzw. protestantischen Lager zugeordnet werden. Im Gegensatz zu grammatikalischen Unterschieden zwischen den Konfessionen, die sich mit zunehmendem sozio-ökonomischen Status verlieren, finden sich bei der Aussprache, Betonung, Sprachmelodie und Sprechgeschwindigkeit auch an der Spitze der sozialen Pyramide Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten.
Katholiken benutzen zum Beispiel grundsätzlich ein helles „l“ und nennen den Buchstaben „h“ häjtsch. Protestanten bevorzugen hingegen ein dunkles „l“ und nennen das „h“äjtsch. Katholiken verwenden etwas längere Selbstlaute und weichere Mitlaute.
Der „u“-Laut in Wörtern wie butcher wird in Belfast entweder als „a“ oder „u“ umgesetzt. Es gibt keinerlei feste Regeln dafür, welche Variante der Sprecher verwendet; entscheidend ist lediglich Insiderwissen. Die „a“-Variante wird von Angehörigen einer bestimmten Gruppe als Identitätsmarker benutzt, während die „u“-Variante soziale Distanz ausdrückt. Unter jungen Angehörigen der Arbeiterklasse Belfasts ist bei butcher, bull und look der „a“-Laut beliebter. Dieses Phänomen verliert sich allerdings mit zunehmendem Alter zugunsten der Standardaussprache „u“.
Kleiner Grammatikvergleich
Die hier erläuterten Unterschiede zur Hochsprache treten teilweise auch außerhalb Irlands auf, scheinen in Irland aber auch in höheren Schichten akzeptabel zu sein als z. B. in Großbritannien. Ihre Verwendung ist dennoch letztlich abhängig von Bildungsstand und Schichtzugehörigkeit. Manche dieser Strukturen sind aus dem Gälischen übernommen und sind in Gebieten mit starkem gälischem Einfluss besonders stark vertreten (z. B. in Donegal und den Glens of Antrim).
Betonung von Satzteilen
Vor allem in ländlichen Gegenden mit noch starkem gälischen Einfluss ist das Vorrücken von Satzelementen, die stark betont werden sollen, verbreitet. Sätze werden oft mit it is begonnen:
It’s looking for more land a lot of them are.
Viele von ihnen suchen Land.
It is we that went …
Wir sind gegangen …
Well now, me myself I do it this road.
Also ich mach das so.
Road steht häufig anstelle von way.
But kann zur stärkeren Betonung am Ende einer Äußerung stehen:
It’s my round but.
Aber diese Runde geht auf mich.
In Ulster verdoppelt man at all zwecks stärkerer Betonung.
How are you doin atallatall?
Wie geht’s denn so?
Verben & Zeiten
I do be wird benutzt, um „I usually am“ aus-zudrücken, ebenso He bees writing oder He does be writing für „He usually writes“:
He bees going to Belfast every Tuesday.
He do go to Belfast every Tuesday.
He do be going to Belfast every Tuesday.
Er fährt jeden Dienstag nach Belfast.
Die Bildung der einfachen Vergangenheit von do und see erfolgt mit done bzw. seen:
She done it because she seen me do it.
Sie hat’s gemacht, weil sie gesehen hat, wie ich’s gemacht habe.
Anstelle „have + Partizip“ wird oft „a + Vergangenheit“ verwendet:
Ye should a went.
Du hättest gehen sollen.
Einige Partizipien und Vergangenheitsformen weichen vom hochsprachlichen Standard ab: clum statt „climbed“ oder wrought statt „worked“.
Außerdem wird die einfache Vergangenheit bevorzugt statt der zusammengesetzten Ver-gangenheit: Where were you? statt „Where have you been?“





























