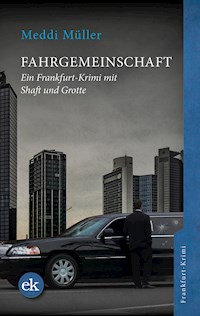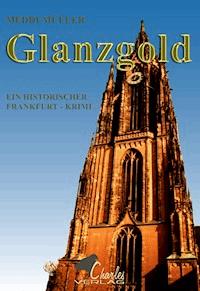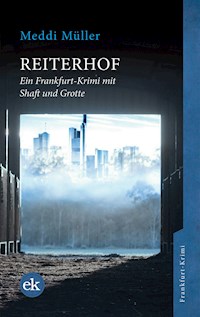
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag edition krimi
- Kategorie: Krimi
- Serie: Shaft und Grotte
- Sprache: Deutsch
Der junge Pferdewirt Peter Freiwald wird vermisst. Auf Drängen ihres Vorgesetzten, der dem Wachleiter in Bergen-Enkheim noch einen Gefallen schuldet, übernehmen Shaft und Grotte unter Protest den Fall. Schnell weisen die Indizien darauf hin, dass Peter Freiwald schon längst unfreiwillig aus dem Leben geschieden ist. Grotte und Shaft stoßen auf ein Geflecht aus Lügen, Intrigen, Eifersucht und Manipulation. Doch zu einem Mord fehlt ein entscheidendes Detail: die Leiche.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 256
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meddi Müller
Reiterhof
Ein Frankfurt-Krimi mit Shaft und Grotte
Frankfurt-Krimi
Frankfurt-Krimi
Müller, Meddi: Reiterhof. Ein Frankfurt-Krimi mit Shaft und Grotte. Hamburg, edition krimi 2022
Originalausgabe
EPUB-ISBN: 978-3-948972-45-5
PDF-ISBN: 978-3-948972-46-2
Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.
Print-ISBN: 978-3-948972-44-8
Lektorat: Birgit Rentz, Itzehoe
Umschlaggestaltung: © Annelie Lamers, edition krimi
Umschlagmotiv: © pixabay.com
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über https://dnb.d-nb.de abrufbar.
Die edition krimi ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg.
_______________________________
© edition krimi, Hamburg 2022
Alle Rechte vorbehalten.
https://www.edition-krimi.de
Inhalt
„Vorwort“
„Vermisst“
„Alte Kamellen“
„Der Vorfall“
„Klarheit“
„Wie gewonnen …“
„… so zerronnen“
„Im Trüben fischen“
„Verdichtung“
„Fundsache“
„Suche“
„Landluft“
„Verstärkung“
„Auferstehung“
„Was die Polizei (noch) nicht wusste“
„Abgehängt“
„Zeugen“
„Schutz“
„Berichte“
„Fragen“
„Dummheit?“
„Verhör Mertens“
„Verhör Hofmeister“
„Verhör Homburg“
„Wo ist Schröter?“
„Seitenwechsel“
„Spiel mit dem Feuer“
„Schlechtes Timing“
„Druck“
„Lösungen“
„In guten wie in schlechten Zeiten“
„Der Plan“
„Epilog“
„Danksagung“
Vorwort
Kennen Sie das auch? Es gibt Dinge und Orte, die begleiten Sie über einen langen Zeitraum. Sie lassen Sie nicht los und sind allgegenwärtig. Sie lauern unter der Oberfläche und nutzen jede Gelegenheit, ihre schmutzige Nase aus dem brackigen Wasser zu stecken. Und dann sind sie in Ihrem Kopf und lachen Ihnen feixend ins Gesicht.
Bei mir sind das Reiterhöfe.
Ich bin in Berkersheim aufgewachsen. Das ist der Frankfurter Stadtteil, in dem die wohlhabenden Städter ihre Pferde abstellen. Böse Zungen behaupten, dass es in Berkersheim mehr Pferde als Menschen gibt. Früher gab es hier auch mal Kühe und Schweine, aber mit Pferden ist mehr Geld zu verdienen. Sie sind allgegenwärtig in Frankfurts kleinstem Stadtteil. Hier gibt es keine Ampel, keinen Supermarkt, weder Sportplatz noch Turnhalle und die Grundschule wurde vor Kurzem geschlossen. Allerdings existiert an diesem Ort eine Kneipe, die zudem eine gute Adresse ist und als einziges kulturelles Highlight ein Theater beherbergt. Und wie schon angedeutet, gibt es hier …
… massenhaft Pferde.
Der dörfliche Charakter des Ortes unterstützt das Vorurteil, dass man sich hier in einem Kaff befindet. Hier werden Pferde paarweise durch die Straßen geführt, egal, ob dadurch der Verkehr zum Erliegen kommt. Man muss da jetzt mit den Pferden lang, deshalb haben sich gefälligst alle anderen danach zu richten. Wer sich hier umsieht, könnte meinen, dass die Straßen nicht gepflastert, sondern mit Pferdeäpfeln versiegelt sind. Überall im Ort liegen die riesigen Haufen herum und es riecht nach nassem Leder und frisch gelegtem Heumist.
Während Hundebesitzer heutzutage dazu angehalten sind, die Hinterlassenschaften ihrer Tiere mittels einer kleinen Tüte aufzunehmen und ordentlich zu entsorgen, hat man hier den Versuch unternommen, an strategisch günstigen Punkten Eimer und Schaufel zu platzieren und das Ganze dann als kostenlosen Rasendünger zur Verfügung zu stellen. Klappt aber nur bedingt, weil es immer wieder Menschen gibt, denen es schlichtweg egal ist, dass auf der Straße womöglich die haushohe Hinterlassenschaft eines Pferdes liegt und sämtliche Passanten drum herummanövrieren müssen.
Die unterschwellige Arroganz und das Verhalten manch reitender Planetenmitbewohner haben mich geprägt und nie wieder losgelassen.
Der übertreibt, denken Sie jetzt vielleicht.
Durchaus möglich.
Aber überlegen Sie doch mal, wie es wäre, wenn Sie morgens um sieben Uhr auf dem Weg zur Arbeit sind und das Erste, was Sie sehen, ein warmer, dampfender Haufen ist, den ein Pferd direkt vor dem Hoftor platziert hat. Keine so schöne Vorstellung, nicht wahr?
Oder wenn Sie regelmäßig angebrüllt werden, weil Sie »zu nah« an einem Pferd vorbeiradeln oder -gehen, obwohl Sie extra Abstand halten aus Angst, der Gaul neben Ihnen könnte ausflippen.
Ich will nicht behaupten, dass ich wegen der Situation im Stadtteil Berkersheim schlaflose Nächte habe, aber die damit einhergehenden Einschränkungen sind tief in mir vergraben. Und selbst wenn Sie ein Pferd besitzen, müssen Sie zugeben, dass Pferdeliebhaber ein ganz besonderer Typ der menschlichen Gattung sind. An erster Stelle kommt bei ihnen das Pferd, dann lange Zeit nichts und erst danach der Rest. So ist es doch, oder?
Erschwerend kommt hinzu, dass es sage und schreibe dreihundertachtzigtausend Treffer bei Google gibt, wenn man die Suchbegriffe »Mord« und »Reiterhof« zusammen eingibt.
Kaum zu glauben, aber in Deutschland werden überproportional viele Morde auf Reiterhöfen gezählt beziehungsweise Taten, die mit diesen in Verbindung stehen. Ich selbst war mal als kleines Licht an der Aufklärung eines Reiterhofmordes beteiligt. Wie und wo genau das war, können Sie in meinem Buch »Das glaubt mir keine Sau« nachlesen, das Ende 2022 im CharlesVerlag erscheint.
Mit Aufkommen der »True Crime«-Podcast-Welle wurde ich immer wieder mit Reiterhofmorden konfrontiert. Jene Morde wurden zum Teil derart dilettantisch verübt, dass es schon an Lächerlichkeit grenzt.
Der hier vorliegende Roman basiert auf ebendiesen wahren Fällen. Er kombiniert einige der stattgefundenen Mordfälle, und immer, wenn Sie während des Lesens denken, das sei jetzt aber an den Haaren herbeigezogen, dann ist es in der Regel exakt so gewesen. Also sparen Sie sich Rezensionen mit Schlagworten wie »überkonstruiert«, »hanebüchen« oder der Behauptung, es werden zu viele Klischees bedient, denn genau an diesen Stellen wird es real.
Wir haben es hier ja nicht mit Profikillern, sondern mit »normalen« Menschen zu tun, die falsche Moralvorstellungen haben. Und wenn Sie mir nicht glauben, machen Sie sich doch mal die Mühe, die Reiterhofmorde von Münster und Maintal zu recherchieren. Spätestens dann werden Sie auf Ähnlichkeiten stoßen und sich darüber wundern, wie dumm Menschen sein können. Die Geschichte wurde von mir natürlich angepasst, Details wurden vermischt und in eine andere Reihenfolge gebracht, Protagonisten neu erfunden. Die Inspiration jedoch basiert auf wahren Begebenheiten.
Ach ja: Zum Wohle der besseren Lesbarkeit verzichte ich auf das Gendern und bitte hiermit alle Geschlechter, mir das nachzusehen. Ich bin in dieser Frage zwar noch unentschieden, habe aber bisher nie so ganz den Sinn darin verstanden, da ich grundsätzlich nicht in Schubladen denke. Sicher bin ich mir allerdings, dass das Gendern in einem Roman nichts verloren hat. Ich will niemanden verletzen, ausgrenzen oder diskriminieren. Ich will einfach nur eine Geschichte zu Ihrer Unterhaltung erzählen …
Ihr Meddi Müller
Vermisst
»Und was sollen wir da jetzt machen?«, fragte Christian Köhler.
»Ich hab’s dir doch erklärt«, entgegnete Sascha Ballauf genervt. »Es ist möglich, dass Peter Freiwald tot ist, und deshalb sollt ihr dazustoßen.«
»Noch wird er nur vermisst«, sprang Sabine Grotewohl ihrem Partner bei. Sie verstand die ganze Aktion ebenfalls nicht. Sabine Grotewohl und Christian Köhler, im Präsidium auch als »Grotte« und »Shaft« bekannt, waren nämlich bei der Mordkommission und nicht bei den Vermissten angesiedelt. Grottes Spitzname leitete sich von ihrem Namen und ihrer gelegentlich groben Art ab, während »Shaft« auf Christian Köhlers Hautfarbe anspielte. Er war ebenso schwarz wie der aus den 1970er-Jahren bekannte US-Fernsehkommissar Shaft.
Grotte und Shaft waren schon seit Langem ein Team und auch privat beste Freunde. Trotz oder gerade wegen ihrer jahrelangen Verbundenheit waren sie nicht immer einer Meinung, aber selten waren sie sich so einig wie in diesem Moment. Sascha Ballauf hatte sie vor wenigen Minuten einem Vermisstenfall zugeteilt, und dieser war schlicht und einfach nicht ihr Aufgabengebiet.
»Ich habe keine Lust, mit euch zu diskutieren«, bellte Ballauf. »Noch bin ich euer Vorgesetzter, und deshalb macht ihr jetzt, was ich euch sage!«
Das mit dem »noch« bezog sich auf Ballaufs Pensionierung, die in wenigen Monaten anstand.
»Wir sind zwar Beamte«, konterte Grotte, »aber keine Leibeigenen, mein Freund.«
»Und ich bin nicht dein Freund, sondern dein Boss, und jetzt seht zu, dass ihr euch bei Dieter meldet, Herrgott noch mal!« Damit ließ Ballauf die beiden stehen und eilte in Richtung seines Büros davon. »Immer diese Diskutiererei …«, motzte er und schlug die Bürotür krachend hinter sich zu.
Grotewohl und Köhler sahen sich fragend an, dann hoben sie synchron die Schultern und wandten sich zum Gehen. Wenn der Boss es so wollte, würden sie eben nach einem Vermissten suchen.
»Wenigstens müssen wir nicht nach einer Katze Ausschau halten«, bemerkte Grotte und beide lachten. Sabine Grotewohl war Ende zwanzig, klein, schmal und flink. Auf den ersten Blick eine leichte Beute, doch genau das wurde ihren Gegnern oft zum Verhängnis. Sie hatte den dritten Dan in Hapkido, einer fernöstlichen Kampfsportart. Die Nasen, die sie im Laufe ihrer Karriere bereits gebrochen hatte, konnte sie kaum zählen. Ihr Kleidungsstil mutete lässig an und stand in starkem Kontrast zu dem ihres Partners, der ausnahmslos maßgeschneiderte Anzüge trug. Grotewohls grüne Augen waren stets hellwach und scannten ununterbrochen die Umgebung. Sie war schlagfertig und frech. Darüber hinaus war sie mit einem wachen Verstand ausgestattet, aber auch mit einer gehörigen Portion Zorn, der so manches Mal dazu führte, dass ihr die Sicherungen durchbrannten. Ihre blonden Haare band sie meist zu einem Zopf zusammen, der beim Laufen hin und her wippte.
Sie stand neben Köhler am Aufzug und blickte auf die Anzeige oberhalb der stählernen Flügeltür. Minutenlang tat sich nichts. Ungeduldig betätigte sie ein weiteres Mal die Ruftaste.
»Meinst du, so geht es schneller?«, kommentierte Köhler.
»Kann ja sein«, wehrte sie ab.
»Klar«, murmelte Köhler, der ebenfalls allmählich die Geduld verlor.
»Lass uns die Treppe nehmen«, schlug Grotewohl vor.
»Wir sind im dritten Stock!«, gab Köhler zurück.
Grotewohls Blick sagte mehr als tausend Worte. Sie musterte ihren Kollegen. »Waschlappen!«, bemerkte sie abfällig.
»Ich hab mir beim Kicken das Knie verdreht«, entgegnete Köhler. Das stimmte zwar, verursachte aber weniger Probleme, als er zuzugeben bereit war. Er musste noch nicht einmal humpeln.
»Schwing deinen Arsch zum Treppenhaus, Shaft!«, befahl Grotewohl und lief los.
Köhler ließ die Schultern sinken und grummelte ein gequältes »Boah ey …« Schließlich gab er seinen Widerstand auf und folgte Grotewohl zum Treppenhaus.
Als sie die Tür aufschlugen, hielten sie überrascht inne. Auf den Stufen war mehr los als an einem Samstagmorgen auf der Zeil. Offenbar war der Aufzug tatsächlich defekt. Das war nicht verwunderlich und kam gelegentlich vor. Bei der Polizei machte sich der Investitionsstau mittlerweile auf allen Ebenen bemerkbar.
Auffällig war allerdings, wie schlecht gelaunt die Treppenläufer wirkten. Jeder Einzelne fluchte entweder leise vor sich hin oder suchte Bestätigung bei den anderen, wenn mehrere gemeinsam die Stufen erklommen oder hinabeilten. Grotewohl und Köhler hielten die Tür auf, um eine Handvoll Kollegen passieren zu lassen. Dabei schnappten sie einige Sätze auf.
»Diese Vollidioten!«
»Schick die doch endlich in Pension!«
»Haben die denn früher keine Einstellungstests gemacht?«
»Wie sind die bloß am Psychologen vorbeigekommen?«
»Die sollen froh sein, dass ich unbewaffnet bin.«
Grotewohl rätselte, welchen Sinn diese Worte haben mochten.
»Was ist denn los?«, fragte sie einen der Kollegen, der gerade an ihr vorbeistapfte.
»Was los ist?«, ereiferte sich dieser. »Die zwei Halbaffen sind aus ihrem Käfig geflohen, das ist los!« Mehr war aus ihm nicht herauszubekommen, denn er ging fluchend weiter.
Ratlos stiegen Köhler und Grotewohl die Stufen hinab. Je näher sie dem Erdgeschoss kamen, desto lauter drangen tumultartige Geräusche an ihre Ohren. Unten angekommen, öffneten sie die Tür zur Lobby und fanden sich inmitten eines Chaos wieder. Gleichzeitig schlug ihnen der Geruch von Kaffee, nassem Papier und nackter Panik entgegen. Noch bevor Grotewohl und Köhler die Situation begriffen, hielt ein Feuerwehrwagen vor dem Eingang. Sechs Feuerwehrleute in voller Montur stiegen aus und eilten in die Lobby. Zielstrebig liefen sie auf die Aufzüge zu. Schmidt und Laußner, die im Mittelpunkt der Szenerie standen, bemühten sich hektisch, den vermutlich von ihnen angerichteten Schaden zu beheben. Mehrere Thermoskannen lagen in der Lobby verstreut und eine Frau klemmte kreischend in der Aufzugtür. Um sie herum waren ein paar Leute damit beschäftigt, sie zu beruhigen, was ihnen jedoch nicht so recht gelang. Die Frau lag auf dem Boden und ihre Hand steckte im Spalt zwischen Aufzug und Türschwelle. Wiederholt schrie sie, man solle sie bloß nicht anfassen. Mittlerweile waren auch ein Rettungswagen und ein Notarzt eingetroffen. Ungläubig beobachteten Grotewohl und Köhler die Situation.
»Was zum …«, begann Köhler und hielt inne.
Eigenartig entrückt stand Grotewohl etwas abseits des Geschehens. »Wenn mich nicht alles täuscht, haben Schmidt und Laußner mit der Sache zu tun«, sagte sie in dem Versuch, die Situation zu erfassen.
»Oh mein Gott!«, erwiderte Köhler. »Das könnte ihr Meisterstück geworden sein.« Er konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen.
Zwischenzeitlich hatte die Frau das Geschrei eingestellt. Wenige Augenblicke später wurde sie aus ihrer misslichen Lage befreit und auf die Trage des Rettungsteams gelegt. Ihr Gesicht spiegelte unendliche Erleichterung. Ein routiniert wirkender Notfallsanitäter inspizierte ihre Hand, vollführte eine Geste, die wohl sagen sollte, dass alles halb so schlimm war, und gab das Kommando, die Frau abzutransportieren. Der Tross setzte sich in Bewegung. Einige Feuerwehrleute machten sich daran, den Aufzug wieder in Gang zu setzen, und wenige Minuten später war der Spuk bereits vorbei. Flachsende Feuerwehrmänner verließen die Lobby, die Schaulustigen verzogen sich in alle Himmelsrichtungen. Zurück blieben Schmidt und Laußner, beide mit schuldbewusstem Habitus. Ohne viel Aufhebens machten sie sich daran, das restliche Chaos aus herumliegenden Papieren und Kaffeepfützen zu beseitigen.
»Was denn?«, blaffte Laußner, als er Grotewohl und Köhler erblickte.
»Was habt ihr getan?«, wollte Köhler wissen.
»Es war ein Unfall«, murmelte Schmidt, der gerade hinter einer Säule mehrere Teile einer Thermoskanne gefunden hatte. Ungelenk baute er sie wieder zusammen und trat schließlich hervor. Wie man es von ihm kannte, trug er ein kariertes Flanellhemd und eine blaue Jeanshose, die von einem Gürtel mit einer überdimensionierten Schnalle gehalten wurde. Das Geräusch, das seine Cowboystiefel auf den Fliesen verursachten, schallte an den Wänden der Lobby wider, während er zu einem Teewagen stapfte. Seine roten Haare hatte er zwar wie gewohnt nach hinten gegelt, jedoch hingen einige Strähnen unkontrolliert herunter. Vermutlich war das vorangegangene Chaos daran schuld. Schmidt richtete seine Frisur mit einem Kamm, den er aus seiner Gesäßtasche hervorholte, sobald er die Hände wieder frei hatte. Sein martialisch anmutender Ion-Tiriac-Gedächtnisbart ließ es nicht zu, dass dessen Träger so etwas wie Würde ausstrahlte.
»Guck nicht so!«, schnauzte Schmidt und räumte weiter auf. »Die Olle ist quasi aus dem Nichts gekommen.«
Grotewohl und Köhler schwiegen. Laußner eilte seinem Freund zu Hilfe. »Die ist uns voll in den Karren gerannt. Ohne Scheiß. Wir hatten keine Chance!«
»Wir hatten doch gar nicht gefragt«, entgegnete Köhler. »Geht uns ja auch nichts an.«
»Wir wollen nur nicht, dass nachher wieder irgendein Müll erzählt wird. Wir sind hier mit dem Servierwagen am Aufzug vorbeigelaufen und die Schnalle ist uns voll in den Karren gerannt«, wiederholte Schmidt das Gesagte.
Laußner ergänzte: »Ganz genau, wir hatten keine Chance!« Er hob einen durcheinandergeratenen Papierstapel auf und legte ihn auf den Servierwagen. »Jetzt seht euch das Malheur hier an. Wie sollen wir das alles wieder in die richtige Reihenfolge bringen?«
»Ich nehme an, die Seiten sind nummeriert.« Grotewohl schmunzelte.
Laußners Blick verriet, dass er das nicht bedacht hatte. Seine Erscheinung entsprach wie immer einem Klischee. Er war übergewichtig, aber nicht wirklich fett. Darüber hinaus war er starker Raucher und ein vehementer Verfechter der Sport-ist-Mord-These, was dazu führte, dass er der womöglich unfitteste Frankfurter Polizist war, der jemals hier seinen Dienst versehen hatte. Er trug ausschließlich schwarze T-Shirts in Kleidergröße Zirkuszelt, von denen er Unmengen besaß, und Jeans, die unterhalb seines Bauchs von einem Gürtel gehalten wurden. Es erweckte den Anschein, als würde das T-Shirt den Bauch wie in einem Sack vor dem Hosenbund hertragen. Laußner hatte ein rundes Gesicht und erstaunlich dichtes Haar, das er zu einer Igelfrisur getrimmt hatte. Unter seiner Nase trug er einen Oberlippenbart, der seiner Erscheinung einen lächerlichen Zug verlieh. Einzig seine grellen, hellblauen Augen waren etwas, was man als betrachtenswert erachten konnte. »Wir sind unschuldig«, beteuerte er.
Schmidt unterstrich die These mit einem Grunzen. »Die soll bloß nicht auf die Idee kommen, uns zu verklagen!«
»Wie ist denn deren Hand in den Aufzugschlitz geraten?«, wollte Köhler wissen.
»Keine Ahnung.« Schmidt und Laußner tauschten ratlose Blicke. »Ist einfach passiert.«
»Na ja, dann macht’s mal gut«, sagte Grotewohl. »Wir müssen los.«
Damit überließen sie die Kollegen ihrem Schicksal.
Auf dem Weg zum Parkplatz konnten sie sich ein Lachen nicht mehr verkneifen.
»So was kann auch nur den beiden passieren«, kommentierte Köhler und schloss seinen Mercedes Benz DB 300 SL W 198 Baujahr 1957 in Lackschuhschwarz auf. Grotewohl pflichtete ihm bei und stieg auf der Beifahrerseite ein. Das historische Fahrzeug war Köhlers ganzer Stolz. Und er konnte sich einen solchen Luxus leisten, denn sein Vater hatte ihm ein Vermögen vermacht. Christian Köhler war dreiunddreißig Jahre alt, ein Meter neunzig groß, Hauptkommissar, Leiter der Ermittlungsgruppe und von dunkler Hautfarbe. Grundsätzlich ein lockerer Typ, der aber einen unglaublichen Biss entwickeln konnte, wenn es darum ging, Verbrecher dingfest zu machen. Er spielte gerne auch mal schmutzig und wohnte gemeinsam mit seiner Mutter in einem Einfamilienhaus im Frankfurter Ortsteil Harheim. Köhler befand sich in keiner festen Beziehung; das aber nicht aus Mangel an Interessentinnen, sondern aus Überzeugung. Er liebte seine Unabhängigkeit. Ein echter Frankfurter Bub. Vater Deutscher und ehemaliger Fußballprofi beim englischen Drittligisten Bristol City, wo er kaum Spuren hinterlassen hatte. Die meisten Schlagzeilen hatte er produziert, als er Anfang der 1990er-Jahre bei einer Prostituierten aus dem Bett gefallen war und sich dabei die Schulter verletzt hatte. Viel zu früh war er an Krebs gestorben. Köhlers Mutter stammte aus Nigeria und arbeitete als Verkäuferin in einer Bäckerei. Köhler brachte es nicht übers Herz, sie allein zu lassen. In seiner Freizeit spielte er bei der SG Harheim in der A-Klasse und bekam immer mal wieder Angebote von höherklassigen Vereinen, die er jedoch grundsätzlich ablehnte. In Harheim, wo er auch aufgewachsen war, konnte er ungestört leben. Hier war sein Zuhause. Gelegentlich lieferte er sich mit den Dorfdeppen Diskussionen, ließ aber auch gut gemeinte Frotzeleien über sich ergehen, die auf seine Hautfarbe abzielten. Letztendlich trug er dazu bei, bei den Eingeborenen rassistische Vorurteile abzubauen. Sein Vater hatte das Geld aus seiner Profilaufbahn klug investiert, sodass er Frau und Kind ein Vermögen hinterlassen konnte, das nachfolgenden Generationen ein gutes Leben garantierte. Christian Köhler arbeitete nicht des Geldes wegen, er tat es aus Überzeugung und Leidenschaft. Er war gerne Polizist. Die einzige Extravaganz, die er sich neben seinem Auto leistete, waren die maßgeschneiderten Anzüge und Schuhe, in denen er sich in Gesellschaft zeigte. Er liebte es, der bestangezogene Mann im Raum zu sein.
»Wo ist dieser Reiterhof?«, fragte er Grotewohl, als sie den Innenhof des Polizeipräsidiums verließen.
»In Bergen-Enkheim«, gab seine Partnerin Auskunft. »Einer dieser Aussiedlerhöfe an der B 521.«
Köhler nickte und sie genossen die Fahrt. Es war Anfang Mai und das Wetter lud zum Fahren mit offenem Verdeck ein. Der Wind blies ihnen um die Nase und zerstreute für einen Moment sämtliche Gedanken.
Kurz nachdem sie die Berger Warte passiert hatten, fragte Köhler nach der Adresse. »Wo genau soll das sein?«, rief er gegen den Fahrtwind.
Grotewohl wurde aus ihren Tagträumen gerissen. Der Ausblick von Frankfurts höchster Stelle hatte sie zudem in eine schwache Trance versetzt. Von hier aus konnte man bis in den Odenwald und in den Spessart blicken. »Was?«, stieß sie aus und rückte ihren Körper im Beifahrersitz zurecht.
»Hast du gepennt, oder was?«, rief ihr Partner erbost. »Du bist hier bei der Arbeit!«
»Na und? Man wird doch mal abschalten dürfen. Unser Job ist schlimm genug.«
Köhler hob missbilligend die Brauen, erwiderte aber nichts. »Was ist denn jetzt mit der Adresse?«, hakte er stattdessen nach.
Grotewohl kramte in ihrer Jackentasche und holte einen zerknitterten Zettel hervor. Sie faltete ihn auf, hielt ihn auf Distanz, kniff die Augen zusammen und versuchte, ihre Handschrift zu entziffern.
»Na, schlägt die Eitelkeit zu?«, erkundigte sich Köhler schmunzelnd.
»Ich weiß nicht, was du meinst«, gab Grotewohl zurück. »Ich seh noch alles.«
»Klar, allerdings verschwommen.« Köhler lachte kehlig.
Grotewohl schenkte ihm einen bösen Blick und deutete auf die Straße. »Konzentrier du dich auf den Verkehr, ich mach das hier!« Wieder kniff sie die Augen zusammen. »Du könntest dir auch mal ein Navi einbauen lassen.«
»In einen Klassiker kommt kein technischer Schnickschnack.«
Grotewohl zog die Stirn kraus und zog ihr Handy aus der Innentasche ihrer Lederjacke. Sie tippte die Adresse in das kleine Zaubergerät ein und hatte Sekunden später eine exakte Routenbeschreibung parat. »Das ist ja mitten auf dem Acker!«, stellte sie fest, als sie das Ergebnis begutachtete. »An der Ampel links!«
Köhler folgte der Anweisung.
»Gleich musst du links reinfahren«, sagte Grotewohl schließlich.
»Da ist nichts.«
»Doch, da muss was sein.«
»Ich fahr ja wohl nicht über einen Acker!«
»Da wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben.« Grotewohl reckte den Hals. »Dort ist es.« Sie deutete auf einen Feldweg.
»Vergiss es!«, erwiderte Köhler und bremste. Einen Augenblick später hupte es hinter ihnen. Köhler ignorierte das protestierende Geräusch.
»Fahr da rein, Mann!«, blaffte Grotewohl.
»Vergiss es!«
»Wir stehen hier mitten auf der Landstraße, du Wahnsinniger. Fahr gefälligst da rein!« Grotewohl sah sich um und winkte die hinter ihnen wartenden Autos vorbei.
Köhler machte immer noch keine Anstalten, die Fahrt fortzusetzen. »Du weißt schon, dass dies hier der Sportwagen des Jahrhunderts ist«, bemerkte er.
»Wie könnte ich das je vergessen, irgendjemand erinnert mich ständig daran.« Grotewohl wurde unruhig. »Jetzt steuere den Sportwagen des Jahrhunderts auf diesen Feldweg, sonst ist der bald Geschichte, so wie die hier alle um uns rumbrettern.«
Mehrere Fahrzeuge waren bereits in teils halsbrecherischen Manövern an ihnen vorbeigefahren und der Gegenverkehr trug ebenfalls nicht zur Sicherheit der Verkehrsteilnehmer bei.
»Shaft, ich bekomme langsam echt Schiss, dass die uns zu Brei fahren«, protestierte Grotewohl.
»Warum?«
»Jetzt fahr da rüber oder ich knall dich ab!« Um ihrer Aufforderung Gewicht zu verleihen, griff Grotewohl an ihr Halfter.
Der nächste Beinaheunfall, begleitet von lautem Hupen, überzeugte Köhler schließlich. »Wenn was kaputt geht, bezahlst du die Reparatur, das schwöre ich dir!«, fluchte er und lenkte den Mercedes auf den schmalen, unzureichend befestigten Weg.
»Verdammter Irrer!«, motzte Grotewohl und begann sich zu entspannen.
Köhler schwieg, während er hoch konzentriert und mit Schrittgeschwindigkeit den schmalen Weg entlangfuhr. Der Belag war grau, löchrig und an vielen Stellen mit getrocknetem Ackerboden bedeckt. »Katastrophe«, murmelte er und fuhr betont langsam.
»Ich würde gerne noch in diesem Jahr ankommen, Shaft.« Grotewohl verschränkte die Arme vor der Brust, doch Köhler ignorierte ihre Worte.
Nach etwa dreihundert Metern gelangten sie an eine Abzweigung. Linker Hand war ein großer Hof zu erkennen und rund um das Gehöft befanden sich einige Pferdekoppeln. Auf manchen von ihnen weideten Pferde, andere wurden als Parkplatz für Pferdeanhänger und landwirtschaftliches Gerät genutzt. Die insgesamt drei Gebäude, die u-förmig angeordnet waren, schienen die besten Tage hinter sich zu haben. An etlichen Stellen bröckelte der Putz.
Vorsichtig bog Köhler in eine kurze Allee ein, die, gesäumt von Pappeln, Besucher zum Hof führte. Das Hoftor war rostig und schien nicht mehr zu schließen, weshalb es mit Ketten, die an zerfledderten Holzpfosten angebracht waren, offen gehalten wurde.
»Was ist denn das für eine Bruchbude?«, bemerkte Grotewohl und sah sich angewidert um. »Da muss man ja Angst haben, dass einem das Dach auf den Kopf fällt.«
»Kann nicht jeder so reich sein wie ich«, frotzelte Köhler. Dann deutete er auf den rechten Teil des Gehöfts. »Außerdem wird doch schon renoviert.« Er lenkte damit Grotewohls Blick auf ein kleines Lagergebäude, das mit einem Gerüst eingekleidet war.
In der Mitte des Hofes unterhielt sich neben einem Polizeiwagen eine kleine Gruppe, die aus zwei Uniformierten und zwei in Reitklamotten gekleideten Frauen bestand.
»Wie es aussieht, sind das die Kollegen, die uns gerufen haben«, vermutete Köhler. Er lenkte den Wagen an den Rand des Hofes, wo er ihn in Sicherheit wähnte.
Die beiden Ermittler stiegen aus, als auch schon einer der Uniformierten auf sie zukam und ihnen im Gehen die Hand entgegenstreckte. »Sehr schön«, sagte er. »Sie müssen die Kollegen von der Mordkommission sein.«
Köhler ergriff die ihm dargebotene Hand, ihn beschlich jedoch ein mulmiges Gefühl. Nachdem die Corona-Pandemie Fahrt aufgenommen hatte, war Abstand das oberste Gebot gewesen. Doch jetzt, wo sich die Impfquote von Tag zu Tag steigerte und in der Bevölkerung eine Herdenimmunität zu erwarten war, feierte der Brauch des Händeschüttelns ein Comeback. Köhler hatte einen solchen Körperkontakt schon vor Corona als unhygienisch verurteilt, spielte jedoch das Ritual mit. Grotewohl war da konsequenter. Sie hielt dem Kollegen die Ghettofaust hin, die dieser breit grinsend kurz anstieß.
»Lustig«, sagte der Kollege und blickte Köhler augenzwinkernd an. »Diese Geste hätte ich eigentlich von Ihnen erwartet.«
Als Köhlers Blick starr blieb, bemerkte der Kollege, wie unpassend seine Bemerkung war, und ergänzte peinlich berührt: »Sorry, das war jetzt doof.«
»Vergiss es, Weißbrot!« Köhler winkte ab und schlug dem Kollegen auf die Schulter. »Ich bin den Scheiß gewohnt.«
»Das war auf keinen Fall rassistisch gemeint …«
»Ist doch gut, Kollege.« Köhler lächelte. »Ist angekommen. Sag mir lieber, wie du heißt und was hier los ist.«
Der Kollege räusperte sich und zupfte nervös an seiner Schutzweste. »Mein Name ist Patrick Schultz – Schultz mit ›tz‹.«
»Mein Name ist Köhler – mit ›ö‹. Und das ist die Kollegin Grotewohl, die schreibt sich mit ›o‹.« Köhler grinste.
Schultz kapierte den Witz nicht, zumindest reagierte er nicht darauf. »Gut«, sagte er und räusperte sich erneut. »Das wäre ja dann schon mal geklärt.« Er lachte unsicher. »Gehen wir doch rüber zu den anderen.« Er hob den Arm und deutete auf die kleine Gruppe, die immer noch mitten auf dem Hof stand. Die Frauen redeten und der Polizist machte sich Notizen.
»Das ist der Kollege Schultheiß«, stellte Schultz den anderen Polizisten vor.
»Mordkommission?«, wiederholte die ältere der beiden Frauen entsetzt, als sich Grotewohl und Köhler zu erkennen gaben. »Was soll das heißen?«
»Gar nichts, Frau Mertens«, beeilte sich Schultheiß zu sagen. »Wir wollen damit überhaupt nichts sagen.«
»Oh mein Gott!«, warf die junge Frau ein und schlug sich die Hand vor den Mund. »Sie denken, er ist tot?«
»Bitte, Frau Hofmeister …« Schultz, der sichtlich überfordert schien, warf Grotewohl und Köhler einen hilfesuchenden Blick zu.
Köhler hatte ein Einsehen und setzte zu einer Erklärung an: »Wir sind hier, weil Herr Wertheim, der Wachleiter des zuständigen Polizeireviers, ein Bekannter unseres Vorgesetzten ist.« Er ging auf die junge Frau zu. Sie hielt sich immer noch die Hand vor den Mund, dennoch konnte Köhler erkennen, dass sie ausgesprochen hübsch war. Die Ausstrahlung der Frau faszinierte ihn. Erleichtert bemerkte er, dass er sich erstaunlich gut im Griff hatte. Vielleicht lag es daran, dass er derzeit kein Interesse an einer Beziehung hatte. Noch vor wenigen Tagen hatte ihm eine seiner zahlreichen Affären offenbart, heiraten zu wollen, jedoch nicht ihn – und das, während sie mit einer brennenden Zigarette in der Hand nackt, erschöpft und verschwitzt neben ihm gelegen hatte. »Herr Wertheim hat um Unterstützung gebeten. Wir tun unserem Chef streng genommen nur einen Gefallen. Das ist alles.«
»Sie sind also Experten für vermisste Personen?«, hakte die ältere Frau skeptisch nach. Köhler zwang sich, seinen Blick von der jungen Schönheit abzuwenden, und sah nun die ältere Frau an, die zwar ansehnlich, aber längst nicht so gut aussehend wie die Jüngere war. Beide Frauen waren blond und trugen das Haar wirr zusammengebunden. Sie rochen nach Stall.
»Im Grunde genommen sind wir gar nicht hier, Frau …«, antwortete Köhler.
»Karina Mertens«, ergänzte die Angesprochene und hob das Kinn, als käme ihr Name einem Titel gleich. »Ich bin die Besitzerin des Hofes.«
»Ah«, machte Köhler und wandte sich ihr nun vollends zu. »Kann ich ja nicht wissen.« Köhler ließ seinen Blick über die Runde schweifen und seufzte. »Wie wäre es denn, wenn mir irgendjemand erklären würde, warum wir eigentlich hier sind?«
Alte Kamellen
»Das ist schnell erklärt«, hob Schultz an. »Peter Freiwald ist seit drei Tagen nicht mehr aufgetaucht.«
»Und wer ist Peter Freiwald?«, wollte Grotewohl wissen.
»Das ist mein Verlobter«, mischte sich die jüngere Frau ein.
»Entschuldigung«, sagte Grotewohl, die jetzt zum ersten Mal die Frau richtig in Augenschein nahm. Sie war beeindruckt von deren Schönheit. Dabei waren es nicht nur die ebenmäßigen Gesichtszüge. Da war noch mehr. Eine unsichtbare Komponente, die Grotewohl sofort in ihren Bann zog. Und das, obwohl die junge Frau alles andere als ausgehfertig war. Ihr Haar war nachlässig frisiert und zu einem unordentlichen Zopf gebunden. Ihr Gesicht war ungeschminkt und zwischen den Sommersprossen zeigten sich einige kleine Lehmspritzer. Besonders markant wirkten ihre Augen. Sie waren groß, von hellem Grün und wiesen dunkle Einschlüsse auf. Kleine, glitzernde Ohrringe, die lustig hin und her baumelten, hingen an ihren Ohrläppchen und schienen perfekt zu ihr zu passen – wie wahrscheinlich alles, was diese Frau jemals trug. Nicht zu vergessen die ellenlangen Wimpern und die perfekt geschwungenen Brauen. Die jeweiligen Komponenten des Gesichts wären für sich genommen mit Sicherheit nichts Besonderes gewesen, aber in der vorliegenden Kombination waren sie absolut faszinierend. Dazu hatte sie eine atemberaubende Figur. Die eng anliegenden Reiterklamotten ließen keinen anderen Schluss zu. Grotewohl musste sich zwingen, der Frau nicht um den Hals zu fallen und sie zu küssen.
»Wie war Ihr Name noch?«, brachte sie es fertig zu sagen.
»Ich bin Laura Hofmeister. Wie ich schon sagte, bin ich Peters Verlobte und mache mir große Sorgen um ihn. Es ist sonst nicht seine Art, so lange wegzubleiben, ohne sich zu melden. Dieter hat ja mit seinen Leuten schon alles abgesucht – leider ohne Erfolg.« Die junge Frau lächelte Köhler hoffnungsvoll an. »Ich hoffe, Sie können ihm dabei helfen, Peter zu finden.«
Köhler seufzte. »Wie ich die Sache sehe, kennt hier außer uns jeder den Kollegen Wertheim«, stellte er fest. »Scheint ja ’ne große Nummer zu sein. Den möchte ich jetzt auch mal kennenlernen.«
»Das können wir gleich erledigen«, warf Schultheiß ein und deutete mit dem Kinn in Richtung Hofeinfahrt. Alle wandten sich zum Hoftor um, durch das gerade ein Streifenwagen fuhr. Einige Meter vor ihnen kam der Wagen zum Stehen und ein großer Mann stieg aus. Ohne dick zu sein, verfügte er über eine ordentliche Leibesfülle. Sein Haar war grau und an manchen Stellen ausgedünnt. Eine ausgefallene Erscheinung.
»Ah!«, rief er freundlich, als er Grotewohl und Köhler sah. »Sie müssen die Verstärkung aus dem Präsidium sein.« Er trat ein paar Schritte näher.
»Können wir Sie kurz sprechen?«, bat Köhler.
Grotewohl, Köhler und Wertheim entfernten sich einige Meter von der Gruppe. Als sie außerhalb der Hörweite der anderen waren, blieben sie stehen.
»Was genau tun wir hier, Herr Wertheim?«, fragte Köhler.
»Dieter, nennen Sie mich Dieter. Wir sind doch Kollegen.«
»Klar, mach ich«, versprach Köhler. »Also, Dieter, was wird hier gespielt?«
Wertheim zögerte. Es schien ihm unangenehm zu sein.
»Bergen-Enkheim ist klein …«, begann er. »Es ist wie ein Dorf.«
»Wissen wir. Ich bin auch in Frankfurt aufgewachsen. Das allein kann aber nicht der Grund dafür sein, dass wir hier sämtliche Vorschriften und Verfahrensweisen ignorieren.«
Wieder zögerte Wertheim. Dann schien er sich ein Herz zu fassen. »Wir waren zusammen in der Schule.«
»Wer?«, hakte Grotewohl nach.
»Frau Mertens und ich.«
»Na und?«
»Wir hatten da mal was … miteinander. Ihr versteht das doch. Erster Kuss, erstes Mal anfassen und erstes Mal …«
»Ist gut«, warf Grotewohl ein, »wir haben es verstanden.«
Die drei sahen sich an und schwiegen.
»Kann es sein, dass du denkst, dass das hier eine Nummer zu groß für deine Jungs ist?«, vermutete Köhler schließlich.
»Das bringt es in etwa auf den Punkt«, bekannte Wertheim. »Ich habe einfach nicht genug Leute. Es ist eine Katastrophe. Und die, die ich habe, sind alle unerfahren. Ich will das hier nicht verkacken, versteht ihr?« Er schien ehrlich verzweifelt zu sein.