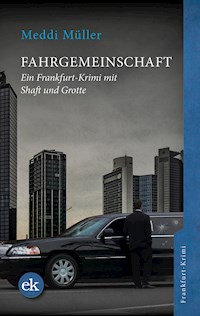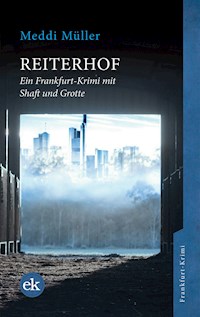7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Charles Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In rund 30 Jahren im Einsatz bei der Feuerwehr und im Rettungsdienst erlebt man vieles mit – von der obligatorischen Katze im Baum bis zu Großbränden und dem tagtäglichen Umgang mit dem Tod. Nicht alles ist spektakulär, vieles ist Routine, aber zu berichten gibt es so einiges. In diesem Buch erzählt Meddi Müller authentisch und ungeschönt, was ein Mensch alles in seinem Berufsleben ertragen kann. In den letzten Jahren häufen sich die Angriffe auf Einsatzkräfte, und Beschimpfungen sind an der Tagesordnung. Der Feuerwehr und dem Rettungsdienst wird das Arbeiten oft unnötig schwer gemacht. Immer wenn Sie denken, Sie haben alles gesehen, kommt jemand und setzt die Kirche obendrauf. Schlimmer geht immer. Doch auch Hilflosigkeit, Naivität, gesellschaftliche Ignoranz und das Elend der Opfer des Systems sind Dinge, mit denen man als Profi-Retter klarkommen muss. Dabei bleibt nicht alles in der Uniform stecken, sondern begleitet die Helfenden oft ein Leben lang. Meddi Müller nimmt Sie mit in seinen Arbeitsalltag als Berufsfeuerwehrmann, lässt Sie Einsätze hautnah erleben und räumt mit dem ein oder anderen Mythos aus dem Rettungsdienst auf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 193
Ähnliche
Meddi Müller
»Und ihr denkt, es ist alles in Ordnung?«
Ein Feuerwehrmann berichtet aus dem Einsatz
Meddi Müller
»Und ihr denkt, es ist alles in Ordnung?«
Ein Feuerwehrmann berichtet aus dem Einsatz
Hamburg, Charles Verlag 2023
Originalausgabe
E-Book ISBN 948486-86-0
Dieses Buch ist auch als Print erhältlich und kann über den Handel oder den Verlag bezogen werden.
ISBN: 978-3-948486-84-6
Lektorat: Bianca Weirauch, Weida
Korrektorat: Joachim Schwend, Leipzig
Umschlaggestaltung: © Guter Punkt, München
Umschlagabbildungen: Foto: © Motivjägerin
Satz: Julia Walch, Bad Soden
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek :
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie ; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http ://dnb.d-nb.de abrufbar.
Der Charles Verlag ist ein Imprint der Bedey & Thoms Media GmbH,
Hermannstal 119k, 22119 Hamburg
© Charles Verlag, Hamburg 2023
Alle Rechte vorbehalten.
http ://www.charlesverlag.de
Hallo erst mal,
mein Name ist Meddi Müller und ich bin von Beruf Feuerwehrmann. Ja, so richtig mit Tatütata und allem Drum und Dran.
In diesem Beruf erlebe ich sehr viel. Gutes wie Schlechtes, Schlimmes ebenso wie Erstaunliches. Der Tod fährt genauso mit wie das Leben. Manchmal bin ich verstört und manchmal glücklich.
Sie werden sich am Ende der Lektüre dieses Buches fragen, wie ich so was auf Dauer aushalten kann. Dazu kann ich folgende Erklärung anbieten:
Es gibt die Theorie, dass jeder, der im Rettungsdienst oder bei der Feuerwehr arbeitet, ein Aquarium ist. Jedes Aquarium hat eine individuelle Größe und einen individuellen Füllstand des Wassers. Jeder Einsatz ist mit einem Stein zu vergleichen und wird in dieses Aquarium hineingeworfen. Je belastender der Einsatz, desto größer ist der Stein. Wenn man Glück hat, ist das Aquarium groß genug und der Füllstand bleibt unter dem Rand. Alles ist gut und man geht einigermaßen ohne psychische Schäden in den Ruhestand. Aber bei manchen von uns läuft das Wasser über.
Es gibt zum Glück Möglichkeiten, Steine wieder aus dem Aquarium rauszuholen und den Füllstand damit zu senken. Das geht recht gut, indem ich über die Erlebnisse rede oder sie eben aufschreibe. Und da ich seit vielen Jahren auch Schriftsteller bin, wähle ich nun diese Option mit diesem Buch. Ein wesentlicher Bestandteil des »Überlebens« ist die Familie. Ohne eine verständnisvolle Partnerin wäre ich schon längst erledigt. Sie ist es, die mich den ganzen Kram ertragen lässt. Ich erzähle ihr aber auch nicht alles.
Tatsächlich werde ich sehr häufig darum gebeten, meine Erlebnisse aus meinem Leben als Feuerwehrmann und Notfallsanitäter aufzuschreiben. Ich habe mich aus verschiedenen Gründen bisher immer dagegen gewehrt. Aber jetzt, im gesetzten Alter, bin ich so weit, mich darauf einzulassen. Außerdem ist es vielleicht ganz heilsam, mal den ganzen Mist, der sich in meinen Kopf gebrannt hat, aufzuschreiben und endlich zu verarbeiten. Zur besseren Verständlichkeit habe ich versucht, Themenblöcke (Drogennotfälle, psychologische Notfälle, chirurgische Notfälle, völlig verrückte Notfälle und so weiter) zu bilden und nicht in chronologischer Reihenfolge vorzugehen. Außerdem verzichte ich an manchen Stellen aus Gründen der besseren Lesbarkeit auf das Gendern. Ich bitte das zu akzeptieren, mir liegt es fern, jemanden auszugrenzen oder zu verletzen.
Niemand kann genau sagen, wie viele Einsätze ich in meiner Karriere gefahren bin. Irgendwann habe ich aufgehört zu zählen. Ich kann es nur schätzen. Ich bin seit 1989 (mit einer Unterbrechung von 1991 bis 1995) im Rettungsdienst tätig. In einer Stadt wie Frankfurt am Main kommt da einiges zusammen. Ich schätze, zum heutigen Zeitpunkt werde ich irgendwas zwischen zehn- und fünfzehntausend Einsätze gefahren sein. Niemand weiß das so genau.
Mit den Toten ist es genauso.
Ich vergesse nie die erste Leiche. Genauso wenig vergesse ich den ersten Einsatz. Fast alle anderen sind nur ein Rauschen. Jedoch gibt es ab und zu Einsätze, die bleiben nicht in den Klamotten stecken. Und um diese geht es hier in diesem Buch.
Aber seien Sie gewarnt, nicht alles ist lustig. Vieles ist tragisch oder dramatisch, anderes wird Kopfschütteln verursachen und unfassbar sein. Und manches werden Sie mir nicht glauben. Aber ich versichere Ihnen, es ist alles genau so passiert, wie ich es auf den nachfolgenden Seiten beschreibe. Da ist nichts geschönt und nichts inhaltlich oder für die Geschichte dramaturgisch verändert. Dieses Buch ist eine Dokumentation des ganz normalen Wahnsinns.
Grundsätzliches
Immer wenn man denkt, man hat alles gesehen, kommt jemand um die Ecke und setzt die Kirsche obendrauf. Das ist ein Grundsatz, den man, wenn man im Rettungsdienst arbeitet, wissen sollte. Auch wenn ich viel gesehen habe in meiner beruflichen Laufbahn, habe ich doch nie alles gesehen. Darüber hinaus gibt es keine Vorstellung, die absurd genug ist, um sie nicht zu erleben. Als Normalsterblicher ist es schwer zu glauben, was tatsächlich in einer Stadt wie der unseren tagtäglich passiert. Der »normale« Mensch hat mit sich zu tun und sieht allenthalben im Fernsehen schreckliche Dinge. Aber wir auf der Straße sind dabei, wir sind die aus dem Fernsehen. Und vieles kommt ja gar nicht erst auf die Mattscheibe, weil es hinter verschlossenen Türen passiert. Doch das ist die brutale und ungeschönte Wahrheit.
Warum gehen Menschen in den Rettungsdienst?
Ich könnte Ihnen jetzt was vorlügen von wegen »Hilfe am Menschen« und »Ich will anderen helfen, die sich nicht selbst helfen können« oder auch »Ich will der Gesellschaft etwas zurückgeben«. Alles dummes Geschwätz. Sicher gibt es Ausnahmen, die wirklich aus den oben genannten Gründen in den Rettungsdienst einsteigen. Die werden aber ganz schnell von der Realität eingeholt und am Ende sind die genauso stumpf wie alle anderen. Die meisten allerdings rutschen da so rein. Bei der Feuerwehr ist es sehr oft so, dass viele einfach ihr Hobby zum Beruf machen. Über neunzig Prozent der Kollegen, die bei der Berufsfeuerwehr arbeiten, engagieren sich in ihren Wohnorten auch bei der Freiwilligen Feuerwehr. Sie gehen dann zur Berufsfeuerwehr und dadurch kommen sie automatisch in den Rettungsdienst. Bei den Hilfsorganisationen wie zum Beispiel Rotes Kreuz, Johanniter Hilfsdienst oder ASB ist es so, dass viele zuvor Zivildienst oder ein freiwilliges soziales Jahr gemacht haben. Oft sind es auch MedizinstudentInnen, die sich so ihr Studium finanzieren.
Ich war auch mal bei der Freiwilligen Feuerwehr. Aber nicht so lange. Ganz ehrlich: Ich hatte da nicht so viel Spaß. Um das zu erklären, muss ich weiter ausholen. Zu der Zeit, damals in den 1980er-Jahren, war es so, dass man entweder achtzehn Monate zur Bundeswehr oder ersatzweise vierundzwanzig Monate Zivildienst ableisten musste. Alternativ konnte man sich für zehn Jahre dazu verpflichten, im Katastrophenschutz ehrenamtlich tätig zu sein. Dazu gehören das THW und die Feuerwehren. Ich fand zehn Jahre zu lange und wollte nicht zur Bundeswehr, also habe ich mich dafür entschieden, den Zivildienst zu machen, anstatt mich für zehn Jahre an die Freiwillige Feuerwehr zu binden. Das wiederum gefiel meinem damaligen Wehrführer gar nicht und ab diesem Zeitpunkt hat er mich, ich will nicht sagen, gemobbt … aber es grenzte daran. Da kam die ein oder andere blöde Bemerkung zu viel und dann habe ich mir einen anderen Zirkus gesucht und der Wehrführer sich einen anderen Clown.
Soll ja Spaß machen.
Damit war für mich das Thema Freiwillige Feuerwehr durch. Ich muss allerdings erwähnen, dass mein Vater ebenfalls bei der Berufsfeuerwehr Frankfurt arbeitete. Er kannte dadurch den Wachvorsteher des ASB in Frankfurt und hat mir dort eine Stelle als Zivi vermittelt.
Das war 1989.
Und da bekam ich zum ersten Mal Kontakt zum Rettungsdienst. Ich bin damals mit dem Rettungswagen (künftig benutze ich hierfür die Abkürzung RTW) durch die Stadt gefahren und habe meine ersten Notfalleinsätze erlebt.
Wenn ich meine damalige Ausbildung mit der, die heute auf einem RTW verlangt wird, vergleiche, läuft es mir eiskalt den Rücken runter.
Ich konnte medizinisch so gut wie nichts.
Das ist ein Fakt.
Die Ausbildung war ein Zwei-Wochen-Kurs in einer ASB-Schule im Norden der Republik. Und ich lüge nicht, wenn ich sage, dass es Zivis gab, die zu diesem Unterricht mit Kopfkissen erschienen sind, die sie auf den Tisch gelegt und darauf geschlafen haben … während des Unterrichts. Den Kurs hat jeder bestanden, weil er schlichtweg zu einfach war, als dass man durchfallen hätte können. Es schloss sich ein dreiwöchiges Praktikum in einer Notaufnahme an und fertig. Das Ergebnis nannte sich dann Rettungshelfer.
Ein weiteres Problem war, dass es in unserer Dienststelle die vorherrschende Meinung gab, dass alle Zivis so schlecht (oder halbstark) Auto fahren, dass sie diese zu oft zerstören. Deshalb wurde der Zivi auf die Beifahrerseite gesetzt. Aus heutiger Sicht völlig verständlich, denn wir sind wirklich schlecht bis rüpelhaft gefahren.
Wirtschaftlich gesehen sicher sinnvoll.
Allerdings ist es wichtig zu wissen, dass der Beifahrer auf dem RTW derjenige ist, der hinten die Patienten auf der Pritsche betreut. Und wenn der mangels ordentlicher Ausbildung nicht weiß, was der Patient hat und was er dagegen tun kann, wird es unter Umständen blöd; doch dazu später mehr.
Ich habe bis 2001 Zivildienst gemacht und bin dann wieder zurück zu meinem alten Arbeitgeber. Und ich übertreibe nicht, wenn ich sage, ich war danach ein anderer Mensch. Ich gebe zu, dass ich, als ich zum Fachangestellten für Arbeitsförderung im Arbeitsamt Frankfurt ausgebildet wurde, nicht durch Ehrgeiz oder herausragendes Engagement glänzte. Bis dahin ist mir alles in den Schoß gefallen. Die Schule lief nebenbei, ohne große Anstrengung. Die Ausbildung habe ich mit angezogener Handbremse erledigt. Danach erteilte ich Arbeitserlaubnisse für skandinavische, österreichische und schweizerische StaatsbürgerInnen.
Und, wie soll ich es sagen?
Auch da gab ich mir nicht die geringste Mühe und war doch eher faul bis lustlos. Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass die kurze Zeit im Rettungsdienst mein Leben auf den Kopf gestellt hat und ich aus dem Zivildienst als neuer Mensch gekommen bin. Ich bin bis heute dankbar dafür. Wenn ich entscheiden dürfte, würde das jede/r Jugendliche in Deutschland nach der Schule machen. Aber ich entscheide ja nicht.
Die Einsätze, die ich dort gefahren bin, waren für mich derart lebensverändernd, dass es eine Zeitrechnung in meinem Leben gibt, die in vor und nach meinem Zivildienst eingeteilt werden kann.
Davor war ich ein verwöhntes, arrogantes, überhebliches, wohlbehütetes Hätschelkind, das sich niemals auch nur eine Sorge hatte machen müssen. Alles, aber auch wirklich alles, war einfach.
Ich lebte … fertig. Scheiß auf die anderen.
Ich kann den Kerl, der ich damals war, verstehen. Warum sich anstrengen, wenn es auch ohne geht? Spaß haben und alles mit Leichtigkeit parieren.
Doch das änderte sich schlagartig mit meinem ersten Einsatz.
Das erste Mal
Wie erwähnt, war mein Vater damals bei der Berufsfeuerwehr. Genauer gesagt, war er Leitstellendisponent. Das sind die Typen, die Sie ans Telefon bekommen, wenn Sie die 112 wählen. So einer war mein Vater über ein Vierteljahrhundert lang … und das bin ich heute, im Herbst meiner Karriere, wenn auch aus gesundheitlichen Gründen. Aber hierzu später mehr.
Zurück zum ersten Einsatz. Zufällig hatte mein Vater genau an dem Tag, an dem ich zum ersten Mal auf dem RTW mitgefahren bin, Dienst auf der Leitstelle und schickte mich zu meinem ersten Einsatz. Sein Wunsch, ganz der liebevolle Vater: »Dein erster Einsatz soll eine vollgeschissene Oma sein.« (Ich bitte die Wortwahl zu entschuldigen, aber das ist ein Zitat.)
Und hier sind wir bei der Theorie der selbsterfüllenden Prophezeiung, genau so war es. Ungelogen.
Aber ich habe noch einen draufgesetzt, denn die vollgeschissene Oma war auch noch sturzbetrunken. Sie lag vor einer Eckkneipe und konnte nicht mehr alleine aufstehen, weil der übermäßige Alkoholgenuss ihren Bewegungsapparat versagen ließ. Wir stiegen aus, hoben die alte Dame an und was fiel ihr aus dem Rock? Exakt …
Es war nicht zu fassen, dass mein Vater mich dahin geschickt hatte. Die nette Frau beschimpfte uns ausgiebig und bat uns wenig höflich, wieder wegzufahren, da sie ja schließlich alleine klarkäme.
Bis zu diesem Zeitpunkt habe ich die Geschichten aus dem Rettungsdienst für Seemannsgarn gehalten. Schon jetzt schwante mir Schlimmes.
Und so kam es auch.
In den Jahren danach fuhr ich viel RTW und später dann Notarztwagen (NAW), der später zum Notarzteinsatzfahrzeug (NEF) wurde. Ich fuhr zwischendrin auch den Intensivverlegungsnotarztwagen, kurz: INVER, heute ITW genannt. Ein Fahrzeug, das am besten als eine fahrende Intensivstation erklärt ist. Das war die anstrengendste Zeit, denn das Auto war ununterbrochen unterwegs. Ich bin quasi alles gefahren, was es im Rettungsdienst gibt, außer den Rettungs-Hubschrauber, der mein eigentliches Ziel war und in dem ich sehr gerne mitgeflogen wäre, was mir aber leider aus verschiedenen Gründen verwehrt wurde. Ein kleiner Trost bleibt mir, denn heute darf ich ihn wenigstens alarmieren … was aber keine wirkliche Befriedigung in mir auslöst.
Meine Ausbildung wurde besser. Ich machte meinen Rettungssanitäter, gefolgt vom Rettungsassistenten bis hin zum Lehrrettungsassistenten. Zuletzt machte ich eine Überleitungsprüfung zum Notfallsanitäter und eine Ausbildung zum Praxisanleiter. Man könnte jetzt meinen, ich weiß unheimlich viel über den menschlichen Körper und seine Krankheiten. Ich würde es eher so formulieren, dass ich mehr als der Laie weiß, aber bei Weitem nicht genug und schon gar nicht alles über den menschlichen Körper. Im Rettungsdienst gibt es eine andere Währung: Erfahrung.
Man lernt fast alles in der Praxis, denn jeder Einsatz ist anders und hat sein Eigenleben. Man fängt klein an, ist aufgeregt, hat Zweifel an der Richtigkeit der Entscheidungen und fühlt sich manchmal dumm, wenn man vermeidbare Fehler gemacht hat. Aber man ist auch ständig in Begleitung erfahrener Kollegen. Der eine ist ein guter Ausbilder, der andere nicht. Aber man lernt in jedem Stadium der Karriere. Es ist ein ständiger Prozess, der ununterbrochen stattfindet. Man wächst in die Sache hinein und ehe man es sich versieht, kommt irgendwann der Punkt, an dem man selbst der Ausbilder ist. In etwa parallel dazu stumpft man ab und geht auch nach dem blutigsten Einsatz in aller Seelenruhe etwas frühstücken. Aber wie bereits gesagt … nicht alles bleibt in den Klamotten stecken.
Ein Phänomen im Rettungsdienst ist der stete und temporeiche Wandel. Ist heute noch die eine Methode das absolute Ding, kann es morgen schon ein völliges Tabu sein. In rasender Geschwindigkeit werden Studien zu Standards, Methoden neu erfunden, Abläufe optimiert und Geräte weiterentwickelt. War am Anfang meiner Karriere das Legen eines intravenösen Zugangs eine Handlung, die unter allergrößter Geheimhaltung gemacht wurde und direkt aus dem Tal der verbotenen Früchte kam, bekommt man heute einen Anpfiff vom übernehmenden Arzt, wenn man es nicht getan hat. Die Medikamentengabe war damals absolutes Tabu für die RTW-Besatzung und wurde ebenso hart bestraft wie das Zuganglegen, wenn nicht sogar noch härter. Heute gibt es um die 20 Medikamente, die man beherrschen muss. Und das mit Wirkung, Nebenwirkung, Wechselwirkung, Ausnahmen und Dosierung bei Mann, Frau und Kind, Vollmond, Vorweihnachtszeit und Sonnenfinsternis. Hinzu kommen 28 verschiedene Algorithmen verschiedener Notfallbilder mit unzähligen Querverweisen zu den anderen 27 Algorithmen, die man (laut Ausbildern) auswendig lernen muss, was meiner Meinung nach völlig unmöglich ist. Für so was gibt es heutzutage Apps.
Naja, so ist der Wandel. Die Qualität der Ausbildung ist heutzutage wirklich sehr gut und anspruchsvoll. Die Durchfallquote beim Notfallsanitäter ist entsprechend hoch. Ich will um Gottes willen nicht diese Qualität missen. Aber meiner Meinung nach führt das übertriebene Hochzüchten dazu, dass wir von dem Erlernten in der Praxis nur einen Bruchteil anwenden können. Ein Beispiel:
In meiner mündlichen Prüfung fragte mich ein Arzt, der mich meine ganze Karriere über in den Prüfungen gequält hatte, ob ich ihm den Unterschied zwischen COPD und Asthma erklären könne. »Pah«, dachte ich, »das weiß ich …« Und legte los. Ich kam keine zwei Sätze weit, da unterbrach er mich auch schon und sagte: »Ja, ja … ich will wissen, wie man das behandelt.«
Immer noch kein Problem für mich, denn das war mein tägliches Brot. Ich erklärte ihm die einzelnen Behandlungsschritte, als er mir schon wieder ins Wort fiel.
»Schickschnack … ich will wissen, welches Medikament Sie nehmen würden, um den Patienten zu behandeln.«
Immer noch kein Problem, denn da gab es nur zwei: Atrovent und Salbutamol. Ich wollte ihm gerade die Dosierung und Anwendungsweise erklären, als er mir abermals das Wort entzog. Und jetzt wurde es richtig blöd und gelangte, wie ich finde, an die Grenze zur Sinnlosigkeit. Er fragte mich doch tatsächlich, wie diese Medikamente wirkten und an welchen Rezeptoren diese im Körper andocken.
Ganz ehrlich: Das ist mir im Rettungsdienst scheißegal!!! Das muss ich nicht wissen. Das ist völlige Verschwendung von Ressourcen. Ich muss wissen, wie es dosiert wird, für was es da ist und mit welchen Neben- und/oder Wechselwirkungen ich zu rechnen habe, alles richtig und wichtig. Aber bei aller Liebe … die betroffenen Rezeptoren sind mir so egal, die ignoriere ich noch nicht einmal. Sie haben keine Relevanz im Rettungsdienst. In der Klinik vielleicht, aber auf keinen Fall auf der Straße.
Ich kann den Typ nicht leiden.
Ein Kollege hat es mal treffend formuliert: »Wir werden für 2 Prozent der Notfälle gedrillt, um die anderen 98 Prozent ins Krankenhaus zu fahren.« Ja, der absolute Löwenanteil der Einsätze ist sogenannte »Pillepalle« für uns, aber die übrigen 2 Prozent haben es in sich und dafür muss man einfach ausgebildet sein.
Leider führt die Ausbildung auch dazu, dass manche KollegInnen nicht mehr den Patienten, sondern den Algorithmus und ihre sauteuren Medizingeräte behandeln. Das erkennt man daran, dass an manchen Einsatzstellen das gesamte Team um die Maschine versammelt steht und die Zahlen und Striche darauf beobachtet. Hier greife ich dann immer ein und weise darauf hin, dass der Patient an einer anderen Stelle ist. Klar muss man die Vitalparameter erheben und deuten, aber nicht länger als notwendig.
Grundsätzlich gilt im Rettungsdienst, dass du nicht der Klassenbeste gewesen sein musst, sondern gesunden Menschenverstand zeigen und dem Patienten einfach mal ins Gesicht schauen solltest, denn da steht alles geschrieben. Schmerz, Gemütszustand … ist der Patient blass, blau, grün, rot oder gar gelb? Spielt er mir nur was vor oder ist es ernst? Und ganz wichtig: Ist Eile geboten? Denn wenn man, wie ich, mehrere Menschen direkt vor der eigenen Nase hat sterben sehen, kennt man die Anzeichen und vergisst sie nie mehr.
Genug Gerede. Legen wir los!
Ein ganz normaler Tag bei der Feuerwehr
Wir haben hier bei uns 24 Stunden Dienst. Das sogenannte Bremer-Modell. Können Sie googeln, falls es Sie interessiert. Schichtbeginn ist um 7.00 Uhr. Dann heißt es antreten. Die gesamte Dienstgruppe versammelt sich an einem geeigneten Ort und der Dienstplan wird verlesen. Das war schon immer so und wird so bleiben, bis ich in Pension gehe, und das ist auch gut so. Im Anschluss werden Aufgaben verteilt, Dinge besprochen, Geburtstagsständchen gesungen oder aus den dienstlichen Nachrichten vorgelesen. Ist das alles erledigt, wird die Truppe entlassen zur Fahrzeugübernahme. Dabei werden alle Gerätschaften auf dem Auto und die persönliche Schutzausrüstung, wie zum Beispiel das Atemschutzgerät, auf Funktionsfähigkeit überprüft.