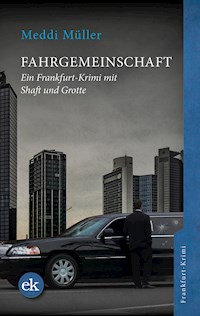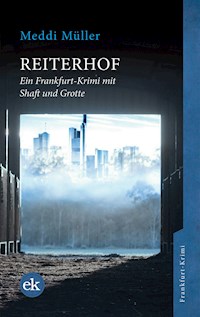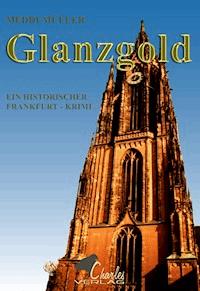
6,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Charles Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Frankfurt, Januar 1909. Der Türmer des Frankfurter Kaiserdoms erwartet seine Schwester Charlotte aus Hannover. Schon am nächsten Tag tritt sie ihre neue Stelle an und lernt bald darauf einen charmanten Mann kennen. Doch der Türmer ist skeptisch. Ein belauschtes Gespräch und ein Artikel in der Zeitung alarmieren ihn schließlich vollends: Plant Charlottes Kavalier etwa ein Attentat auf den Kaiser? Eine packende Kriminalgeschichte vor den Kulissen des historischen Frankfurt!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Meddi Müller
Glanzgold
Der dritte Fall des Türmers
Ein historischer
Frankfurt Krimi
Impressum:
Charles-Verlag Frankfurt, Alle Rechte vorbehalten, eine Veröffentlichung, auch in Auszügen, ist nur mit Genehmigung des Charles-Verlags gestattet. www.meddimueller.com
Titelbild: M. Naumann Verlag
Umschlaggestaltung: Marcel Dax
ISBN Print 978-3940168993
Bibliographische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliographische Daten sind im Internet unter http://dnb.dbb.de abrufbar.
Der Autor
Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
Ich bin immer bemüht, bei meinen Büchern die mir höchst mögliche schriftstellerische Qualität zu liefern. Sie haben ein Recht darauf, Sie haben ja schließlich dafür bezahlt. Dennoch muss ich Sie warnen: Ich bin weder ein zweiter Hemingway, noch ein neuer Stephen King oder eine Reinkarnation von Kafka. Ich bin Meddi Müller, ein Feuerwehrmann, der gerne Geschichten erzählt. Einfach, klar, hoffentlich unterhaltsam, aber immer mit Leidenschaft.
Ich habe weder Literatur, noch Geschichte, Germanistik, noch sonst irgendetwas studiert. Im Grunde bin ich dumm. Auch habe ich nie eine Schreibwerkstatt besucht (mal abgesehen davon, dass ich von diesen Gleichschaltungskursen nichts halte). Alles was ich will, ist, Sie lediglich für einige Zeit in eine andere Welt mitzunehmen und Ihnen eine spannende, fiktive Geschichte zu erzählen. Ich bemühe mich, möglichst einfach und verständlich zu schreiben, denn das ist es, was ich auch von anderen Autoren erwarte. Ich denke, man muss nicht mit Fremdwörtern glänzen, die man Nachschlagen muss, nur um als besonders gebildet zu gelten. Man muss auch keine Schachtelsätze bilden, um Ach-So-Toll zu erscheinen. Oder immer neue Metaphern bilden. Ich bin ein einfacher Mann, der Menschen mit seinen Geschichten unterhalten will und sich wie ein kleines Kind an Weihnachten freut, wenn diese Geschichten jemandem gefallen.
Sollte ich damit Ihren Ansprüchen nicht genügen, so hoffe ich, dass Sie den Kassenzettel aufgehoben haben und Sie das Buch umtauschen können, bevor Sie sich auf Amazon als klugscheißender Literaturpapst aufspielen.
Ankunft
Klara, wo hast du den Brief hin?«, rief Heinrich Niemann durch die enge Wohnung in der Spitze des Frankfurter Doms.
»Wieso ich?«, fragte seine Frau abwehrend.
»Weil du ihn zuletzt gehabt hast.« Heinrich war sich sicher, dass seine Frau den Brief verlegt haben musste. Der Türmer im Dienste der Frankfurter Berufsfeuerwehr fungierte seit nunmehr sechs Jahren als menschlicher Feuermelder und Fremdenführer in beinahe siebzig Metern Höhe. Er konnte mit Fug und Recht behaupten, jeden Winkel im Dom zu kennen. Also war es für ihn unmöglich, dass er etwas verlieren konnte.
»Ich habe das Gleis vergessen«, fuhr er unbeeindruckt fort.
»Ich habe den Brief nicht weg. Er liegt da, wo du ihn hingelegt hast.«
Heinrich Niemann hatte Mühe sich zu beherrschen. Er schluckte eine boshafte Erwiderung herunter und suchte weiter nach dem Brief seiner Schwester, in dem sie ihm ihre Ankunft in Frankfurt mitgeteilt hatte. Das war jetzt zwei Wochen her. Seitdem hatte er den Brief nicht mehr gelesen. Warum auch? Er hatte sich ja alles Nötige gemerkt. Seine Schwester sollte am zwölften Januar 1909 um Punkt zehn Uhr morgens mit dem Expresszug aus Hannover am Frankfurter Hauptbahnhof ankommen. Das alles wusste er ganz genau. Doch konnte er sich momentan nicht an das verdammte Gleis erinnern. Wenn seine Frau nur nicht immer so unordentlich gewesen wäre.
Ein Blick auf seine Taschenuhr verriet ihm, dass es bereits eine viertel Stunde nach neun Uhr war und heute war der zwölfte Januar. Demzufolge wurde es langsam Zeit.
»Wo ist dieser elende Brief?«, rief er erneut und knallte mit beiden Händen auf die Ablage des Küchenschrankes.
»Heinrich!«, schreckte seine Frau auf. »Muss das sein?«
»Hättest du den Brief nicht verschlampt, wäre ich jetzt nicht in Eile.«
»Ich habe deinen Brief nicht verschlampt. Ich hatte ihn nur einmal kurz in der Hand und habe ihn dir sofort wieder zurückgegeben.«
»Ja, ja«, machte der Türmer. »Hilf mir wenigstens beim Suchen.«
»Denk doch erstmal nach, Heini«, riet Klara. »Wo könntest du ihn denn hingetan haben.«
»Wieso ich?«
Jetzt hatte Klara Mühe sich zu beherrschen. Sie hätte ihn anbrüllen können, dass sie ihm schon hunderte Male gesagt hatte, dass sie den Brief nicht verlegt hatte. Stattdessen sagte sie: »Hast du schon in deiner Uniformjacke nachgesehen? Vielleicht hast du ihn ja dort hinein, damit du ihn schnell wiederfindest.«
»So blöd kann doch …« Der Türmer hatte in die Innentasche seiner Uniformjacke, die er am Laibe trug, gegriffen und hielt jetzt inne. Dann zog er ein Blatt Papier hervor. Er faltete es auf. Sein Gesichtsausdruck sprach Bände.
Klara verschränkte die Arme vor der Brust, legte den Kopf schief und beantwortete den unvollendeten Satz ihres Mannes: »Mein Mann kann anscheinend doch so blöd sein.«
»Den habe ich da nicht hin!«, war alles, was dem Türmer dazu einfiel.
»Nein, natürlich waren es die Domgeister.«
»Ich muss jetzt aber wirklich los.«
Der Türmer duckte sich an seiner Frau vorbei, damit diese seinen schamroten Kopf nicht sah, und hastete aus der Wohnung. Als er auf die Aussichtsplattform des Domes trat, wäre er zu allem Überfluss fast auf dem eisbedeckten Boden ausgerutscht. Er konnte sich gerade noch fangen, fluchte leise vor sich hin und eilte die steinerne Wendeltreppe des südlichen Domturmes hinunter.
Wenig später hatte er den Fuß der Treppe erreicht. Er öffnete die schwere Holztür und trat hindurch. Plötzlich stolperte er schon wieder.
»Was soll denn das?«, rief er. Heinrich konnte gerade noch verhindern, dass er die Stufen, die zum Eingang des Turmes führten, herunterfiel. Er klammerte sich an das Geländer, wobei er seinen Körper gefährlich verbog. Als er sich aufrappelte, sah er etwas davonrennen. Das Etwas bellte laut und kratzte nun an der Tür zu Meinhardts Pförtnerbude. Heinrich wollte nicht so recht glauben, was er da sah. Er ordnete seine Uniform. Dann schüttelte er den Kopf.
»Verflixter Streuner«, rief er dem Hund hinterher.
Er wollte gerade weitergehen, als sich die Tür der Pförtnerbude öffnete und Meinhardt auf der Schwelle erschien.
»Goliath, hat der beese Mann dir wehgetan?«
Der Pförtner hob das bisschen Hund auf und wiegte es wie ein Baby in seiner Armbeuge. Der Hund wedelte derweil mit dem Schwanz und leckte Meinhardt über das Gesicht. Heinrich beobachtete die Situation mit einer Mischung aus Verwunderung und Ekel.
»Meinst du mit dem bösen Mann etwa mich?«, wollte er wissen.
»Nadierlich, oder siehste hier noch en annern?«
Heinrich lehnte eine Diskussion darüber ab. Viel mehr interessierte ihn etwas anderes.
»Seit wann hast du diesen …«, er suchte nach einer Bezeichnung für das kleine Wesen, fand keine bessere und benutzte widerwillig den Oberbegriff: »Hund?«
»Seit gestern. Isch habben von maaner Schwester zur Fleesche bekomme.«
»Weiß Herr Lindemann Bescheid?«
»Was geht denn dess de Parrer a?«
»Vielleicht, weil er hier das Sagen hat?«
»Der soll emal komme. Des arme Ding muss ja schließlisch aach bedreut wern.«
»Wieso dann nicht von deiner Frau bei euch zu Hause?«
»Weil isch ihn zur Fleesche hab und net mei Fraa!«
»Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist.«
»Mir doch Worscht, was du denke tust.«
Heinrich schaute auf seine Uhr und stellte fest, dass es nun wirklich an der Zeit war, seine Schwester am Bahnhof abzuholen.
»Ich will dir nur unnötigen Ärger ersparen, Meinhardt. Ich glaube kaum, dass Pfarrer Lindemann begeistert sein wird von …« Der Türmer deutete auf den kleinen Hund, der immer noch freudig auf sein neues Herrchen sabberte.
»Goliath, iss sein Name.«
»Das ist ja wohl ein Witz, oder?«, murmelte der Türmer und ließ den Pförtner zurück.
Die Geräuschkulisse im Bahnhof war enorm. Das Stimmengewirr der vielen Fahrgäste und Besucher mischte sich mit den Zischlauten der abblasenden Dampfloks und dem Quietschen der Bremsen. Züge kamen an und spuckten die Menschenmassen auf die Bahnsteige. Andere fuhren davon und ließen so Manchen traurig zurück. Die Freude der Ankunft und der Schmerz des Abschiedes waren nirgends näher beisammen als an einem Bahnhof. Heinrich genoss die Atmosphäre. Mit großen Augen schaute er sich um, als wäre er zum ersten Mal hier.
Seine Schwester würde auf Gleis 8 ankommen. Ein Schaffner verkündete, dass der Zug aus Hannover in Kürze eintreffen würde. Man solle vorsichtig sein an der Bahnsteigkante. Kurz darauf rollte der angekündigte Schnellzug langsam in den Bahnhof ein. Heinrichs Aufregung wuchs. Er hatte seine Schwester seit beinahe zwei Jahren nicht mehr gesehen. Damals war sie achtzehn Jahre alt gewesen. Er wusste, dass sich junge Mädchen schnell entwickelten und hoffte, sie wiedererkennen zu können. Der Zug stoppte mit einem Ruck, und die Türen sprangen auf. Eilig drängte die Menschenmasse auf den Bahnsteig. Manch einer, der nur zum Umsteigen hier war, rannte den Bahnsteig entlang, um seinen Anschlusszug nicht zu verpassen. Andere, die hier in Frankfurt ihr Ziel erreicht hatten, waren gelassen und wirkten zum Teil sogar gelangweilt.
Heinrich suchte die Menge nach einem bekannten Gesicht ab. Er hatte sich bewusst an das Ende des Bahnsteigs gestellt, damit er Charlotte auf keinen Fall verpassen würde. Er stand am Querbahnsteig und reckte den Hals, als er seinen Namen hörte.
»Heinrich?«, rief die Stimme.
Der Türmer drehte sich in die Richtung, aus der die Stimme gekommen war. Dann erneut: »Heinrich, hier bin ich!«
Jetzt sah er sie. Sie stand keine zehn Meter von ihm entfernt auf dem Bahnsteig. Sie sah hübsch aus. Beinahe zu hübsch, wie Heinrich feststellte. Sie trug eine weiße Bluse mit weiten Ärmeln und einen dunkelgrünen Rock, der in Falten locker um ihre Beine schwang. Der Rock ging ihr bis kurz über die Knöchel, die von kleinen Schnürstiefeln mit hohen Absätzen verdeckt wurden. Auf ihrem Kopf saß ein kleiner Hut, auf dem ein Netz drapiert war. Ihre langen Haare waren geflochten und seitlich hochgesteckt. Sie sah bezaubernd aus. Gar nicht mehr das kleine Mädchen, das Heinrich noch vor zwei Jahren in Hannover besucht hatte. Charlotte war die Jüngste von acht Geschwistern. Heinrich der Älteste. Er hatte schon immer ein besonders wachsames Auge auf das Nesthäkchen der Familie gehabt. Sie war eindeutig seine Lieblingsschwester. Wahrscheinlich lag es daran, dass sie die Einzige war, die ihn regelmäßig besuchte. Um so mehr freute er sich darüber, dass sie nun ganz nach Frankfurt ziehen würde, da sie eine Anstellung bei der Deutschen Gold- und Silber-Scheideanstalt vormals Roessler bekommen hatte. Man nannte die Firma im Frankfurter Volksmund auch kurz die Münz oder die Scheideanstalt. Heinrich war stolz auf seine Schwester. Auch wenn sie nur durch die Bemühungen seines Freundes, Kommissar Schuhmann, an die Stelle gekommen war. Doch die Scheideanstalt hätte sie bestimmt nicht eingestellt, wenn sie dort nicht von ihren Fähigkeiten überzeugt gewesen wären. Ihre Referenzen waren vorzüglich. In Hannover hatte sie bei einer großen namhaften Firma erste Erfahrungen sammeln dürfen. Wenn auch nicht in der Position als Schreibkraft der Geschäftsleitung, als die sie in Frankfurt arbeiten sollte. Ihre Zeugnisse waren allesamt hervorragend. Da sie in Hannover aber niemanden mehr hatte, kam sie nun zu ihrem Lieblingsbruder nach Frankfurt. Die anderen Geschwister hatten sich in alle Winde verstreut. Einer war sogar nach Amerika ausgewandert. Heinrichs und Charlottes Eltern waren beide tot. Einem Mann, der sie hätte ernähren können, war Charlotte leider bisher nicht begegnet. Das behauptete sie jedenfalls. Heinrich war da anderer Meinung.
»Ich glaube ja eher, dass du zu wählerisch bist«, hatte er beim letzten Besuch seiner Schwester gesagt. »Schau dich an, du bist hübsch, gebildet und alt genug. Warum sollte man dich verschmähen?«
Charlotte zeigte sich trotzig. »Weil mir bisher noch nicht der Richtige begegnet ist. Ich will nicht den erstbesten heiraten, der mir über den Weg läuft.«
»Also gibt es Interessenten«, schlussfolgerte der Türmer.
»Ich will nicht darüber sprechen.«
Charlotte hatte daraufhin die Arme vor der Brust verschränkt und das Kinn nach vorne geschoben. Ein sicheres Zeichen, dass damit das Thema für sie beendet war. Heinrich gab es auf. Irgendwann würde sie zur Vernunft kommen, da war er sicher.
»Wie war die Reise?«, rief er gegen den Lärm des Bahnhofs an.
»Lange und holprig.« Charlotte stellte ihre Koffer ab und fasste sich an den Rücken. »In der dritten Klasse ist das Reisen wahrlich kein Vergnügen, lieber Bruder.«
»Wir können uns nicht mehr leisten, das weißt du«, tadelte Heinrich seine vorlaute Schwester.
»Entschuldige, Heinrich.«
Der Türmer lächelte verständnisvoll und griff nach den beiden Koffern. Seine Schwester lächelte zurück und hakte sich bei ihm unter. Gemeinsam schlenderten sie über den Querbahnsteig. Kurz darauf schritten sie durch den Haupteingang auf den Bahnhofsplatz. Charlotte sollte zunächst bei Klaras Mutter in der Hochstraße wohnen. Eigentlich wollte Heinrich seine Schwester zu Fuß dorthin bringen. Doch schon jetzt, als sie nur wenige Meter der Wegstrecke hinter sich gebracht hatten, wurden die Koffer in seinen Händen schwer wie Blei.
»Sag mal, was hast du denn in deinen Koffern?«, schnaubte er. »Steine?«
»Nur das Nötigste. Was eine Frau in meinem Alter halt eben braucht zum Leben.« Sie schaute ihren Bruder an. Dabei entdeckte sie tatsächlich Schweißperlen auf seiner Stirn, obwohl es eisig kalt auf dem zugigen Bahnhofsplatz war. »Ich könnte doch auch einen tragen«, erbot sie sich.
»Ich sage ja nicht, dass ich die Koffer nicht tragen kann.« Dem Türmer war seine offensichtliche Schwäche peinlich. »Aber bis zu Klaras Mutter am Eschenheimer Tor ist es ein geraumes Stück Weg, meine Teure.«
»Wir können sie ja abwechselnd tragen. Oder jeder einen.«
»Kommt nicht infrage«, lehnte der Türmer ab und ging mit großen Schritten voran. Charlotte folgte ihm mit gerunzelter Stirn. Am Ende der Taunusstraße hielt Heinrich eine Droschke an. Charlotte sagte nichts.
Als die Geschwister am Eschenheimer Turm ankamen, schneite es. Die Straßen waren glatt. Vorsichtig überquerten sie die Straße und betraten das Haus an der Ecke zur Neuen Taubenstraße. Klaras Mutter lebte in der Dachwohnung. Heinrich fluchte.
»Was muss die auch unterm Dach wohnen. Die muss ja die Koffer nicht hochschleppen.«
Charlotte lief direkt hinter ihm und schüttelte lächelnd den Kopf. Ihr Bruder hatte sich nicht verändert. Er war schon immer ein liebenswerter Knorrkopf gewesen und würde es bleiben.
Oben angekommen, schwitze Heinrich trotz der Kälte. Er verschnaufte vor der Wohnungstür. Charlotte zwängte sich an ihm vorbei und klopfte an. Kurz darauf öffnete Klaras Mutter.
»Heinrich, geht’s dir gut?«, wollte sie wissen.
»Verfluchte Treppen«, sagte er nur.
»Wir sind gerade mal im dritten Stock«, erstaunte sich seine Schwiegermutter. »Ich dachte, du läufst jeden Tag im Dom auf und ab.«
»Aber da habe ich keine Steine in der Hand.«
Sein Blick fiel erst auf die Koffer und dann auf seine Schwester. Der Vorwurf in seinem Gesicht war nicht zu übersehen.
»Ich habe dir meine Hilfe angeboten, Heinrich«, verteidigte sich Charlotte knapp und wandte sich Klaras Mutter zu. »Guten Tag, Frieda. Gut siehst du aus.«
»Charlotte, mein Engel. Komm doch rein. Ich habe schon den ganzen Morgen auf dich gewartet. Wie war die Reise?«
Frieda packte Heinrichs Schwester am Arm und zog sie in die Wohnung, wo sie im Flur auf die junge Frau einplauderte.
Heinrich blieb düpiert im Treppenhaus zurück.
»Guten Tag, lieber Schwiegersohn«, sprach er mit sich selbst. Er äffte die Stimme seine Schwiegermutter nach: »Kann ich dir die Koffer abnehmen? Möchtest du nicht hereinkommen und eine kleine Erfrischung haben? Du bist ja völlig außer Atem. Armer Junge, du hast die Koffer ganz alleine hier hoch geschleppt, du musst ja völlig fertig sein.« Dann sprach er mit seiner Stimme: »Aber nein, liebste Schwiegermutter, es macht mir gar nichts aus, die tonnenschweren Koffer meiner Schwester drei Stockwerke nach oben zu hieven. Ich bin doch noch jung und bestens in Form. Das macht mir überhaupt nichts aus.«
Er schnappte die Koffer seiner Schwester und wuchtete sie in den Flur der Wohnung. Gerade so weit, dass er die Wohnungstür schließen konnte. Er strafte die Koffer mit einem bösen Blick und trottete ins geräumige Wohnzimmer. Dort fand er die beiden Damen ins Gespräch vertieft. Beide knabberten bereits an frischem Gebäck und hatten die Tassen mit Kaffee gefüllt. Heinrich setzte sich an den Tisch und wurde missachtet.
»Sprich, meine Liebe. Wann fängst du mit der neuen Arbeit an?«, wollte Frieda wissen.
»Schon morgen.«
»Ach schade, ich dachte, wir hätten ein paar Tage für uns. Na ja, dann müssen wohl die Wochenenden dafür herhalten.«
Charlotte lachte freundlich. »Ich habe ja vor, etwas länger in der Stadt zu bleiben. Da wird sich bestimmt eine Gelegenheit für einen Wochenendausflug finden.«
»Erzähl, Kindchen, was genau musst du denn in der Scheideanstalt machen? Doch nicht etwa in der Fabrik arbeiten?«
»Nein, nein. Ich bin eine der Schreibkräfte von Herrn Schneider.«
»Alexander Schneider?«, vergewisserte sich Frieda aufgeregt.
»Meines Wissens, ja.«
»Hast du gehört, Heini? Deine Schwester arbeitet direkt für einen der Direktoren der Scheideanstalt.«
Heinrich hob die Hand und öffnete den Mund, um zu antworten. Doch Frieda drehte sich schon wieder zu Charlotte.
»Ist das aufregend«, rief sie und klatschte in die Hände. »Nimm dir noch von dem Gebäck, Charlotte. Du musst doch hungrig sein von der langen Reise.«
Sie schob den Teller mit den Plätzchen zu Heinrichs Schwester. Charlotte griff zu. »Noch Kaffee, meine Liebe?«, fragte Frieda die neue Mitbewohnerin.
Charlotte wollte und bekam nachgeschenkt. Heinrich hielt ebenfalls seine Tasse hoch, schien aber Luft für die Beiden zu sein. Frieda stellte die Kaffeekanne wieder ab und unterhielt sich weiter aufgeregt mit Charlotte.
Der Türmer verfiel wieder in ein Selbstgespräch: »Möchtest du auch Kaffee, Heini?«, fragte er sich selbst. »Oh, wenn es keine Umstände macht, gerne, liebe Schwiegermutter.« Er nahm die Kanne und schenkte sich ein. »Wie das duftet, herrlich.« Er hob die Tasse und nippte daran. »Vielleicht möchtest du ja auch etwas von dem leckeren Gebäck?«, fuhr er mit seiner Scharade fort, als er die Tasse abgestellt hatte. »Oh, wie nett von dir, Frieda. Ich nehme gerne ein Plätzchen.« Er nahm sich eines vom Teller und biss hinein. »Mmmmmh,« rief er begeistert. »Wie das schmeckt. Vorzüglich. Wo hast du die denn her?«
Er machte eine kurze Pause. Dann gab er sich erstaunt: »Was, selbstgemacht? Nein, sowas kannst du? Ich hätte schwören können, sie sind direkt aus der Backstube.« Er biss übertrieben genüsslich in das Plätzchen, schloss die Augen und zelebrierte jeden Bissen. Als er die Augen wieder öffnete, sah er die beiden Damen, die ihn anstarrten. Heinrich hörte auf zu kauen. Er fühlte sich ertappt.
»Geht es dir gut?«, fragte Frieda.
»Waff?«, erwiderte Heinrich mit keksvollem Mund. Dabei fielen ein paar Bröckchen zwischen seinen Lippen heraus.
»Du redest mit dir selbst«, erklärte Charlotte.
Heinrich schluckte den letzten Rest Gebäck hart
hinunter.
»Muss ich ja. Ist sonst keiner da, der mit mir redet.«
Beide Frauen schüttelten verständnislos den Kopf.
»Heinrich, du solltest kürzer treten. Es tut dir nicht gut, immer so viel zu arbeiten«, schlug Frieda vor.
»Du hast gut reden«, dachte Heinrich. »Du lebst ja vom Erbe deines verstorbenen Gatten, der dir ein Vermögen hinterlassen hat.«
Laut sagte er: »Geht schon. Apropos gehen: Ich muss dann mal los.«
Der Türmer sprang auf. »Ihr kommt ja zurecht.«
Heinrich verschwand aus der Wohnung seiner Schwiegermutter und hastete zurück zum Dom. Die ersten Besuchergruppen würden in Kürze eintreffen.
Als Heinrich am Domplatz um die Ecke bog, traute er seinen Augen nicht. Vor dem Dom stand eine Menschenmenge, wie er sie selten gesehen hatte. Er dachte kurz nach, ob er Termine durcheinander gebracht hatte. Seines Wissens sollte er gegen Mittag eine Gruppe von acht Besuchern durch den Dom führen. Zuvor sollte der Küster ebenfalls eine Gruppe führen. Diese hatte eine Stärke von fünfzehn Menschen. Eigentlich war es ja Heinrichs Aufgabe, die Führungen zu übernehmen. Doch der Küster war freundlicherweise für ihn eingesprungen, damit er seine Schwester am Bahnhof abholen konnte. Jetzt standen geschätzte zwanzig Menschen vor dem Eingang zum Domturm. Die Menge war unruhig, wie Heinrich schnell feststellte. Was ging hier vor?
Heinrich bahnte sich einen Weg zum Eingang. Was er dort sah, wollte er zuerst nicht glauben.
Bernhard Doldinger, der Küster des Frankfurter Doms stand am Fuße der kleinen Treppe, die zum Eingang führte. Er schien verängstigt und starrte nach oben.
»Was ist denn los?«, wollte Heinrich wissen.
»Isch geh da nett nei«, schnaubte Doldinger.
»Warum? Ist der Leibhaftige hinter der Tür?«
»Schlimmer!«
»Rede Klartext, Bernhard. Die Leute wollen den Dom besichtigen.«
»Der Hund!«
»Was für ein Hund?«
»Was waas dann isch, wo des Vieh uff einma herkimmt.«
»Du meinst bestimmt Goliath?«
»Was?«
»Der Hund. Das kann nur der vom Meinhardt sein. Er hat ihn zur Pflege.«
»Is mir doch worscht. Der is hinner dere Dür un lässt kaan enei. Isch lass mich net zerfleische.«
Der Türmer musste ein Lachen unterdrücken.
»Hast du den … Hund denn schon mal gesehen?«
»Biste narrisch? Der hockt hinner der Dür und gauzt die ganze Zeit.«
»Und deshalb stehen hier die ganzen Leute und können den Dom nicht besichtigen?«
»Heini, kapiers doch«, rief Doldinger aufgeregt und zeigte auf die verschlossene Turmtür. »Da iss en Hund. Der beißt!«
Der Türmer überlegte kurz, ob er etwas sagen sollte. Als er aber den völlig verängstigten Küster anschaute, sparte er sich die Luft und schritt die Stufen empor. Er riss die Tür zum Domturm auf und brüllte hinein.
»Sieh zu, dass du Land gewinnst, du Töle!«
Das Bellen verstummte und Goliath kam jaulend durch die Tür geflitzt. Beim Anblick des Hundes trat zuerst Stille in der wartenden Menge ein. Dann fing der Erste an zu lachen. Es war ein hämisches Lachen. Kurz darauf kamen die ersten Kommentare.
»Wegen dem Zwerg haben wir hier gewartet?«
»Soll das ein Witz sein?«
»He, junger Mann. Hatten Sie etwa vor dem Angst?«
Doldinger wurde puterrot. Heinrich stand am Treppenabsatz und grinste.
»Herrschaften«, rief er in die Menge. »Beruhigen Sie sich. Das Problem ist ja jetzt gelöst, und wir können mit der Führung beginnen. Wenn Sie bitte bis zum ersten Treppenabsatz hinaufsteigen wollen. Ich komme sofort hinterher und zeige Ihnen den Domturm.«
Die Menge stampfte murrend an Doldinger und dem Türmer vorbei. Als alle durch waren, ging Heinrich zu Doldinger, der peinlich berührt vor der Pförtnerbude stand und am liebsten im Erdboden versunken wäre. Neben ihm hockte Goliath und wedelte mit dem Schwanz.
»Wo ist denn eigentlich der Meinhardt?«, wollte Heinrich wissen.
»Der is e ma korz austrete. Von dere Töle hat er nix gesacht. Der Drecksack. Wenn der zurick kimmt …«
Kaum hatte Doldinger die Worte ausgesprochen, bog Meinhardt um die Ecke. Er nestelte an seiner Hose, blickte auf und sah sofort, dass Doldinger wütend war. Er blieb stehen.
»Meinhardt, du Sauhund!«, rief Doldinger. »Was sollen des mit dem Köter hier?«
»Was dann?«
»Der Krippel hält de ganze Betrieb uff.«
»Wieso?«
»Kärle, frach net, sonst hach isch dir e paar gesche dein dürre Hals.«
»Bernhard, beruhig dich«, schritt der Türmer ein, der den Küster noch nie so wütend gesehen hatte. Jetzt war sein Kopf wieder rot. Diesmal vor Zorn.
Goliath sah nun endlich sein Herrchen und sprang ihm kläffend in die Arme. Meinhardt fing ihn auf. Sofort leckte der Hund dem Pförtner das Gesicht.
»Der ist doch harmlos. Wie sollen der de Betrieb uffhalte?«, wunderte sich Meinhardt.
»Ich geh libber, sonst vergess isch misch noch.« Doldinger schritt wutschnaubend davon.
»Was‘n mit dem los?«, fragte Meinhardt den Türmer.
Ein neues Leben
Am nächsten Morgen wachte Charlotte sehr früh auf. Heute war ihr erster Tag in einem neuen Leben in Frankfurt als Gehilfin und Schreibkraft bei der Scheideanstalt. Es war so aufregend!
Sie bewohnte ihr eigenes Zimmer in Friedas großzügiger Dachwohnung. Der Raum war für Charlottes Geschmack schon fast zu groß. Friedas Schlafzimmer war wesentlich kleiner als das ihre. Doch Heinrichs Schwiegermutter hatte darauf bestanden, dass Charlotte das größere Zimmer bekam. Man konnte ihr so leicht nichts abschlagen, das hatte Charlotte als erstes gelernt.
Die Schwester des Türmers streckte sich, sprang voller Elan aus dem Bett und schritt frohen Gemüts ans Fenster, um zu sehen, ob die Sonne bereits ein wenig Licht in die winterliche Stadt trug. Sie schlug die schweren, dunklen Vorhänge zur Seite und war enttäuscht. Draußen war es stockdunkel. Es regte sich nichts auf der Straße. Sie ging zu ihrem Nachtschrank, auf dem eine Uhr stand. Sie blickte darauf und war entsetzt.
»Erst fünf Uhr! Was mache ich denn jetzt?«
Sie war hellwach. An Schlaf war jetzt nicht mehr zu denken. Sie musste erst um acht Uhr an ihrem neuen Arbeitsplatz sein.
»Na ja, was soll ich machen. Dann lese ich einfach ein wenig in meinem Buch weiter.«
Sie ging zu ihrem Koffer und öffnete ihn. In dem Koffer befanden sich ein weiteres Kleid, ein wenig Unterwäsche und jede Menge Bücher. Wenn Heinrich das gewusst hätte, wäre er mit Sicherheit seiner Schwester an den Hals gesprungen. Sie musste daran denken, wie er sich die Treppen hinaufgequält hatte, und kicherte schadenfroh.
Sie setzte sich auf ihr Bett und las, bis der Morgen endlich graute.
»Kindchen, bist du wach?«, hörte sie die Stimme Friedas gegen sieben Uhr durch die geschlossene Zimmertür.
»Schon lange«, rief sie zurück.
»Kann ich hereinkommen?«
»Gerne.«
Frieda öffnete die Tür und kam langsam ins Zimmer.
»Guten Morgen, meine Liebe«, sagte sie und musterte ihren Gast. »Wie ich sehe, bist du schon bereit für deinen ersten Tag.«
»Schon seit Stunden.«
Nachdem die beiden Damen ein reichhaltiges Frühstück eingenommen hatten, trat Charlotte den Weg zur Scheideanstalt an.
Sie fror. Der Wind pfiff durch die Hochstraße. Charlotte zog die Schultern hoch. Nach einer gefühlten Ewigkeit hatte sie endlich die Schneidwallgasse in der Nähe der Paulskirche erreicht. Sie zitterte und war froh, als sie den Pförtner der Scheideanstalt passiert hatte. Er bat sie, in der Eingangshalle des Haupthauses zu warten. Es würde sofort jemand kommen, der sich um sie kümmerte. Sie könne sich dort auch aufwärmen, sie sähe fürchterlich verfroren aus.
Die Scheideanstalt war ein imposanter Gebäudekomplex, der quadratisch am Rande der Frankfurter Altstadt lag. Man sah sofort, dass es der Firma gut ging. Alles sah sehr gepflegt aus. Charlotte schaute sich gerade interessiert in der Eingangshalle um, als eine Frau auf sie zukam. Sie streckte schon von weitem die Hand aus. Sie trug dem Anschein nach teure Kleidung und hatte das blonde Haar hochgesteckt, wie es zurzeit Mode war. Ihr Gesicht war Charlotte auf Anhieb sympathisch. Ihre blauen Augen strahlten hell im schummrigen Licht der Eingangshalle. Sie lächelte breit und rief: »Sie müssen Fräulein Niemann sein.«
Charlotte nickte schüchtern und erwiderte das Lächeln.
»Ich bin Gerda Müller, ich soll mich um ihre Einarbeitung bemühen. Ich leite die Schreibstube der Scheideanstalt.«
»Freut mich, Sie kennenzulernen, Frau Müller«, erwiderte Charlotte und schüttelte Gerda Müllers Hand.
»Oh mein Gott, sind ihre Hände kalt«, rief diese und musterte Charlotte. »Sie sehen schrecklich verfroren aus, Sie armes Ding. Kommen Sie schnell mit in die warme Schreibstube, und wärmen Sie sich auf.«
Charlotte folgte Frau Müller. Bald erreichten sie die Schreibstube. Das Zimmer war angenehm temperiert. Charlotte entspannte sich. Sie legte den Mantel, den ihr Frieda geliehen hatte, ab. In der Schreibstube, die im vierten Stockwerk direkt neben den Arbeitszimmern der Geschäftsleitung lag, saßen fünf Frauen und tippten ohne Unterlass auf Schreibmaschinen der Frankfurter Firma Adler. Neuestes Fabrikat. Charlotte staunte erneut über die Ausstattung, was ihr Frau Müller wohl ansah. Deshalb sagte sie mit etwas Stolz in der Stimme: »Die Herren Dr. Roessler und Herr Kleyer sind befreundet, weshalb wir immer die neuesten Modelle der Adlerwerke hier haben. Das erleichtert uns die Arbeit.«
»Das hört man gerne«, erwiderte Charlotte, der nichts besseres einfiel.
Nachdem Charlotte ihren neuen Kolleginnen vorgestellt worden war, wurde sie den Rest des Vormittags durch das riesige Firmengebäude geführt und bekam alles Wichtige gezeigt. Gegen Mittag beendeten die beiden Frauen ihre kleine Rundreise durch die Scheideanstalt und betraten das Arbeitszimmer von Alexander Schneider, Charlottes Vorgesetztem und Vorstandsmitglied der Firma.
»Sie sind also die Empfehlung von diesem Polizisten«, begrüßte er Charlotte freundlich. »Nehmen Sie doch Platz, verehrtes Fräulein.« Schneider zog einen Stuhl heran und platzierte ihn vor seinem Schreibtisch. »Frau Müller, ich denke, ich benötige Sie nun nicht mehr. Vielen Dank, dass Sie sich unserer neuen Mitarbeiterin angenommen haben.«
»Ich habe zu danken«, sagte Frau Müller und entschwand.
»Sie ist ein Goldstück«, sagte Schneider, als Frau Müller den Raum verlassen hatte. Dann dachte er kurz nach und lachte über sein unfreiwilliges Wortspiel. Charlotte verstand nicht, lachte aber trotzdem mit. Schneider schien das zu bemerken.
»Goldstück, verstehen Sie?«
»Ehrlich gesagt: nein«, antwortete Charlotte offen.
»Sie wissen schon, was eine Scheideanstalt macht?«
»Sie trennen Edelmetalle aus den Münzen und …« Charlotte hielt inne, dann verstand auch sie den Wortwitz. »Oh, ich …«, sie wurde rot. »Sie müssen mich jetzt für reichlich dumm halten.«
»Mitnichten, Fräulein Niemann, mitnichten«, beeilte sich Schneider zu sagen. Er sprang auf und bot Charlotte einen Kaffee an, um die peinliche Situation zu entspannen.
Während er einschenkte, versuchte er sich in Konversation.
»Sie kommen auf eine Empfehlung dieses Polizisten, wie war noch sein Name?«
»Kommissar Schuhmann«, half Charlotte dem Direktor auf die Sprünge.
»Ja, genau, richtig. Er hat doch vor ein paar Jahren Henriette von Helmsbach-Lippe das Handwerk gelegt. War da nicht auch ein Feuerwehrmann beteiligt?«
»Das war mein Bruder.«
Charlotte war die Situation ein wenig peinlich, warum auch immer.
»Wirklich!«, rief Schneider aus. »Dann sind sie ja die Schwester einer lokalen Berühmtheit!«
»Wenn Sie es sagen. Ich komme aus Hannover, da ist mein Bruder ziemlich unbekannt.«
»Sie haben recht. Es geht hier nicht um die Erfolge Ihres Bruders. Verzeihen Sie mein Taktlosigkeit. Dennoch haben Sie ihm, zumindest indirekt, diese Anstellung bei uns zu verdanken.«
»Wofür ich meinem Bruder auch sehr dankbar bin.«
»Nun, Kommissar Schuhmann ist ein Cousin zweiten Grades meiner Schwägerin. Sie sehen, ich bin ein Familienmensch.« Er lächelte milde, dann hob er ertappt die Hände. »Aber denken Sie nur nicht, wir hätten Sie nur aufgrund dieser Beziehungen eingestellt. Wir brauchen dringend Ihre Arbeitskraft. In einer Firma dieser Größenordnung fällt viel Schreibkram an.«
Es entstand eine peinliche Pause, in der beide nach einem Gesprächsthema suchten. Es fand sich aber keines, weshalb Charlotte ihre Tasse abstellte und aufstand. Sie richtete ihr Kleid und sagte: »Dann ist es wohl jetzt besser, ich mache mich mal an die Arbeit. Ich werde schließlich nicht für‘s Kaffeetrinken bezahlt.«
»Sie haben recht, Fräulein Niemann. Ich halte Sie auf. Ich begleite Sie zu Ihrem neuen Arbeitsplatz.«
Schneider führte Charlotte zur Schreibstube, wo sie umgehend mit einem Stapel ins Unreine geschriebener Briefe eingedeckt wurde, die sie in die vor ihr stehende Adler, Modell 8 neuester Bauart, eintippte. Damit war sie bis zum Feierabend beschäftigt. Sie hörte erst auf, als Frau Schmitt-Johann, ihre direkte Vorgesetzte, zu ihr kam und sagte, es sei genug für heute.
Zufrieden mit ihrem ersten Arbeitstag machte sich Charlotte auf den Weg zurück zu ihrer Unterkunft bei Frieda. Als sie vor die Tür trat, traf es sie wie ein Hammerschlag. Das Wetter war noch ungemütlicher geworden. Ein Schneesturm tobte in den Gassen der Stadt. Charlotte zog die Schultern hoch, klappte den Kragen des geliehen Mantels an ihren schmalen Hals hoch und ging gebeugt die Weißfrauenstraße in Richtung Innenstadt entlang. Doch weit kam sie nicht. Plötzlich fand sie sich auf dem Hosenboden wieder. Aber sie war nicht auf der glatten Straße ausgerutscht, nein, sie war geradezu umgerissen worden.
»Oh, mein Gott!«, hörte sie eine Männerstimme sagen. »Das tut mir unendlich Leid.«
Charlotte wurde gepackt und auf die Beine gestellt. Jemand versuchte, ihr den Schnee vom Kleid zu klopfen.
»Lassen Sie das!«, rief Charlotte empört.
»Aber ich will doch nur helfen.«
»Man fasst eine Dame nicht … dahin.«
»Natürlich. Verzeihen Sie vielmals. Haben Sie sich verletzt?«
Jetzt sah Charlotte ihren Unfallgegner das erste Mal an.
Sie war hin und weg.
»Was für ein gutaussehender Mann«, dachte sie sofort, und der Ärger darüber, dass er sie angerempelt hatte, verflog im Nu.
»Nein, ich bin nicht verletzt.«
»Wirklich?«
»Ich denke schon.«
»Probieren Sie zu gehen. Ich will sicher sein.«
Charlotte machte ein paar Schritte. Alles schien in Ordnung. Der Fremde lief mit ausgebreiteten Armen, jederzeit bereit sie aufzufangen, neben ihr her.
»Alles in bester Ordnung«, bescheinigte Charlotte.
»Sicher?«
»Sicher!«
»Wie kann ich das nur wieder gut machen. Ich habe sie einfach nicht gesehen. Der Schnee nahm mir jegliche Sicht. Ich habe nur auf den Boden gestarrt. Es tut mir so Leid, gnädige Frau …«
»Fräulein, bitte!«
»Fräulein. Natürlich.«
»Ist ja nichts passiert.«
»Darf ich es wieder gutmachen?«
»Was meinen Sie?«
»Ich möchte Sie auf einen Kaffee oder einen Tee oder was auch immer einladen. Das ist doch das Mindeste.«
»Und ziemlich unschicklich«, dachte Charlotte. Sie überlegte aber nur kurz.
»Da haben Sie recht, Sie schulden mir etwas.« Die Antwort war ein wenig zu keck, aber Charlotte wollte diesen Märchenprinzen nicht so schnell wieder davonziehen lassen.
Zarte Bande
Der Fremde stellte sich als Heiko Lorenz vor. Er führte Charlotte in ein nahe gelegenes Kaffeehaus in Nähe der Markthalle. Er war sehr galant, schmeichelte Charlotte mehrmals, so dass sie rot wurde, und unterhielt sie aufs Ersprießlichste. Sie war hin und weg.
Spät am Abend brachte Lorenz Charlotte noch auf den Weg zu Friedas Wohnung in der Hochstraße. Er drückte sogar auf die Türglocke für Charlotte. Er war so zuvorkommend. Und so hübsch. Charlotte wurde trotz der Minusgrade warm.
Er zog den Hut zum Abschied und verschwand im Schneegestöber.
Charlotte stieg verträumt die Stufen des Hauses empor. Sie blieb im ersten Obergeschoss stehen und schlug sich auf die Stirn.
»Ich dumme Nuss«, rief sie und rannte die Treppe wieder hinunter. Sie riss die Haustür auf und schaute die Straße auf und ab.
Herr Lorenz war nicht zu sehen.
Wie sollte sie ihn jemals wiedersehen?
Charlotte stieg zum zweiten Mal die Stufen des Hauses aufwärts. Diesmal jedoch niedergeschlagen. Jetzt traf sie endlich einen Mann, der ihr zusagte, und dann ließ sie ihn ziehen. Sie kam sich wie ein dummes kleines Mädchen vor.
Auf der Türschwelle erwartete Frieda sie bereits.
»Kind, was ist mit dir?«, fragte sie beim Anblick des traurigen Mädchens.
»Ach, Frieda. Ich bin so dumm.«
»Komm erst einmal herein, und erzähle mir, was dich betrübt.«
Charlotte gehorchte. Kurz darauf verfing sie sich in Schwärmereien für Herrn Lorenz: Er war so höflich und gebildet. Zuvorkommend und galant. Unterhaltsam und hübsch.
»Ich glaube, da hat sich jemand auf den ersten Blick verliebt«, erfasste Frieda die Situation lächelnd.
»Humbug«, rief Charlotte.
Frieda beließ es dabei und trug das Geschirr für das Abendbrot auf.
Das Wiedersehen ließ zu Charlottes Freude nicht lange auf sich warten. Herr Lorenz stand bereits am nächsten Tag nach Feierabend vor der Scheideanstalt und wartete auf Charlotte. In der Hand hielt er einen Strauß Blumen.
»Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend, Fräulein Niemann«, eröffnete er. »Ich habe ein paar Blumen für Sie gekauft. Als Entschuldigung.«