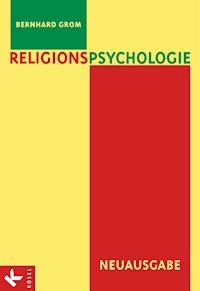
19,99 €
19,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kösel
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie sich Religiosität auf die Menschen auswirkt - Die bewährte Gesamtdarstellung der Religionspsychologie
Die Neuausgabe des bekannten Standardwerks von Bernhard Grom erklärt die Vielfalt, in der sich religiöses Erleben, Denken und Verhalten ausprägen kann. Dieses Handbuch gibt einen umfassenden Überblick über die Psychologie der Religion – übersichtlich, allgemein verständlich und auf dem aktuellen Stand der Wissenschaft.
Ideales Lehrbuch und Nachschlagewerk.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Veröffentlichungsjahr: 2009
0,0
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
ERSTER TEIL - RELIGIOSITÄT ALS BESTANDTEIL DER PERSÖNLICHKEIT
Die Vielfalt von Religiosität in der Mehrdimensionalität von Fragebogen
Religiosität: Intrinsisch oder extrinsisch?
Rligiosität: Mehrdimensional nach Glaubenszustimmung, -praxis, -erfahrung, ...
KAPITEL 1 - RELIGIOSITÄT IN DER VIELFALT INTRINSISCHER MOTIVE
Sektion 1 - Wie viele Motive und welche? Historisch-systematische Diskussion
Copyright
Vorwort
Was will Religionspsychologie?
Bei der Europäischen Wertestudie von 1999/2000 erklärten 50,7% der Europäer, Religion sei in ihrem Leben ziemlich oder sehr wichtig, und 57,8% bestätigten, dass sie »aus der Religion Trost und Kraft ziehen«. Letzteres sagten von den Deutschen - unterdurchschnittlich - 49,9%, von den Polen aber - deutlich über dem Mittel - 82% (Halman, 2001).
Religion und Religiosität sind trotz gelockerter Kirchenbindung und fortgeschrittener Säkularisierung bedeutende Faktoren im Leben der Einzelnen und der Gesellschaft geblieben - zu wichtig, als dass die Psychologie sie ignorieren dürfte. Wer Störungen und Ressourcen der Menschen mit den Mitteln psychologischer Forschung und Beratung angehen will, wird diesen Bereich nicht außer Acht lassen, gleich wie er selbst über Glaubensfragen denkt. Nicht wenige Menschen klagen, dass sie weder mit dem Arzt noch mit dem Psychotherapeuten darüber sprechen können, wie sie bei depressiven Verstimmungen im Gebet Zuflucht suchen, in der Trauer um einen lieben Verstorbenen »Erscheinungen« von ihm erleben oder in Sorge sind, wenn sich Tochter oder Sohn einer spirituellen Gruppe angeschlossen haben. Die beträchtliche religiöse Unwissenheit, die in weltanschaulich pluralistischen und stark säkularisierten Gesellschaften herrscht, fördert auch leicht Vorurteile gegenüber »den Kirchgängern«, »den Muslimen« oder »den Sektenanhängern«, die das Zusammenleben belasten. Die Psychologie, die doch in breiten Bevölkerungsschichten die Einsicht in psychische Probleme verbessern konnte, könnte mit ihrer Forschung bei Beratungsprofis sowie im öffentlichen Bewusstsein auch das Verständnis für religiöses Erleben, Denken und Verhalten vertiefen.
Ansätze dazu sind reichlich vorhanden, wirken auf den religionspsychologischen Laien aber unüberschaubar wie ein Dschungel. Es gibt mehrere tausend Veröffentlichungen, die sich in psychologischer Sicht mit religiösen Themen befassen, doch ein umfassendes »Menschenbild«, das uns alles Wesentliche über das Glaubensleben sagt, wird man in ihnen vergeblich suchen; das bieten allenfalls populärwissenschaftliche Erbauungsschriften. Die moderne Religionspsychologie, die mit den Fragebogenuntersuchungen von G. Stanley Hall (1881) und Edwin D. Starbuck (1899) sowie den Fallanalysen von William James (1902) entstand, hat im Windschatten der verschiedenen psychologischen Richtungen ganz unterschiedliche Strömungen entwickelt, die methodisch entweder mehr phänomenologisch und hermeneutisch-tiefenpsychologisch oder aber eher empirischstatistisch ausgerichtet waren (Henning, 2003; Wulff, 1997). Nach dem Abbruch der ersten Forschungsphase in den 1930er-Jahren entwickelte sich in den USA ab 1960 eine »zweite religionspsychologische Bewegung«, die entschieden erfahrungswissenschaftlich arbeitete. Angeregt von Gordon W. Allport (1950), der in seinem Fragebogen eine nutzenorientierte, extrinsische Religiosität von einer überzeugten, intrinsischen unterschied (Allport & Ross, 1967), sowie von Charles Y. Glock (1962), der innerhalb von Religiosität fünf Dimensionen annahm und durch seinen Fragebogen erhob, etablierte sich eine Religionspsychologie, die anschlussfähig war an die wissenschaftliche, akademische Psychologie und Soziologie, weil sie sich um theoretische Grundlagen und Erhebungsmethoden bemühte, die deren Standards entsprachen. Zu ihrer Anerkennung trug auch der Umstand bei, dass diese Forschung größtenteils in psychologischen, medizinischen und sozialwissenschaftlichen Fachbereichen betrieben wurde. Bereits die Pioniere, der Sozial- und Persönlichkeitspsychologe Allport wie auch der Soziologe Glock, arbeiteten an Universitäten ohne theologische Fakultäten, sodass religionskritische Kollegen keinen Grund hatten, ihre Unabhängigkeit von der »religiösen Szene« anzuzweifeln.
Religionspsychologie - Psychologismus - Pastoralpsychologie
Dieser Mainstream-Religionspsychologie, die bis in die Gegenwart zahlreiche Untersuchungen von hohem wissenschaftlichem Niveau hervorgebracht hat, in Europa allerdings schwächer verankert ist (Belzen, 1998; Grzymała-Moszczyńska, 1991b; Henning, 2003), ist das vorliegende Buch verpflichtet. In ihrem Sinne soll hier Religionspsychologie als ein Forschungsbereich oder eine Spezialdisziplin der Psychologie verstanden werden, die mit den Fragestellungen, Konstrukten und Methoden erfahrungswissenschaftlicher Psychologie faktisches religiöses Erleben, Erkennen und Verhalten - kurz: Religiosität - beschreibt und im Hinblick auf ihre psychosozialen und intrapsychischen Bedingungen erklärt und vorhersagt. Im Unterschied zur naturwissenschaftlichen Erklärung klassischer Art bedeutet hier »Erklären« freilich nur eine wahrscheinliche Vorhersage des Verhaltens in bestimmten Situationen. Eine psychologische Erklärung schließt also - sieht man von neurophysiologischen Störfaktoren einmal ab - freies, selbstbestimmtes Verhalten nicht aus, sondern benennt nur Bedingungen und Prozesse, die ihm zugrunde liegen.
So aufgefasst ist Religionspsychologie ein Bereich Angewandter Psychologie, ähnlich wie Umwelt-, Musik-, Betriebs- oder Klinische Psychologie. Tatsächlich wurden die wichtigsten religionspsychologischen Untersuchungen als Anwendungen der Differenziellen, der Klinischen, der Sozial-, der Entwicklungs- und der Gesundheitspsychologie durchgeführt. Religionspsychologie soll innerhalb der Ausbildung künftiger Psychologen und Psychotherapeuten ein angemessenes Verständnis für religiöse Phänomene bei Klienten sowie in der übrigen Bevölkerung gewährleisten. Darum sollte sie idealerweise institutionell dort verankert sein, wo die nötige Kompetenz gewährleistet ist: in den psychologischen Fachbereichen. Die Religionswissenschaft und die Theologie(n) sollten ihr als Gesprächspartner willkommen sein, bringen aber von ihrer Forschungstradition, Fragestellung und Methodik her eine andere, eigene Art von Sachverstand mit.
Um die weltanschauliche Neutralität der Psychologie zu wahren, soll die Religionspsychologie keine Anwendungsziele erforschen, denen bestimmte Wahrheitsansprüche und ethisch-religiöse Normen zugrunde liegen. Denn mit ihrer Fragestellung und ihren Methoden ist sie nur für den subjektiven Aspekt religiösen Erlebens, Erkennens und Verhaltens zuständig. Sie muss den objektiven Aspekt - die Frage, ob bestimmten Glaubensüberzeugungen objektive Geltung zukommt oder ob einzelne Formen von Gebet, Meditation und Gottesdienst erstrebenswert sind - der kritisch-normativen Reflexion von Ethik, Religionsphilosophie und Theologie überlassen, die dies mit ihren Argumentationsweisen zu erörtern haben.
Weltanschauliche Neutralität
Die Religionspsychologie hat also nicht - wie es Freud (GW 7, S. 129- 139; 9; 14, S. 323-380; 15, S. 170-197) aufgrund positivistischer Voreingenommenheit und in Überschreitung der Kompetenzgrenzen der Psychologie tat - über den Illusions- oder Realitätscharakter von religiösen Überzeugungen zu befinden; sie hat weder weltanschauliche Religionskritik noch Religionsapologetik zu betreiben. Sie soll Religiosität weder pauschal pathologisieren noch idealisieren, sondern differenziert erforschen.
Auch eine andere Grenzüberschreitung, die in der Vergangenheit das Verhältnis zum »religiösen Lager« stark belastet hat, sollte die Religionspsychologie vermeiden: einen psychologistischen Reduktionismus, der meint, er könne den Wahrheitsanspruch von religiösen Überzeugungen dadurch beurteilen, dass er nachweist, diese seien »nichts anderes als« die Folge und der Ausdruck einer bestimmten Sozialisation, emotionalen Bedürfnislage oder Störung. Diese Auffassung übersieht, dass religiöse Vorstellungen trotz der Einflüsse, die eine bestimmte Erziehung oder emotionale Befindlichkeit ausüben, vom Gläubigen selbstkritisch in Frage gestellt und modifiziert werden können, wenn seine Religiosität hinreichend stark in einem genuin kognitiven Interesse an weltanschaulicher Erkenntnis und logischer Widerspruchsfreiheit wurzelt. Die emotionalen Motive, die an jemandes Religiosität beteiligt sein mögen, können zwar zu Verzerrungen führen, doch ist dies jeweils auf kognitiver Ebene und mit weltanschaulicher Argumentation zu prüfen. Die einfache Tatsache, dass z.B. jemand streng erzogen wurde oder zu depressiven Verstimmungen neigt, sagt als solche noch nichts über die Richtigkeit oder Unrichtigkeit seiner Gottesvorstellung - so wenig, wie sie über den Wahrheitsgehalt seiner physikalischen oder medizinischen Auffassungen entscheidet.
Die Religionspsychologie sollte sich im Gespräch mit Theologen auch bewusst sein, dass sie vom Glaubensleben (wie auch vom übrigen psychischen Leben) nur das erfasst, was ihre Konstrukte erfassen. Wenn sie beispielsweise von »glaubensgestütztem psychischem Wohlbefinden« redet, nimmt sie sicher einen wesentlichen subjektiven Aspekt von »Heil« in den Blick, aber vielleicht nicht alle Facetten. Ebenso, wenn sie »Nächstenliebe« als »religiös motiviertes prosoziales Empfinden und Verhalten« untersucht oder »Gottvertrauen« als »religiös motiviertes Bewältigungsverhalten«. Dementsprechend sollten die Theologen von der Religionspsychologie auch nicht fordern, dass sie über alle Aspekte des Religiösen Bescheid weiß.
Allerdings soll sich die Religionspsychologie in einer Frage, die zweifellos psychologisch ist und in ihren Kompetenzbereich fällt, durchaus als engagierte Wissenschaft verstehen: Aufgrund ihrer psychohygienisch-therapeutischen Grundausrichtung muss sich die Psychologie für das psychische Wohlbefi nden und eine günstige Persönlichkeitsentwicklung der Menschen verantwortlich fühlen; darum soll die Religionspsychologie auch ermitteln, welche religiösen Einstellungen das Wohlbefinden und die Persönlichkeitsentwicklung beeinträchtigen oder fördern. Diese Aufgabe wird seit Jahren im umfassenden Rahmen der Gesundheitspsychologie (Koenig, McCullough & Larson, 2001; Plante & Sherman, 2001) bzw. der Lebensqualitätsforschung (Ellison, 1991; Witter, et al., 1985) wahrgenommen.
Engagierte Wissenschaft?
Im Übrigen hat die Religionspsychologie aber nicht normativ und pädagogisch zu untersuchen, wie man eine religiöse Entwicklung fördern kann, die bestimmten theologischen Zielvorstellungen entspricht, d.h. wie man ein authentischer Jude, Christ, Muslim, Hindu oder Buddhist werden kann. Eine solche Art von Anwendung psychologischer Erkenntnisse und Methoden muss ja im Dienst einer bestimmten Glaubensgemeinschaft erforschen, wie deren Erziehungs-, Beratungs- und Seelsorgeziele wirksam verwirklicht werden können. Darum sollte sie klar als Arbeitsbereich kenntlich sein, der gleichzeitig Teil der Anwendungsfächer Klinische und Pädagogische Psychologie und ebenso - im christlichen Kontext - Teil der Praktischen Theologie und Religionspädagogik ist. Diese auf kirchliches Handeln bezogenen Verbunddisziplinen sollte man - um Missverständnisse zu vermeiden - nicht »theologische Religionspsychologie«, sondern »Pastoralpsychologie« (Klessmann, 2004), bzw. »Religionspädagogische Psychologie« (Grom, 2000) nennen.
Was ist religiös bzw. spirituell?
Was aber soll die Religionspsychologie als ihren Gegenstandsbereich, d.h. als religiös betrachten? Religionswissenschaftler geben zu bedenken, dass es nicht möglich ist, einen für alle Kulturen und Zeiten gültigen Begriff von Religion zu bilden. Autoren mit phänomenologischem Ansatz neigen zu der Definition, religiös sei, was mit der Erfahrung des »Heiligen« zu tun habe. Dabei kann man sich allerdings fragen, ob eine solche Charakterisierung universal genug ist. Dies kann man auch einwenden, wenn man das Religiöse im Glauben an das »Absolute« oder »Ultimate« sieht, denn es ist fraglich, ob beispielsweise Polytheisten an ein Absolutes oder Ultimates glauben. Soziologen unterscheiden mit Berger (1974) häufig zwischen »substanziellen« Definitionen, die Religion von Wesen und Inhalt des Geglaubten her bestimmen, und »funktionalen« Definitionen, die sie von den Aufgaben und der Bedeutung her begreifen, die sie für den Einzelnen und die Gesellschaft hat - sei es Kontingenzbewältigung, Sinnstiftung, Kompensation oder soziale Integration. Da diese Funktionen aber auch von erklärtermaßen säkularen, areligiösen Wertorientierungen, Wissenschaften, Lebenshilfe-Angeboten und Gruppen erfüllt werden können, umfasst ein funktionaler Religionsbegriff allzu unterschiedliche Phänomene: Er ist einerseits zu weit und andererseits zu theoriespezifisch.
Der kognitiven Komponente und Eigenart von Religion und Religiosität wird wohl nur eine substanzielle Definition gerecht. Tatsächlich hat die Religionspsychologie in einer langen Forschungstradition gute Erfahrungen mit einem substanziellen Religionsbegriff gemacht, der rein forschungspraktisch und ohne Wertung religiöse Phänomene von nichtreligiösen abgrenzt. In dieser Sicht könnte man sich darauf verständigen, dass als »religiös« jenes Erleben, Denken und Verhalten zu bezeichnen und zu erforschen ist, das in seiner kognitiven Komponente ausdrücklich etwas Übermenschliches und Überweltliches annimmt, gleich, ob dieses poly-, mono-, pantheistisch oder anders aufgefasst wird. Damit bleibt offen und durch eine motivationspsychologische Analyse zu klären, welche Funktionen Religiosität im Einzelfall erfüllt. Als gemeinschaftsbezogene, institutionalisierte Überzeugung und Praxis wird das Religiöse traditionell als »Religion« bezeichnet, im Unterschied zur »Religiosität« als der individuellen Gestalt des Religiösen.
Substanzieller Religionsbegriff
Seit den 1990er-Jahren sprechen amerikanische und auch europäische Autoren vermehrt von »Spiritualität«. Manche verwenden diesen Begriff synonym für Religiosität (wie es auch in diesem Buch geschehen soll), wollen mit ihm aber die persönliche Gläubigkeit betonen, weil auch der Ausdruck »Religiosität« - wenigstens in den USA - manchmal mit rein äußerlicher Zugehörigkeit zu einer Denomination verbunden wird und sich Amerikaner mit gewachsener Distanz zu religiösen Organisationen häufiger als früher als spirituell und nicht als religiös einstufen (Marler & Hadaway, 2002). Andere fassen »Spiritualität« weiter als »Religiosität«, sodass in ihr der Bezug zu einer transzendenten Wirklichkeit auch fehlen kann, weil hier Spiritualität nur eine Suche nach Lebenssinn beinhaltet, der auch einfach in der Verbundenheit mit anderen Menschen, mit der Natur u.ä. gefunden werden kann (Meraviglia, 1999; Řičan, 2004; Zwingmann, 2004). Der Begriff Spiritualität vermeidet zwar die problematischen Konnotationen von Religiosität und wirkt darum uneingeschränkt positiv, leidet aber sichtlich an Unklarheit.
Die Vielfalt von Religiosität, erklärt in »kohärentem Eklektizismus«
Die Ergebnisse der Mainstream-Religionspsychologie wirken großenteils wie eine Masse von Einzelbeobachtungen, in der das Gesicherte vom Ungesicherten und das Ergiebige vom Unergiebigen schwer zu unterscheiden ist. Die verwendeten Verfahren - oft Fragebogen, die Korrelationsstudien zugrunde liegen - sind überaus vielfältig (Hill & Hood, 1999; Huber, 1996), sodass die Resultate schwer vergleichbar und nicht selten uneinheitlich sind. Oft untersuchte man ganz verschiedene Phänomene, ohne einen Themenkomplex systematisch zu erforschen, und bewegte sich, sofern man nicht theorielos Daten erhob, in Rahmenvorstellungen, die sich ebenso schwer miteinander harmonisieren lassen wie Konfessionen. Auch umfangreiche Überblicksdarstellungen haben ihre Mühe, die berichteten Ergebnisse thematisch zu bündeln (Beit-Hallahmi & Argyle, 1997; Spilka et al., 2003).
Das vorliegende Buch beschränkt sich auf Schwerpunkte. Leitidee ist die Annahme, dass es »die« Religiosität nicht gibt, sondern dass sich Religiosität in einer enormen Vielfalt von religiösen Einstellungen, Erlebensund Verhaltensweisen ausprägen kann. Diese Überzeugung, in der sich heute die meisten Religionspsychologen einig sind, hat bereits William James im Titel seines Pionierwerks »Die Vielfalt religiöser Erfahrung« (1902) treffend und programmatisch formuliert. Religiosität kann mit dem Rückzug in privatistische Innerlichkeit wie auch mit politischem Engagement verbunden sein - sei es demokratisch oder theokratisch -, mit sozialer Sensibilität wie auch mit egoistischer Ausbeutung, mit Gewissensängstlichkeit wie auch mit rationalem Abwägen, mit gefestigtem Selbstvertrauen wie auch mit narzisstischer Störung, mit Depressivität wie auch mit ausgeglichener emotionaler Gestimmtheit, mit einsamer Meditation wie auch mit gemeinsamem Gottesdienst. Es ist das Hauptanliegen dieser Darstellung, möglichst viel von dieser Vielfalt zu beschreiben und zu erklären - und dabei ein möglichst hohes Maß an Zusammenhang herzustellen.
Darum erklärt der erste, größere Teil, der Religiosität als Bestandteil der Persönlichkeit untersucht, die Vielfalt möglicher Ausprägungen aus der Vielfalt der beteiligten intrinsischen Motive (Kapitel 1), der ausgeglichenen oder gestörten Emotionen (Kapitel 2) und der veränderten (Ich-)Bewusstseinszustände (Kapitel 3). Der zweite, kürzere Teil weist auf soziale Einflüsse hin, die - in Wechselwirkung mit den behandelten intrapsychischen Faktoren - die erwähnte Vielfalt mitgestalten.
Eine solche Darstellung kann den gewünschten Zusammenhang nicht dadurch herstellen, dass sie von einem einheitlichen Theorieansatz ausgeht, denn gerade die Vielfalt der Phänomene macht deutlich, dass die Erklärungskraft der Grundannahmen der großen psychologischen Richtungen begrenzt ist. Es bedarf auch hier einer Vielfalt von theoretischen Konzepten (und Methoden), die sich ergänzen, ohne sich zu widersprechen, und bestimmte Bereiche des Religiösen überzeugend erklären können. In dieser pluralistisch-integrativen Absicht, diesem »kohärenten Eklektizismus« (Allport, 1959, S. XXVI), werden sowohl lerntheoretische als auch (vereinzelt) psychoanalytische, motivations-, emotions- und kognitionspsychologische sowie phänomenologisch-psychiatrische und neodissoziationstheoretische Ansätze herangezogen.
Mehrere Theorieansätze
Religionspsychologie als Neurowissenschaft und »Neurotheologie«?
Seit den 1990er-Jahren gibt es ein großes Medieninteresse für Versuche von Neurowissenschaftlern, Religiosität von den ihr zugrunde liegenden neuronalen Aktivitäten her zu erklären. Schon 1984 hat der Theologe James B. Ashbrook von einer »Neurotheologie« gesprochen. Ausgangspunkt ist die Annahme, dass religiöse Erfahrungen mit bestimmten neuronalen Prozessen einhergehen, die man in dafür spezialisierten Hirnregionen nachweisen kann. Dazu führt man Beobachtungen und Überlegungen wie die folgenden an:
• Persinger (1987; 2002) will beobachtet haben, dass zwischen Visionen, unerklärlichen Geruchsempfindungen und ähnlichen Erfahrungen, die oft von Patienten mit Schläfenlappen-Epilepsien berichtet werden, einerseits und mystischen Erfahrungen andererseits ein überzufälliger Zusammenhang besteht, den er allerdings bei Gottesdienstbesuchern nicht nachweisen konnte. Bei Experimenten, in denen er im Lauf von 20 Jahren mehr als 1000 Versuchspersonen durch einen umgebauten Motorradhelm schwache Magnetfelder durch den Kopf leitete und auf diese Weise eine Überaktivität im Schläfenlappen (Mikro-Anfälle) erzeugte, sollen 80% der Teilnehmer von Schwebegefühlen, lebhaften Erinnerungen, Stimmenhören und dem Gefühl einer »gefühlten Gegenwart« berichtet haben, die sie als übernatürlich - oft als Gegenwart von Gott oder einem Engel - deuteten.
• Newberg, d‘Aquili und Rause (2003) haben bei acht Buddhisten und drei Franziskanerinnen mithilfe eines radioaktiven Markierungsstoffs durch Kernspintomographie nachgewiesen, dass während der Phasen tiefster spiritueller Vereinigung die Durchblutung des oberen Scheitellappens meistens drastisch zurückging. Damit sei die Hirnaktivität im »Orientierungsfeld«, das unsere räumliche Orientierung und die Unterscheidung unseres Körpers von der übrigen Welt ermöglicht, reduziert. Das durch Meditation erstrebte »Leerwerden« kann ihrer Meinung nach die Aufnahme von Sinnesreizen und kognitiven Impulsen so stark unterbinden, dass der obere Scheitellappen die Grenzen von Körper und Selbst nicht mehr finde, sodass - wie es mystische Texte schildern - subjektiv nur noch eine Raumlosigkeit erlebt werde, die der Geist »als Gefühl des unendlichen Raums und der Ewigkeit« deuten könne. Im Unterschied zu Persinger hat für diese Autoren die genetisch vererbte Fähigkeit, solche Einheitszustände zu erleben, nichts mit Epilepsie zu tun. Während Persinger reduktionistisch behauptet, Gott sei »ein Artefakt des Gehirns«, erklären sie, die Neurowissenschaften könnten weder ausschließen noch beweisen, dass in solchen Einheitserlebnissen etwas Göttliches erkannt werde.
• Speziell im Hinblick auf die Zen-Meditation, die er jahrelang praktiziert hat, betrachtet der Hirnforscher Austin (1998) das Phänomen der Erleuchtung, die die Zen-Tradition als Überwindung der Ich-Abgrenzung beschreibt. Austin führt die Erleuchtungserlebnisse auf die durch Meditation herbeigeführte Hemmung der Aktivität mehrerer subkortikaler Hirnareale zurück, die gewöhnlich das Gefühl des körperlichen Selbst und mit ihm die »Ich-mich-mein-Perspektive« speisen. So befähige die Zen-Meditation Gehirn und Bewusstsein zu der eigenständig-geistigen, emergenten Leistung, die neurophysiologischen Veränderungen hervorzurufen, die für die All-Einheitserfahrung nötig seien.
Was ist von diesem Ansatz zu erwarten? Neurophysiologische Untersuchungen sind zweifellos wichtig für das Verständnis und die Behandlung von Verletzungen und Erkrankungen des Gehirns, und da Religiosität - wie alles Denken und Erleben - an Hirnprozesse gebunden ist, können sie Informationen über deren neuronale Grundlagen vermitteln, zumal über die der Meditation. Im Übrigen dürfte ihr Beitrag zur Religionspsychologie aber begrenzt sein. Die »neurotheologischen« Überlegungen gehen meistens von außergewöhnlichen Erfahrungen wie Halluzinationen, epileptischen Anfällen, Orientierungsverlust oder Déjà-vu-Erlebnissen aus. Diese werden dann ähnlichen neuronalen Veränderungen bei ebenso außergewöhnlichen religiösen Erlebnissen wie Visionen oder mystischen Einheitserlebnissen zugeordnet. Die Ähnlichkeit, die man dabei annimmt, ist nur eine ungefähre; eine genaue Entsprechung auf neuroanatomischer Ebene ist nicht nachgewiesen. So ist Persingers Vergleich von religiösem Erleben mit Epilepsie empirisch nicht gesichert (s. auch Sensky, 1983). Die Autoren ordnen religiöse Erfahrungen auch unterschiedlichen Hirnarealen und -aktivitäten zu. Wenn sie auf das limbische System abheben, überschätzen sie wohl dessen Anteil und vernachlässigen die Bedeutung der an Denkvorgängen beteiligten Aktivität der Großhirnrinde, zumal wenn es um weniger außergewöhnliche Erfahrungen wie das Lesen eines Psalmverses geht (Azari et al., 2001; Azari et al., 2005).
Diskussion
Doch selbst, wenn man eine strenge Entsprechung annehmen könnte, wären die Folgerungen, die man zieht, nur auf außergewöhnliche Erfahrungen übertragbar, nicht auf Religiosität schlechthin. Denn die große Mehrheit der Gläubigen berichtet weder von mystischen noch von visionären Erlebnissen (Hardy, 1980). Das gewöhnliche religiöse Denken und Erleben kann man aber mit der Emotionspsychologie (s. Kapitel 2/I) erklären - ohne besondere Veränderungen der Gehirntätigkeit oder ein spezielles »Gott-Modul« (Ramachandran & Blakeslee, 2004) anzunehmen -, so wie das Bedenken und Feiern ethischer, ästhetischer und interpersonaler Inhalte auch. Die Neurotheologen müssen ja anerkennen, dass die von ihnen beobachteten Erlebnisse des Orientierungsverlusts oder einer gefühlten Gegenwart erst durch die Deutung der Betroffenen zu religiösen Erfahrungen werden. Kognitive und emotionale Inhalte und Vorgänge lassen sich aber nicht aus Gehirn-Tomogrammen und EEG-Aufzeichnungen erschließen. Darum sollte die Religionspsychologie vor allem die kognitive, emotionale und verhaltensbezogene Komponente von Religiosität erforschen und sich auf keinen Fall auf den neuronalen Aspekt beschränken.
ERSTER TEIL
RELIGIOSITÄT ALS BESTANDTEIL DER PERSÖNLICHKEIT
IHRE VORWIEGENDINTRAPSYCHISCHENBEDINGUNGEN
Schon die Alltagsbeobachtung lehrt, dass es »den« Gläubigen und auch »den« Juden, Christen, Muslim, Hindu oder Buddhisten nicht gibt, sondern dass »so viele Variationen religiöser Erfahrung (existieren), wie religiös eingestellte Menschen auf der Erde leben« (Allport, 1950, S. 30). Offensichtlich sind Menschen, die zwar derselben Glaubensgemeinschaft angehören und in ihr mit Millionen anderen das gleiche Bekenntnis teilen, u.U. auf recht unterschiedliche und höchst persönliche Weise gläubig. Sie unterscheiden sich nicht nur in ihrem religiösen Wissen, sondern auch in ihrer persönlichen Art zu beten, der Einstellung zu rituellen und ethischen Normen, ihren Lieblingsliedern, den Texten und Vorstellungen, die sie in ihren heiligen Schriften bevorzugen, sowie den emotionalen Befriedigungen, die sie aus dem Glauben ziehen. Die religiösen Einflüsse, die sie durch die Fremdsozialisation in ihrer Familie, Glaubensgemeinschaft und den Medien empfangen, verarbeiten sie in Prozessen der Selbstsozialisation (s. Kapitel 5) mehr oder weniger eigenständig, indem sie eine eigene Auswahl treffen, Inhalte neu deuten, diese mit ihrem Selbst- und Lebensverständnis verbinden und Schwerpunkte setzen. Die vielen Arten, auf die man religiös sein kann, und die vorwiegend intrapsychischen Bedingungen, unter denen diese Vielfalt entsteht, sind sicher nicht annähernd vollständig zu beschreiben. Dennoch kann man versuchen, möglichst viel davon auf psychologisch relevante Weise zu erhellen. Dieses Ziel verfolgt im Sinne der Differenziellen Psychologie und Persönlichkeitspsychologie der erste Teil dieses Buches, indem er in drei Schritten untersucht, wie sich bestimmte Ausprägungen von Religiosität erklären:
1. Aus der Vielfalt der intrinsischen Motive, in der sie verwurzelt ist (1. Kapitel).
2. Aus der Vielförmigkeit der ausgeglichenen oder gestörten Emotionen, die in ihr erlebt werden und unter motivationspsychologischer Rücksicht nicht hinreichend geklärt werden können (2. Kapitel).
3. Aus verschiedenen veränderten (Ich-)Bewusstseinszuständen, die in besonderen Fällen eine Rolle spielen (3. Kapitel).
Überblick über den ersten Teil
Die Vielfalt von Religiosität in der Mehrdimensionalität von Fragebogen
Dass Religiosität nicht nur von Kultur zu Kultur und von Gruppe zu Gruppe, sondern auch individuell variabel ist, hat man erstaunlicherweise vor allem in der empirischen sozialwissenschaftlichen Forschung betont und ernst genommen. Bei vielen Untersuchungen - etwa zur Lebenszufriedenheit oder zu rassistischen Vorurteilen - drängte sich die Vermutung auf, dass es nicht genügt, mit einer einzigen Frage (einem Item) zu ermitteln, ob die Befragten sich als sehr, wenig oder nicht »religiös« einstufen, ob sie an Gott glauben oder wie oft sie den Gottesdienst besuchen. Warum? Weil man all das auf unterschiedliche Weise tun kann. Hier haben sich zwei Ansätze als besonders fruchtbar und zukunftsweisend erwiesen: die Unterscheidung von intrinsischer und extrinsischer religiöser Orientierung nach Allport und Ross (1967) und die Annahme von fünf Dimensionen von Religiosität im Fragebogen von Glock (1962) sowie Stark und Glock (1968). Mit ihnen setzte sich die Erkenntnis durch, dass Religiosität nicht als einheitliches Persönlichkeitsmerkmal, sondern als komplexe Variable aufzufassen und zu untersuchen ist.
Religiosität: Intrinsisch oder extrinsisch?
Die Religious Orientation Scale (ROS) von Allport und Ross (1967) entstand im Kontext der Vorurteilsforschung. Allport war aufgefallen, dass bei mehreren Befragungen Gottesdienstbesucher tendenziell häufiger als kirchendistanzierte und areligiöse Personen Vorurteile gegenüber nationalen, ethnischen und ideologischen Minderheiten äußerten, dass dies jedoch bei denen, die dem Gottesdienst häufiger beiwohnten, seltener der Fall war als bei denen, die ihn weniger oft besuchten. Haben, so fragte er sich, die Ideale der Liebe und Geschwisterlichkeit, die das Christentum lehrt und die Gestalten wie Franz von Assisi oder John Wesley verkörperten, bei den einen das Verständnis für Minderheiten gefördert und bei den anderen nicht? Kann Religion sowohl Vorurteile verursachen als auch beseitigen?
Allport vermutete, die Sache lasse sich dadurch aufklären, dass man die Gottesdienstbesucher nach zwei grundlegenden Motiven unterscheidet: Gottesdienstbesucher mit extrinsischer religiöser Orientierung seien überwiegend an gesellschaftlichen Beziehungen innerhalb der Glaubensgemeinschaft, sozialem Prestige, Sicherheit und Trost interessiert und hätten damit ein letztlich utilitaristisches, selbstsüchtiges und oberflächliches Verhältnis zur Religion. Gottesdienstbesucher mit intrinsischer religiöser Orientierung hingegen schätzten die Religion aus innerer Überzeugung, praktizierten sie um ihrer selbst willen und orientierten sich am Gebot der Nächstenliebe. Und weil sich intrinsisch motivierte Gläubige mit den Idealen und Lehren des Christentums auseinandersetzten, hegten sie vermutlich weniger negative Vorurteile gegen Minderheiten als die extrinsisch motivierten, die die in der Gesellschaft herrschenden Vorurteile kritiklos übernähmen. Ähnlich hatte schon Feagin (1964) eine Intrinsic/Extrinsic Scale konstruiert. Der Fragebogen von Allport und Ross (1967), die berühmte Religious Orientation Scale (ROS), war inspiriert von Allports Theorie funktionell autonomer Motive und seinen früheren Überlegungen zu einer reifen Religiosität (s. Huber, 2003). Einige Aussagen (Items) sollen hier nach Zwingmann (1991) angeführt werden:
Tabelle 1: Intrinsische Items (Allport & Ross, 1967)
Es ist wichtig für mich, dass ich mir Zeit für private religiöse Gedanken und Besinnung nehme.Der Glaube ist besonders wichtig für mich, weil er mir Antworten auf viele Fragen nach dem Sinn des Lebens gibt.Ich versuche ständig, meinen Glauben auf alle anderen Bereiche meines Lebens zu übertragen.Wenn ich mich einer kirchlichen Gruppe anschließen sollte, würde ich eine Bibelgruppe anderen, mehr auf Geselligkeit ausgerichteten Gruppen vorziehen.
Tabelle 2: Extrinsische Items (Allport & Ross, 1967)
Trotz meiner religiösen Überzeugung merke ich, dass mir viele andere Dinge im Leben noch wichtiger sind.Es ist nicht so wichtig, was ich glaube, solange ich ein moralisches Leben führe.Ein Grund für meine Kirchenmitgliedschaft ist, dass man dadurch in einer Gemeinschaft Anerkennung finden kann.Ein Hauptgrund für mein religiöses Interesse ist, dass ich mich in meiner Pfarr- gemeinde nach Kräften sozial betätigen kann.Ich bete hauptsächlich, weil man mich so erzogen hat.Mein Glaube gibt mir vor allem Trost, wenn mich Sorgen und Unglück treffen.Der wesentliche Zweck eines Gebetes ist, Erleichterung und Schutz zu erhalten.
Mit den extrinsischen Items wurde eine nutzenorientierte Einstellung zum Religiös-Kirchlichen beschrieben, die in den Vereinigten Staaten, wo die Denominationen vom Kindergarten bis zur Altenpflege viele soziale Leistungen erbringen, nach wie vor verbreitet ist - im Gegensatz etwa zu Deutschland, wo religiöse Aktivität nicht mit sozialer Nützlichkeit in Verbindung gebracht wird (Grom, Hellmeister & Zwingmann, 1998). Mehrere Untersuchungen haben Allports Vermutung bestätigt, dass intrinsisch eingestellte Gottesdienstbesucher weniger Vorurteile hegen als extrinsische. Auch bei anderen Variablen bewährte sich die Unterscheidung: extrinsisch Motivierte zeigten im Vergleich zu intrinsischen geringere Werte an Lebenszufriedenheit, Sinnorientierung und Hilfeverhalten und mehr Vorurteilsneigung, Dogmatismus, Depressivität sowie Angst vor Tod und Sterben. Die ROS wurde geradezu zu einem Instrument, um »schlechte« von »guter« Religiosität zu unterscheiden. Da sie jedoch mit ihren extrinsischen Items eine ausgesprochen gleichgültige, oberflächliche Art von Religiosität misst, zu der auch ein Schuss Mitläufertum und Heuchelei gehören kann, wäre die E-Orientierung nicht nur als Indikator problematischer Religiosität, sondern großenteils als Hinweis auf eine areligiöse Einstellung zu deuten.
Die ROS betrachtete ursprünglich Religiosität noch als eindimensionales, aber bipolares Persönlichkeitsmerkmal, fasste also die I-Orientierung und die E-Orientierung als Endpunkte eines Kontinuums mit zwei Polen auf. Später stellte sich jedoch heraus, dass es sich um zwei voneinander unabhängige, unipolare Dimensionen handelt, dass sich also intrinsische und extrinsische Motivation nicht ausschließen: Man kann den (christlichen) Glauben überzeugt »leben« und gleichzeitig »gebrauchen« (Donahue, 1985; Kirkpatrick & Hood, 1990; Zwingmann et al., 1996). Wie die beiden in Tabelle 2 zuletzt angeführten Items zeigen, wird bei den E-Items persönlicher psychischer Nutzen (»Trost«, »Erleichterung«, »Schutz«) mit sozialem Nutzen konfundiert und rigoristisch als bloß extrinsisch-instrumentell abgewertet. Dies haben später Gorsuch und McPherson (1989) kritisiert und in einem revidierten Fragebogen klarer differenziert.
Kritik, weitere Entwicklungen
Batson und Ventis (1982) haben die ROS um eine dritte Dimension des Suchens und Zweifelns (quest) erweitert. In den 1990er-Jahren wurde die unzureichende theoretische Begründung und die Vorentscheidung für eine »gute« und eine »schlechte« Religiosität kritisiert. Schließlich hat man Skalen entwickelt, die das zweidimenionale I-E-Konzept aufgaben: Pargament et al. (1990) formulierten Items, die sie auf faktorenanalytischer Grundlage fünf unterscheidbaren Motiven zuordnen konnten, nämlich Selbstaktualisierung, Sinn/Hoffnung, Problemlösung, Hilfe und Zurückhalten von Emotionen. Gorsuch, Mylvaganam, Gorsuch und Johnson (1997) wiesen mit ihrem Fragebogen bei christlichen College-Studenten ebenfalls fünf Motive nach, die sich mit denen von Pargament et al. (1990) aber nur teilweise decken: Wachstum, Sinn, Sicherheit/Angenommensein, persönliche Moralität, soziale Moralität. Damit setzte sich auf dem Gebiet der Erhebung von Religiosität die Erkenntnis durch, dass diese nicht nur zwei- oder drei-, sondern mehrdimensional zu verstehen ist. Doch durch welche Dimensionen ist sie angemessen zu erfassen?
Rligiosität: Mehrdimensional nach Glaubenszustimmung, -praxis, -erfahrung, -wissen und -konsequenzen?
Die Soziologen Glock (1962) sowie Stark und Glock (1968) nahmen in ihrem Ansatz, der in zahlreichen Untersuchungen angewandt wurde, von vornherein fünf Dimensionen an, in denen sich die Religiosität der Weltreligionen ausprägen kann; sie bestimmten sie aber nicht motivationspsychologisch, sondern phänomenologisch. Glock hatte - soziologisch denkendschon in den 1950er-Jahren nach einer »Typologie religiöser Orientierung« gefragt. Die grundlegenden »Ausdrucksformen von Religiosität« zeigen sich seiner Ansicht nach in folgenden Dimensionen:
Tabelle 3: Die mehrdimensionale Struktur von Religiosität nach Stark und Glock (1968)
(1) Ideologische Dimension (auch: Glaubensdimension)Sie soll das Maß erfassen, in dem die einzelnen Gläubigen zentralen Aussagen ihrer Religion zustimmen, und zwar in dreifacher Hinsicht (Subdimensionen): Orthodoxie versus Heterodoxie. Beispielsweise zum Gottesglauben: (a) Ich weiß, dass Gott wirklich existiert und zweifle nicht daran. (b) Obwohl ich Zweifel habe, glaube ich doch an Gott. (c) Manchmal glaube ich an Gott und manchmal nicht. (d) Ich glaube nicht an einen persönlichen Gott, aber ich glaube an eine irgendwie geartete höhere Macht. (e) Ich weiß nicht, ob Gott existiert, und ich glaube nicht, dass man es herausfinden kann. (f) Ich glaube nicht an Gott. (g) Nichts von dem oben Erwähnten gibt wieder, was ich glaube. Was ich von Gott denke, ist... Partikularismus. Beispiel: Meinen Sie, die Zugehörigkeit zu Ihrem speziellen Glauben: (a) Ist unbedingt notwendig zum Heil? (b) Mag wahrscheinlich helfen, das Heil zu erlangen? (c) Hat wahrscheinlich keinen Einfluss auf das Heil?Ethikalismus. Beispiel: Meinen Sie, den Nächsten zu lieben: (a) Ist unbedingt notwendig zum Heil? (b) Mag wahrscheinlich helfen, das Heil zu erlangen? (c) Hat wahrscheinlich keinen Einfluss auf das Heil?(2) Rituelle DimensionSie soll die religiösen Praktiken erfassen, an die sich die Anhänger einer Religion zu halten haben, sei es die Häufigkeit der Gottesdienstteilnahme, des Tischgebets oder des persönlichen Gebets.(3) Dimension der religiösen ErfahrungSie soll keine außergewöhnlichen Erfahrungen wie Bekehrungen oder Glossolalie, sondern weniger auffällige Erlebensweisen erfassen. Beispiel: Hatten Sie als Erwachsener je eine der folgenden Erfahrungen, und wie sicher sind Sie sich dessen?1. Das Gefühl, irgendwie in der Gegenwart Gottes zu sein? (a) Ja, ich hatte dies sicher. (b) Ja, ich denke schon. (c) Nein.2. Das Gefühl, in Christus gerettet zu sein? (a) Ja, ich hatte dies sicher. (b) Ja, ich denke schon. (c) Nein.3. Das Gefühl, von Gott für etwas, das Sie getan haben, bestraft zu werden? (a) Ja, ich hatte dies sicher. (b) Ja, ich denke schon. (c) Nein.(4) Dimension des religiösen WissensSie ermittelt, in welchem Maß Menschen zentrale Aussagen ihres Glaubens wiederkönnen, und sieht darin einen Indikator für religiöse Bindung. Ob Christen etwa die Zehn Gebote nennen oder auf einer Liste von Namen die alttestamentlichen Propheten ankreuzen können. Die Zustimmung zur Glaubenslehre soll hingegen die ideologische Dimension messen.(5) Dimension säkularer KonsequenzenHier dachte Glock einerseits an ethische Verpflichtungen, die mit einer Religion gegeben sind, andererseits aber auch an »Belohnungen« wie seelischen Frieden und Freiheit von Furcht und Sorge. Für ihn war nicht klar, inwiefern diese Konsequenzen innerer Bestandteil bzw. Folge von Religiosität sind, und er hat diese Dimension nicht mehr operationalisiert.
Zwar musste auch dieses Konzept manche Kritik hinnehmen (vgl. Huber, 1996, 2003), doch hat es als Ganzes das Bewusstsein von der Vielfalt möglicher Ausprägungen von Religiosität gefördert. Einzelne Items wurden vielfach verwendet und in weiteren Fragebogen modifiziert - auch in Deutschland (Boos-Nünning, 1972; Kecskes & Wolf, 1993, 1995; Kim, 1988). Zu keinen befriedigenden Ergebnissen führten Versuche, Dimensionen von Religiosität dadurch zu ermitteln, dass man errechnete, welche Items unterschiedlicher Fragebogen von denselben Individuen bejaht werden und darum eine Gruppe, einen Faktor bilden, der gegenüber anderen Faktoren verhältnismäßig unabhängig ist (Faktorenanalyse). Ein lehrreiches Beispiel dafür sind die aufwändigen Analysen von King und Hunt (1969, 1975, 1990), die ein Dutzend Faktoren oder Dimensionen ergaben. Solche Faktorenanalysen haben unterschiedliche Resultate erbracht. Sie laufen Gefahr, dass sie zu beliebigen Dimensionen führen, die theoretisch nicht sinnvoll gedeutet werden können.
Die Bemühungen um eine angemessene Konzeption und Messung von Religiosität haben eine Fülle von Fragebogen hervorgebracht (Hill & Hood, 1999; Huber, 1996, 2003; Koenig et al., 2001; MacDonald et al., 1999) und werden sicher weitergeführt werden. Fest steht, dass sie nicht mehr hinter die Erkenntnis zurückgehen können, dass Religiosität keine einheitliche Variable ist, sondern »so unterschiedlich und heterogen wie das menschliche Verhalten selbst« (Dittes, 1969).
KAPITEL 1
RELIGIOSITÄT IN DER VIELFALT INTRINSISCHER MOTIVE
Die religionspsychologische Forschung der letzten fünf Jahrzehnte wollte der Vielfalt, in der sich Religiosität ausprägen kann, dadurch gerecht werden, dass sie zwischen verschiedenen Orientierungen (extrinsisch-intrinsisch), Dimensionen (Ideologie, Rituelle Praxis, Erfahrung, Wissen, Konsequenzen), Überzeugungen, Einstellungen, Gefühlen und Bewältigungsstrategien unterschied. Diese Konstrukte und die entsprechenden Untersuchungsergebnisse stehen weitgehend beziehungslos nebeneinander. Das folgende Kapitel versucht, ihren inneren Zusammenhang aufzuweisen, indem es darlegt, wie bestimmte Motive, die gläubige Menschen innerhalb ihrer intrapsychischen Emotions- und Verhaltensregulation aktivieren, ihrem Glauben charakteristische Züge verleihen.
Sektion 1 diskutiert die Beweggründe, auf die Pawlow, Malinowski, die Terror-Management-Theorie, die Psychoanalyse, die Objektbeziehungs-, Bindungs- und Attributionstheorie sowie eine Ideenskizze von Allport Religiosität zurückgeführt haben.
Sektion 2 untersucht, welche Motive nach aktuellem Forschungsstand möglichst viel von der potenziellen Vielfalt religiösen Erlebens, Denkens und Verhaltens erklären können: In welchem Maß und auf welche Weise ist Religiosität verwurzelt in der (I) Bereitschaft zu moralischer Selbstkontrolle, im (II) Streben nach äußerer Kontrolle bedeutsamer Lebensereignisse und nach Belastungsbewältigung bei Angst, Frustration und Trauer, im (III) Streben nach positivem Selbstwertgefühl, in der (IV) Bereitschaft zu Dank und Verehrung, in der (V) Bereitschaft zu prosozialem Empfinden und Verhalten sowie im (VI) Interesse an weltanschaulicher Erkenntnis und logischer Kohärenz? Ein Exkurs erläutert, wie sich diese Vielfalt in den Gottesvorstellungen widerspiegelt; ein weiterer, wie sich Religiosität entwickelt.
Religiosität kann sich individuell in einer Vielfalt ausprägen, die wohl kein psychologischer Ansatz in allen ihren Aspekten zu erfassen vermag. Jede Darstellung muss sich auf bestimmte Schwerpunkte konzentrieren, und es stellt sich die Frage: Welche Aspekte, welche Dimensionen und Konstrukte können möglichst viel von der erwähnten Vielfalt auf psychologisch bedeutsame Weise beschreiben und erklären?
Kann man Religiosität konkreter verstehen, als es die Unterscheidung von extrinsischer und intrinsischer Orientierung und ihre Weiterführungen vorsehen, und kann man sie weniger statisch-beschreibend, d.h. zusammenhängender auffassen als der mehrdimensionale Ansatz von Stark und Glock (1968)? Die religionspsychologische Forschung hat in den letzten Jahrzehnten im Anschluss an diesen Ansatz und an andere Konzepte eine Reihe von Konstrukten untersucht, die letztlich isoliert und unverbunden blieben, vor allem:
• Religiöse Überzeugungen (beliefs), sei es als Zustimmung zu bestimmten Glaubensaussagen im Sinne der ideologischen Dimension nach Stark und Glock (1968), sei es spezieller als Gottesvorstellungen (god concepts, images of god), etwa nach Benson und Spilka (1973), Hutsebaut und Verhoeven (1995), Król (1982), Lawrence (1997), Noffke und McFadden (2001), Petersen (1993), Ronco, Fizzotti und Bellantoni (1995) oder Vergote und Tamayo (1981).
• Religiöse Einstellungen (s. Deusinger & Deusinger, 1996; Francis & Stubbs, 1987; Hill & Basset, 1992).
• Religiöse Gefühle (Emotionen), sei es im Sinne der Dimension »Religiöse Erfahrung« nach Stark und Glock (1968), sei es nach anderen Operationalisierungen (s. Hardy, 1980; Preston & Viney, 1986).
• Religiöse Strategien der Belastungsbewältigung (Coping), wie sie etwa Pargament (1997) und sein Arbeitskreis erforscht haben.
Vermutlich hängen diese Konstrukte innerhalb der intrapsychischen Emotions- und Verhaltensregulation (Selbststeuerung), die jedem Menschen eigen ist, eng miteinander zusammen. Wenn zur Emotions- und Verhaltensregulation eine moralische Selbstkontrolle gehört, wird sie sich an entsprechenden Verhaltensnormen, Gottesvorstellungen und Sanktionen, d.h. an »religiösen Überzeugungen« ausrichten, die der Gläubige verinnerlicht hat. Da er dabei eine Minderung des Selbstwertgefühls (Schuldgefühle) und u.U. auch die Angst vor einer Trennung von Gott sowie vor Strafen vermeiden und inneren Frieden, Übereinstimmung mit sich und Gott erleben will, wird diese Selbstkontrolle in hohem Maß von »religiösen Gefühlen« beeinflusst, die wiederum in bestimmten Motiven wurzeln.
Angelpunkt Emotionsregulation
Sofern die Emotions- und Verhaltensregulation aus religiösen Strategien der Belastungsbewältigung (Coping) besteht, aktiviert sie ermutigende oder tröstende »religiöse Überzeugungen«, um negative Gefühle wie Minderung des Selbstwertgefühls oder Angst vor der Zukunft (Kontrollverlust) durch positive »religiöse Gefühle« wie Trost und Hoffnung zu vermeiden, und wurzelt damit auch in bestimmten Motiven.
Wenn ein Gläubiger innerhalb seiner Emotions- und Verhaltensregulation religiöse Befriedigungsstrategien einsetzt, um sein Wohlbefinden aufrechtzuerhalten oder zu steigern, aktiviert er sinngebende Bewertungen der eigenen Person, des sozialen Verhaltens und des Lebens (»Schöpfung«). Diese »religiösen Überzeugungen« und Gottesvorstellungen, die positive »religiöse Gefühle« wie Selbstwertgefühl, Hoffnung (Kontrollgefühl), Sinn, Freude und Dank vermitteln, sind in entsprechenden Motiven verwurzelt, die diese Bemühungen verstärken. Wie immer man die beteiligten Prozesse der Emotions- und Verhaltensregulation sowie die religiösen Gefühle im Einzelnen auffasst, immer lassen sie nach Motiven fragen. Motive, wie sie hier verstanden werden, sind Personmerkmale und den Konstrukten »Einstellung« und »Eigenschaft« nahe verwandt. Abbildung 1 fasst den geschilderten Zusammenhang modellartig zusammen.
Zentral: Motive
Abbildung 1: Religiosität und Motive menschlicher Emotions- und Verhaltensregulation
Es empfiehlt sich also, in heuristischer Sicht das Zusammenhang stiftende Konstrukt in Bedürfnissen, Strebungen, Ansprechbarkeiten und Interessen, kurz: in Motiven zu suchen, die das Erleben, Denken und Verhalten von Menschen - im säkularen wie im religiösen Bereich - bestimmen. Aus diesem Blickwinkel wird Religiosität verstanden als die transzendenzbezogene Art, Motive zu aktivieren, die einer Person wichtig sind - nicht als »ganz anderer« Sonderbereich in ihrem Leben. So wird verständlich, dass man versuchen kann, diese Motive auch ohne den Glauben an eine übermenschliche und überweltliche Wirklichkeit, d.h. säkular zu befriedigen. Die unterschiedliche Art, wie Menschen religiös sind, könnte sich gerade aus den Gründen erklären, warum sie es sind. Eine motivationspsychologische Erklärung der Vielfalt von Religiosität lässt sich wohl auch grundsätzlich auf alle Religionen anwenden, muss also nicht christentumsspezifisch sein.
Welche Motive kommen in Frage? Was sind überhaupt Motive? Im Anschluss an Heckhausen (1989) und andere Autoren sollen hier Motive als personspezifische, verhältnismäßig konstante, situationsübergreifende - freilich auch situationsabhängige - Erlebens-, Denk- und Verhaltensdispositionen verstanden werden. Sie sind »thematisch abgrenzbare Bewertungsdispositionen« (Schneider & Schmalt, 2000, S. 15) oder - anders ausgedrückt - generalisierte Präferenzen für bestimmte Zielzustände. Da sich solche Dispositionen auf unterschiedlich hohem Abstraktionsniveau definieren und nicht scharf voneinander abgrenzen lassen, gibt es zwar keine allgemein anerkannte umfassende Motivklassifikation, doch hat die empirische Forschung dadurch beachtliche Ergebnisse erzielt, dass sie einfach einzelne Motive wie Leistungsmotivation, Machtstreben, Aggressionstendenz, prosoziales Verhalten oder Neugier untersuchte (Brandstätter & Gollwitzer, 1994; Heckhausen, 1989; Schneider & Schmalt, 2000). Welche Motive dürften nun für religiöses Erleben, Denken und Verhalten eine befriedigende Erklärungskraft aufweisen? Dazu sollen in Sektion 1 zuerst grundlegende Erklärungsversuche diskutiert werden, die in der Vergangenheit vorgelegt wurden. In einer Sektion 2 soll dann ein heuristischer Entwurf die Bedeutung einer Reihe von Motiven prüfen.
Was sind Motive?
Sektion 1
Wie viele Motive und welche? Historisch-systematische Diskussion
In der bisherigen Forschungsgeschichte wurden Hypothesen zur Entstehung und Entwicklung von Religiosität vorgelegt, die sehr unterschiedliche Motive annehmen. Dieser Denkprozess verlief ähnlich wie die geschilderte Diskussion um die Dimensionen von Religiosität: Anfangs erklärte man alle Gläubigkeit übervereinfachend monokausal aus einem einzigen Motiv, sah sich dann aber genötigt, multikausal zwei, drei oder mehr Motive anzunehmen.
I. Religiosität - ein Suchen nach Schutz?
I. P. Pawlows instinkttheoretischer Ansatz
Der bekannte russische Physiologe Iwan P. Pawlow hielt Religion für eine tief im Menschen verwurzelte und darum in der ganzen Menschheit verbreitete Neigung der höheren Nerventätigkeit (Windholz, 1986). Sie ist für ihn ein Instinkt, d.h. ein unkonditionierter Reflex, der aus dem Daseinskampf der menschlichen Spezies entstand. Als sich nämlich, so meint Pawlow, die Menschen über das Tier hinausentwickelten, erfuhren sie viele Naturereignisse als äußerst bedrohlich und erschreckend. Sie retteten sich, indem sie Religion schufen, die ihnen half, angesichts der unbarmherzigen, allmächtigen Natur zu überleben. Seither werde die Tendenz zur Religion phylogenetisch von Generation zu Generation weitervererbt. Die entsprechenden religiösen Reaktionen würden jedoch nur bei »schwachen« Menschen ausgelöst, nämlich dann, wenn sie sich den Schwierigkeiten ihrer Umgebung nicht mehr gewachsen fühlten. Ontogenetisch sei Religiosität durch natürliche Selektion bestimmt und genau vorhersagbar: Sie entwickle sich nur bei Individuen mit schwachem Nervensystem voll und zeige sich in Zeiten von situationsbedingten Krisen. Individuen mit »starker« Konstitution hingegen überwänden die religiöse Tendenz zugunsten einer rationalistischen Weltanschauung und zeigten auch bei Belastungen keinerlei religiöses Verhalten. Den Schwachen solle man indes die Religion nicht nehmen,
Bernhard Grom
Religionspsychologie
Vollst. überarbeitete 3. Auflage
eISBN : 978-3-641-03725-7
Gedruckt auf umweltfreundlich hergestelltem Offsetpapier (säurefrei und chlorfrei gebleicht)
www.koesel.de
Leseprobe
www.randomhouse.de





























