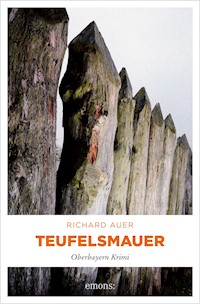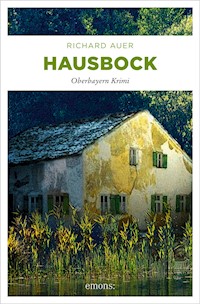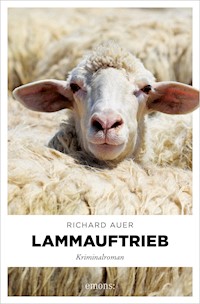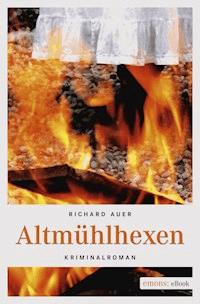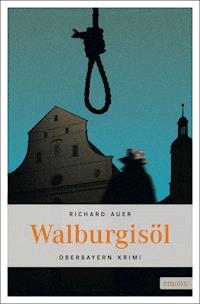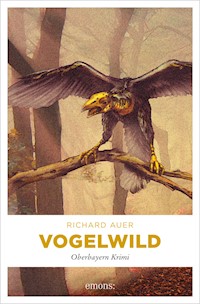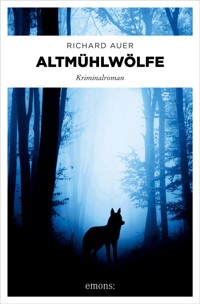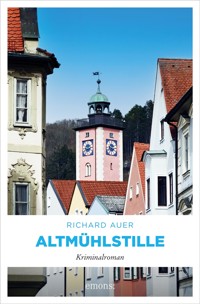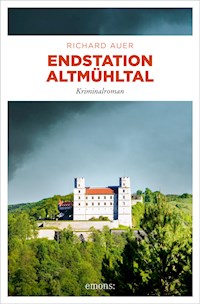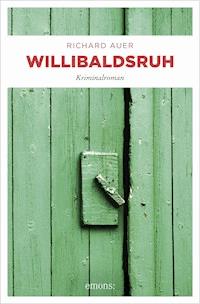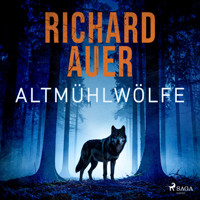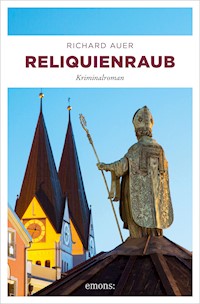
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Altmühltal
- Sprache: Deutsch
Lakonisch, ironisch, genial kriminalistisch. Regionaler geht's nicht. Entsetzen in der Bischofsstadt Eichstätt: Die fahrlässig schlecht gesicherten Gebeine des heiligen Willibald sind von einem Erpresser aus ihrem Schrein im Dom geraubt worden, und die Rückgabe endet mit dem Tod eines Mittelsmanns. Während in der Stadt Prozessionen und Sühneandachten stattfinden, nehmen die Oberkommissare Mike Morgenstern und Peter Hecht die Ermittlungen auf. Schnell müssen sie feststellen: Es ist nicht einfach, Sünder, Heilige und Scheinheilige auseinanderzuhalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 402
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Auer, Jahrgang 1965, studierte Diplom-Journalistik an der Katholischen Universität Eichstätt und hielt der Stadt auch danach die Treue. Mit seiner Frau und drei Söhnen sowie Kater Lorenzo wohnt er mitten in der barocken Altstadt und arbeitet seit über fünfundzwanzig Jahren als Lokalredakteur im Altmühltal.
www.richardauer.com
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
Lust auf mehr? Laden Sie sich die »LChoice«-App runter, scannen Sie den QR-Code und bestellen Sie weitere Bücher direkt in Ihrer Buchhandlung.
© 2020 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: lookphotos/Leue, Holger
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
Lektorat: Hilla Czinczoll
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-628-9
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Sonntag, 30. Juni
In der Familie Morgenstern hing an diesem Tag Anfang Juli der Haussegen schief, so schief, dass er knapp an der Neunzig-Grad-Marke kratzte. Und schuld daran war einzig und allein Mike Morgenstern, der Familienvorstand. Wieder und wieder verfluchte er sich für sein löchriges Gedächtnis, vor allem aber für sein miserables Einfühlungsvermögen in die rätselhafte Gedankenwelt von Frauen, speziell einer Frau: seiner Ehefrau. Ehe, das war das Stichwort und gleichzeitig der Kern des Problems.
Mike Morgenstern, Kriminaloberkommissar in Ingolstadt, im Großen und Ganzen fürsorglicher Familienvater und einigermaßen aufmerksamer Gatte, hatte seinen Hochzeitstag vergessen. Aus den Augen verloren. Verschwitzt. Versiebt. Verschusselt. Versemmelt. Versaubeutelt. Er hätte sich ohrfeigen können. Denn siehe: Es war nicht irgendein »krummer« Gedenktag, sondern ein Jubiläumstag. Ein »runder«. Es war der zehnte Hochzeitstag, und wer Augen hat zu sehen, der hätte, eingraviert in Mike Morgensterns goldenen Ehering, jederzeit das Datum nachlesen können. Fein in verspielt-verschnörkelter Schrift eingepunzt, stand dort die Dreifaltigkeit von Tag, Monat und Jahr, zusammen mit dem schönen Vornamen »Fiona«.
Ebendiese Fiona hatte an diesem Tag, zufällig auch noch ein Sonntag, diverse Vorbereitungen getroffen, um das Jubiläum in angemessener Weise begehen zu können. Sie hatte einen Familienausflug mit den Kindern nach Nürnberg geplant, mit Einkehr in der beliebten Gaststätte »Gutmann am Dutzendteich« und anschließendem Besuch im Zoo. Für die Heimfahrt ins Altmühltal, nach Eichstätt, hatte sie zur Feier des Tages sogar noch eine Stippvisite bei einem der Fast-Food-Restaurants an der Autobahnausfahrt Greding ins Auge gefasst. Entgegen ihren eigenen Prinzipien in Sachen nachhaltiger und gesunder Ernährung, so der Plan, würde sie ihren in dieser Hinsicht schrecklich gedankenlosen Söhnen Marius und Bastian samt Ehemann Mike eine Ausnahme erlauben.
Es hatte nicht sollen sein. Schon am Dutzendteich hatte Mike Morgenstern diverse Winke mit dem Zaunpfahl ignoriert, auch später im Tiergarten, als Fiona mehrmals kleine Anspielungen auf den Jubeltag gemacht hatte, war er gleichfalls mit beiden Füßen konsequent auf der Leitung gestanden, und schließlich war Fiona der allmählich dünner gewordene Geduldsfaden gerissen.
Gerade, als sich die Morgenstern-Männer im Affenhaus vor der großen Glasscheibe versammelt hatten und dem Gorillamann »Thomas« zuwinkten, zischte Fiona ihrem Gatten zu: »Du bist selber so ein Affe. Drei Stunden habe ich jetzt gewartet, dass dir einfällt, was heute für ein Tag ist. Aber da kann ich lange warten.«
Morgenstern bekam einen roten Kopf, fieberhaft überlegte er, was heute für ein Tag sein könnte. Muttertag? Geburtstag? Tag der Deutschen Einheit? Es wollte ihm einfach nicht einfallen. Bis Fiona ihm ihre rechte Hand vor die Nase hielt. Golden funkelte der Ring an ihrem Finger, und jetzt war die Botschaft so überdeutlich, dass selbst der Gorilla hinter der Panzerglasscheibe sie zu verstehen schien. Morgenstern schlug sich mit der flachen Hand auf die Stirn, und Menschenaffe Thomas tat es ihm nach. Das Publikum ringsum war begeistert.
»Unser Hochzeitstag«, seufzte Morgenstern. »Den habe ich glatt vergessen.«
Fiona sah ihn wütend an. Und dann sagte ihr Gatte den einen entscheidenden, psychologisch problematischen Satz: »Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass dir der so wichtig ist.«
»Der zehnte! Es ist der zehnte«, zischte Fiona, und dann rauschte sie ab, raus aus dem Affenhaus, quer durch den Zoo zurück auf den an diesem Tag völlig überfüllten Parkplatz, wo der hochbetagte rote Land Rover der Familie in der knallheißen Sonne stand. Als ihr Mann mit den Kindern nachkam, saß sie bereits mit vor der Brust verschränkten Armen auf dem Beifahrersitz.
Das Radiogerät hatte sie angedreht. Auf Bayern 1 dudelte »It Never Rains in Southern California« von Albert Hammond. Kein Gute-Laune-Lied, sondern ein Song darüber, dass es im vermeintlichen Sonnenschein-Staat Kalifornien fürchterlich schütten kann. Das galt nun im übertragenen Sinne auch für die Franken-Metropole Nürnberg, und auf der halben Rückfahrt war es, als würde über dem röhrenden Geländewagen permanent eine dunkle Regenwolke stehen. Die Kinder zogen die Köpfe ein und hofften, dass sich das Stimmungsgewitter verziehen würde.
Kurz vor Greding wagte Marius immerhin eine kleine Frage: »Fahren wir jetzt eigentlich noch zu McDonald’s?«
Fiona hatte schon eine ganze Weile auf ihrem Smartphone herumgetippt, und nun drehte sie sich mit eisiger Miene zu Marius um. Der wartete die Antwort erst gar nicht ab, sondern sagte zu seinem jüngeren Bruder Bastian: »Schaut nicht gut aus für uns.«
»Bedank dich bei deinem Vater«, sagte Fiona und tippte weiter auf ihrem Handy. »Aber wir fahren trotzdem in Greding raus.«
»Und was sollen wir dann da?«, wollte Bastian in aller Unschuld wissen.
»Streiche Fast Food, setze Kultur«, sagte Fiona. »Ich habe mir gerade was im Internet rausgesucht. Die haben da eine Basilika aus dem elften Jahrhundert. Die werden wir uns jetzt in aller Ruhe ansehen.«
»Aber –«, wollte Marius einwenden, doch der Vater, der bisher still geblieben war, machte nur ganz leise »Pscht!« und hob den rechten Zeigefinger vor den Mund. Sollte heißen: In der momentanen Situation schien es nicht angeraten, Fiona mit Widerspruch weiter zu reizen.
Gehorsam bog Morgenstern also in Greding von der A 9 ab, und anstatt sich dann nach rechts zu wenden, wo an die Hangflanke des Schwarzachtals diverse Fabrikverkaufszentren und Schnellrestaurants geklebt waren, setzte er den Blinker nach links, zum Ortskern des Städtchens.
Er war noch nie da gewesen. Wie Millionen anderer Menschen, die Bayern auf der Nord-Süd-Achse zu durchqueren hatten, kannte er den Ort nur wegen der Autobahnausfahrt und der gleich daneben liegenden Autobahnraststätte. Da ging es Greding nicht anders als vielen malerischen Orten entlang der deutschen Infrastruktur-Hauptschlagadern: Ihnen blieb in einer durchmobilisierten Gesellschaft nur das Nachsehen – und natürlich das immerwährende Grundrauschen einer sechsspurigen Magistrale, gegen das keine Lärmschutzmauer etwas ausrichten konnte. Denn Greding war idyllischerweise an einen sanft geneigten Hang gebaut. Unübersehbar wie jene Ortschaft, von der es in der Bibel heißt: »Eine Stadt, die auf dem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter den Scheffel.«
Nein, Greding war ein Ort, der allen Vorbeikommenden leuchtete wie ein helles Licht, und am markantesten war ganz oben am Berg eine Kirche: St. Martin. Direkt unterhalb lag die Stadtpfarrkirche. Am höchsten Geländepunkt direkt hinter der Stadt aber stand eine gewaltige militärische Anlage, die »Wehrtechnische Dienststelle für Informationstechnologie und Elektronik«, und signalisierte, dass auch das etwas verschlafen wirkende Barockstädtchen Greding den Sprung in die hochtechnologische Neuzeit geschafft hatte.
Morgenstern passierte ein Stadttor und fuhr auf gepflasterter Straße ein kurzes Stück hinauf zum Marktplatz. Hier reihte sich ein barockes Gebäude ans andere, das Rathaus, die Sparkasse, ein archäologisches Museum. Sie stellten den Wagen ab, und Fiona dirigierte ihre Familie entschlossen geradewegs bergan, einen Fußweg bis hinauf zur Basilika.
Sie war immer noch beleidigt, das war unverkennbar. Aber nachdem das Heft des Handelns nun ganz bei ihr lag, musste sie wenigstens wieder reden, und so las sie der geduldig lauschenden Familie während des Spaziergangs vom Display ihres Handys vor, was es mit dieser Kirche auf sich habe. Da war nichts, was Mike Morgenstern sich gemerkt hätte. Er war definitiv nicht der Mann, der sich für solche Dinge interessierte, aber seine Verhandlungsposition war an diesem Tag nicht so, dass er sich das hätte anmerken lassen dürfen. Immerhin konnte er sich merken, dass der Kirchturm eine verblüffende Ähnlichkeit mit den Eichstätter Domtürmen hatte. Die beiden Domtürme sah er schließlich jeden Tag, immerhin wohnte die Familie seit einiger Zeit in der Bischofsstadt.
Am Eingang des Gredinger Kirchhofs stand ein riesiger, uralter Lindenbaum, ein Naturdenkmal, wie ein Schild signalisierte, noch ein paar Treppenstufen, dann kam der Friedhof, und mittendrin ragte die Kirche in den Himmel. Unten im Tal rauschte die Autobahn, aber ansonsten war es da oben ruhig, wie in uralten Zeiten, als man sich hier vor den Feinden verschanzte, die auf jahrtausendealten Heerstraßen zwischen Norden und Süden dahinzogen. Denn die komplett erhaltene Stadtmauer, die ganz Greding mit zahlreichen Türmen umgab, verlief auch entlang der Kirchenanlage.
Morgenstern latschte in das altehrwürdige Gotteshaus und versuchte vergeblich, nicht zu gähnen. Den Kindern ging es nicht anders. Nasebohrend setzten sie sich in die nächstbeste Bank, während Fiona mit demonstrativer Kulturbeflissenheit durch die schlichte romanische Kirche schlenderte und sogar einige Fotos von diversen verblichenen Fresken machte. Nach einer schieren Ewigkeit nickte sie ihrer müden Truppe zu, und das Quartett trat hinaus ins Freie.
Morgenstern dehnte seinen Rücken und blinzelte nach Westen, in die immer noch hoch stehende Sonne. Da fiel ihm eine Kapelle mit einer weit geöffneten Tür auf, die sich an die Stadtmauer schmiegte. Ein paar steinerne Stufen führten von der Tür in ein kleines Untergeschoss. Morgensterns Neugierde war geweckt. Er trat an die Öffnung und lugte hinab. Kühle Luft kam ihm entgegen.
»Was ist denn da?«, fragte Marius. Er und Bastian hatten sich ihrem Vater an die Fersen geheftet.
»Keine Ahnung«, sagte Morgenstern und achtete darauf, dass er mit seinen Cowboystiefeln nicht auf den abgetretenen Treppenstufen ausrutschte. Seine Augen mussten sich erst an das Dämmerlicht gewöhnen.
»Iiiiiiiii!«, sagte Marius und hielt seinem kleinen Bruder, dem siebenjährigen Bastian, die Hand vor die Augen. »Nicht hinschauen«, warnte er und erreichte damit genau das Gegenteil, nämlich, dass Bastian sich losmachte und auf ein schwarzes hölzernes Gitter zuging, das diese wunderliche kleine Kapelle in zwei Hälften teilte. Und jetzt sah es auch Mike Morgenstern: Hinter dem Gitter türmten sich, sorgfältig gestapelt wie der Brennholzvorrat eines peniblen Rentners, menschliche Knochen. Tausende von beigeweißen Gebeinen. Oberschenkel, Unterschenkel, Armknochen, Speichen, Ellen – und sorgfältig darüber geschichtet bleiche Schädel. Totenköpfe dicht an dicht.
»Kinder, das ist nichts für euch«, gab der Vater zu bedenken, aber natürlich wäre jede Warnung viel zu spät gekommen. Und zum großen Glück waren die Söhne nicht etwa entsetzt, sondern nach kurzem Zögern vor allem eines: fasziniert.
»Was ist denn das?«, fragte Bastian.
Morgenstern zuckte mit den Schultern. »So was habe ich auch noch nie gesehen.« Aber eine kleine, alte Informationstafel, die an das Holzgitter geschraubt war, gab Auskunft. Die Morgensterns standen in einem Beinhaus, einem sogenannten Karner. Hier hatten die Gredinger über Jahrhunderte hinweg die Gebeine ihrer Verstorbenen eingelagert.
»Sind das alles Heilige?«, fragte Marius. »Wir haben in Reli was über die Katakomben in Rom gelernt.«
»Nein, das sind ganz normale Leute gewesen, die irgendwann gestorben sind. Und immer, wenn man jemanden beerdigt hat, hat man die alten Knochen aus dem Grab geholt«, erklärte Morgenstern. »Die sind anscheinend ziemlich lange haltbar.«
Inzwischen war auch Fiona die Treppenstufen herabgekommen, und sie war nicht minder beeindruckt als der Rest der Familie. »Schau mal, Mama, lauter Skelette«, rief ihr Marius entgegen.
»Ja dann …«, sagte Fiona und machte noch schnell ein Foto. »Gruselt es euch denn gar nicht?«
»Überhaupt nicht«, sagte Marius stolz.
»Bloß ein bisschen«, gestand Bastian und nahm Fiona an der Hand. »Aber ich bin ganz tapfer.«
»Dann gehen wir lieber wieder raus an die Sonne«, sagte Fiona. »Das sollte für heute reichen als Kulturprogramm.«
Mike Morgenstern warf noch einen letzten Blick auf die Schädel mit ihren leeren Augenhöhlen, dann bekreuzigte er sich instinktiv und murmelte etwas, das wohl eine Art von Gebet sein sollte. »Lass sie ruhen in Frieden.« Das war seine Form der Respektsbekundung vor so vielen Menschen, die schon den Weg ins Ungewisse gegangen waren, von der Welt der Lebenden hinüber ins Reich der Toten.
Morgenstern, der Mordermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt, war ein Mann, der von Berufs wegen etwas verstand von den vielen Arten, auf die dieser Übergang vonstattengehen konnte. Friedlich und in weit fortgeschrittenem Alter im Kreise seiner Lieben – wenn der Betreffende Glück hatte. Oder unglücklich, gewaltsam und vor der Zeit – dann fiel er, zumindest in der oberbayerischen Region Ingolstadt, ins Sachgebiet des Kriminaloberkommissars Morgenstern. Für Greding aber, das noch knapp auf mittelfränkischem Gebiet lag, war er nicht zuständig. Und für die uralten Toten aus dem Karner neben der Basilika St. Martin schon gleich gar nicht.
Samstag, 6. Juli
Eine knappe Woche später, an einem Samstagmorgen, als Morgenstern sich gerade wohlig in seinem Bett wälzte und sich über ein freies Wochenende freute, meldete sich sein betagtes Handy. Ein Kollege vom Kriminaldauerdienst sagte lapidar: »Arbeit für dich. Wir haben einen Toten bei dir in Eichstätt.«
»Wo?«
»In der Altmühl. Am besten fährst du gleich hin. Die Inspektion Eichstätt ist schon mit einer Streife da. Das ist noch im Stadtgebiet, gleich gegenüber von einer Agip-Tankstelle.«
»Kenn ich«, sagte Morgenstern. Er hatte erst am Abend dort getankt und bei dieser Gelegenheit eine Flasche Prosecco und einen in Zellophan abgepackten, etwas künstlich wirkenden Blumenstrauß gekauft. Das war eine von mehreren Gesten des guten Willens gewesen, die er im Laufe der vergangenen Tage bezeigt hatte, um Fiona nach dem verpatzten Hochzeitstag wieder zu versöhnen. »Was ist das für ein Toter? Weiß man schon was?«
»Nein, sie sind anscheinend noch dabei, ihn zu bergen. Er hängt im Stauwehr von irgendeinem Sägewerk.«
Es dauerte keine fünf Minuten, bis Mike Morgenstern an Ort und Stelle war. Auf dem schmalen Gelände des Sägewerks standen bereits ein Rettungswagen des Roten Kreuzes und zwei Streifenwagen der Eichstätter Polizei, außerdem ein Feuerwehrfahrzeug. Das Sägewerk lag zwischen der Bundesstraße und der Zentralbibliothek der Katholischen Universität direkt an einer Brücke über die Altmühl und einen Seitenarm. Mit dem Wasser aus diesem Seitenarm produzierte die Sägemühle eigenen Strom.
Morgenstern sah sich die Szenerie von der Brücke aus an und stand dabei direkt neben einem steinernen heiligen Nepomuk, der mit einem vergoldeten Kreuz im Arm gen Himmel schaute. Der Leichnam hatte sich offensichtlich vor dem hochragenden Hauptgebäude der Mühle in ein paar Stangen verfangen, die senkrecht in den Flussarm gestellt worden waren, um Schwemmgut aufzufangen. Inzwischen war der Tote bereits von der Feuerwehr mit Hilfe eines behäbigen Aluminiumbootes aus dem Wasser geborgen worden. Er lag jetzt am Ufer, umringt von Helfern.
Morgenstern trat hinzu und stellte sich kurz vor. Daraufhin öffnete sich der Kreis, und der Blick war frei. Morgenstern sah einen etwa fünfundfünfzig Jahre alten Mann, schmal, im schwarzen Anzug, mit schwarzen Schuhen und violetten Socken. Die kurzen silbergrauen Haare glänzten vom Wasser. Das Gesicht war kalkweiß, die Augen geschlossen. Um den Hals trug der Mann so etwas wie einen eng geknoteten Schal. Morgenstern brauchte einen Moment, bis ihm klar wurde, was er da sah. Der Mann war offenbar ein katholischer Geistlicher, und der vermeintliche Schal war eine Stola, das sichtbare Zeichen seines Standes.
Morgenstern wandte den Blick ab und schaute in die Runde. »Kennt man den Mann?«, fragte er.
Mehrere der anwesenden Männer – quer durchs Berufsspektrum – nickten.
»Also, wer ist das?«
Ein Feuerwehrler räusperte sich. »Das ist der Domkapitular Engelbert Eisengruber, den kennt fast jeder hier in der Stadt.«
Manfred Huber, der Leiter der Polizeiinspektion Eichstätt, der als einer der Ersten alarmiert worden und sofort zur Unglücksstelle geeilt war, bestätigte das: »Der Herr Eisengruber leitet irgendeine Abteilung im bischöflichen Ordinariat. Wir haben da schon angerufen, aber da ist an einem Samstag natürlich keiner da. Ich habe dann beim Generalvikar privat angerufen. Der weiß jetzt also schon Bescheid.«
»Generalvikar?«, fragte Morgenstern. »Was ist denn das für einer?«
Huber blickte Morgenstern skeptisch von der Seite an, und auch die andern schauten pikiert.
»Habe ich was Falsches gefragt?«, wollte Morgenstern wissen. »Ich bin noch nicht sehr lange in Eichstätt, ich war vorher immer in Nürnberg.«
»Wissen wir«, sagte Inspektionsleiter Huber, der Morgenstern vom wöchentlichen Volleyballtraining beim Eichstätter Polizeisportverein PSV her kannte. Da machte Morgenstern mit, um sich in seinem aktuellen Wohnort zu akklimatisieren. Aber anscheinend lag da noch ein weiter Weg vor ihm.
»Bist du katholisch?«, fragte Huber.
»Kommt drauf an«, war Morgensterns diplomatische Antwort.
Huber zog die Stirn in Falten, um zu überlegen, wie er einem derart ahnungslosen Kollegen das am besten erklärte. »Also, der Generalvikar ist nach dem Bischof der zweite Mann im Bistum. Der ist so etwas wie der Personalchef und hat die Aufsicht über die Verwaltung. So ungefähr jedenfalls. Und die Verwaltung heißt Ordinariat.«
»Aha«, sagte Morgenstern. »Und du hast also bei diesem Generalvikar angerufen.«
»Genau, bei Armin Seidl. So heißt der Mann. Und er hat den Domkapitular Eisengruber heute früh schon vermisst.«
»Wie denn das?«
»Die beiden hätten heute früh um sieben Uhr eine Messe drüben zusammen am Leonrodplatz in der Schutzengelkirche halten sollen, Eisengruber ist aber nicht gekommen. Alle haben gedacht, er hätte halt verschlafen. Kann ja mal vorkommen. Da hat sich keiner Sorgen gemacht.«
Morgenstern hatte keine Erfahrung mit Wasserleichen, aber es schien ihm, dass dieser Körper noch nicht lange in der Altmühl gelegen hatte. Wahrscheinlich nur einige wenige Stunden. Und auch die Stelle, an der der Mann ins Wasser geraten war, konnte nicht weit entfernt sein. Ob Mitglieder des Eichstätter Anglervereins die Leiche entdeckt hatten? Im ersten Morgengrauen standen sie schon an den Ufern der Altmühl, mit einer stoischen Geduld, wie man sie eher von tibetischen Mönchen kannte als von bayerischen Männern in unvorteilhaft geschnittener Camouflage-Kleidung.
Wie ihm Manfred Huber schilderte, lag am anderen Ende der Eichstätter Altstadt, gleich oberhalb des städtischen Freibads, ein anderes Wehr, das den Fluss aufstaute. Der Flussabschnitt zwischen dem Stauwehr beim Bad und dem Aumühlwehr hier war nur wenig mehr als einen Kilometer lang.
Inzwischen war auch der VW-Bus der Spurensicherung aus Ingolstadt gekommen, einschließlich eines Fotografen. Nur die Zeitung hatte bisher anscheinend noch keinen Wind von der Sache bekommen – besser so, dachte Morgenstern. Der Tod des Domkapitulars würde rasch genug für Aufsehen sorgen, daran bestand kein Zweifel.
»Und das ausgerechnet zum Beginn der Willibaldswoche«, sagte Inspektionsleiter Huber.
»Willibaldswoche?«
»Genau. Am 7. Juli, also morgen, am Sonntag, ist das Willibaldsfest, der Festtag des heiligen Willibald, und da gibt’s die ganze nächste Woche lang eine Feier nach der anderen. Man möchte fast meinen, dass die Domglocken in dieser Woche gar nicht mehr zu läuten aufhören.«
»Interessant«, sagte Morgenstern.
Dann erfuhr er, dass eigens zu diesem Anlass ganz in der Nähe, am Altmühlufer in Höhe des bischöflichen Priesterseminars, ein Festzelt für die vielen Wallfahrer aufgebaut sei. Da gebe es für die Gäste Speis und Trank und die Gelegenheit zum Plausch mit niemand Geringerem als dem Bischof Ulrich Haubner. Aber all diese schönen Tage würden nun unter dem bösen Omen des toten Domkapitulars stehen. »Da steht das ganze Bistum unter Schock«, sagte Huber.
Morgenstern konnte sich das lebhaft ausmalen. Denn es war ja unverkennbar, dass der Würdenträger nicht etwa – schlimm genug – durch einen Unfall ums Leben gekommen war, durch einen tragischen Fehltritt am Altmühlufer, durch einen Herzinfarkt beim Spaziergang, einen kleinen Schwächeanfall mit Schwindel. Nein, Engelbert Eisengruber war ohne Zweifel stranguliert und dann in den Fluss verfrachtet worden. Von wem und auf welche Weise, das musste Morgenstern herausfinden. Aber nicht allein.
Er zog sein Handy aus der Tasche und rief seinen Kollegen und bewährten Ermittlungspartner an, Kriminaloberkommissar Peter »Spargel« Hecht aus Schrobenhausen. Das stellte sich freilich als unnötig heraus, denn Hecht war fast zeitgleich mit Mike Morgenstern alarmiert worden und als Frühaufsteher sofort abfahrtbereit gewesen. Er war, als Morgenstern ihn erreichte, bereits auf der Bundesstraße 13 kurz vor Eichstätt.
Morgenstern war erleichtert. Denn auch wenn er selbst in seinem Ausweis den Religionsvermerk »römisch-katholisch« stehen hatte, so waren seine Kenntnisse über Mutter Kirche und ihre in zweitausend Jahren gefestigten Strukturen marginal, wie er eben erst beim Thema »Generalvikar« unter Beweis gestellt hatte.
Hecht hingegen hatte es nicht zuletzt dank einer frommen, inzwischen betagten Mutter immer geschafft, den »Draht nach oben« nicht abreißen zu lassen. Einmal hatte er während einer Dienstfahrt im Eichstätter Benediktinerinnenkloster St. Walburg sogar ein winziges Fläschchen »Walburgisöl« für seine Mutter besorgt, eine als wundertätig geltende wässrige Flüssigkeit, die sich zur Winterzeit am Sarkophag der heiligen Walburga sammelte. Morgenstern hatte sich damals ziemlich gewundert über die Formen der Heiligenverehrung, die auch in vermeintlich modernen Zeiten noch hingebungsvoll gepflegt wurden.
Kurzum: Peter Hecht war näher dran – und deswegen war er auch ehrlich erschüttert, als er wenig später vor dem Leichnam des Domkapitulars stand und sah, was es mit der verknoteten Stola um dessen Hals auf sich hatte. »Ziemlich makaber«, sagte er mit leiser Stimme.
Die Stola, so erklärte er seinem begriffsstutzigen Kollegen, trage ein Priester bei Sakramentenspendungen aller Art, etwa im Beichtstuhl, aber natürlich auch bei Gottesdiensten, bei der Krankensalbung, die früher mal »Letzte Ölung« geheißen habe.
Wenig später wurde Engelbert Eisengruber abtransportiert, zur Obduktion bei der Gerichtsmedizin in München.
»Und jetzt?«, fragte Morgenstern in die Runde derer, die noch herumstanden. Erst jetzt fiel ihm auf, dass es ausschließlich Männer waren. Die einzige Frau, eine Rettungssanitäterin des Roten Kreuzes, war mit ihrem Kollegen weggefahren, als klar war, dass hier jede Hilfe zu spät kam.
»Man müsste den Angehörigen Bescheid geben«, sagte Hecht – und hielt bewusst vage, wer dieser »man« denn sein sollte. Das war eine Aufgabe, um die sich niemand riss.
»Wenigstens hat er weder Frau noch Kinder«, sagte Morgenstern, und als er sah, dass ein paar Feuerwehrmänner bei diesem Satz ein schiefes Grinsen aufsetzten, hob er beschwichtigend die Hände: »Ich meine das wirklich ernst.«
»Eine Haushälterin wird er schon haben«, überlegte der Feuerwehrkommandant. »Eine Frau, die ihm was kocht und die Wäsche macht und den Haushalt führt. Wo wohnt er denn überhaupt?«
Darauf hatte spontan keiner eine Antwort.
»Und Eltern und Geschwister gibt es wahrscheinlich auch«, überlegte Hecht. »Aber wo?«
Wieder herrschte das Schweigen im Walde. Hecht drehte sich entschlossen um. »Wir fahren jetzt zum Generalvikar. Wenn man es genau betrachtet, sind diese Leute seine Familie. Im übertragenen Sinne.«
»Seine Wahlverwandtschaft«, sagte Morgenstern.
»Ehrlich gesagt wundert es mich ein wenig, dass der Generalvikar nicht sofort persönlich hierhergekommen ist«, bemerkte Huber. »Ist doch bloß ein Katzensprung.«
»Vielleicht sieht er sich nicht gerne tote Menschen an«, vermutete Morgenstern. »Ich würde es mir auch gern ersparen – noch keine Tasse Kaffee im Magen, aber schon eine Leiche vor der Nase.«
»Oder er muss das Willibaldsfest vorbereiten«, schlug ein Feuerwehrler vor.
»Wenn der Berg nicht zum Propheten geht, dann geht eben der Prophet zum Berg«, sagte Hecht. »Wir setzen uns als Erstes mit diesem Armin Seidl in Verbindung.«
Manfred Huber hatte bei seinem ersten Telefonat Seidls Handynummer erhalten, Morgenstern rief an, um sich anzumelden.
»Wir erwarten Sie in meinem Büro im Ordinariat, wir lassen den Haupteingang offen«, sagte Seidl, und die Ermittler konnten sich nun überlegen, ob er von sich im Pluralis Majestatis gesprochen hatte oder ob da tatsächlich mehrere Menschen im Ordinariat auf die Kommissare und deren Informationen aus erster Hand warteten.
***
Hecht und Morgenstern fuhren hintereinander über die Ostenstraße stadteinwärts. Quer über die Straße war ein großes Banner mit der Aufschrift »Willibaldswoche – 7.–13. Juli« gespannt. Darunter stand das diesjährige Motto: »Was das Leben reicher macht«. Einen winzigen Moment grübelte Morgenstern über dieses Thema, aber es fiel ihm nur Unfug ein. Eine Gehaltserhöhung, dachte er. Eigentlich wäre es an der Zeit, dass er zum Hauptkommissar befördert wurde. Aber hier bei der Diözese ging es gewiss eher um inneren Reichtum, nicht um schnöden Mammon.
Die Kommissare parkten ihre Autos auf dem Leonrodplatz, einem mit beigem Jurakalkstein gepflasterten Platz, der ganz und gar von kirchlichen Gebäuden aus der späten Barockzeit gesäumt war – angefangen von der hoch aufragenden weiß strahlenden Fassade der Schutzengelkirche über das bischöfliche Seminar, das Universitätsgebäude Ulmer Hof, das Bischofspalais bis hin zu mehreren Häusern, in denen die Bistumsverwaltung ihre Zentrale hatte.
An einer Ecke allerdings hatte sich doch tatsächlich die evangelische »Konkurrenz« angesiedelt, wie Hecht anmerkte: mit einem barocken Pfarrhaus und der Erlöserkirche, die aus einem für Eichstätt völlig außergewöhnlichen dunkelroten Backstein errichtet war.
Die katholischen Barockgebäude dagegen schienen wie aus einem Guss gebaut: Die Mauern hatten eine Bänderung, und an den Ecken waren fünfeckige Erker angebracht, von denen aus man den Platz und die umliegenden Straßen im Blick hatte. Die Ermittler traten durch ein doppelflügliges Holztor ins Ordinariat – ein Gebäude wie ein florentinischer Palazzo, gebaut wie die Stadtvilla einer oberitalienischen Adelsfamilie, mit einem breiten Durchgang, durch den einst auch Kutschen hatten fahren können, einem Innenhof und einem sich anschließenden großen Garten als grüne, rundum ummauerte Oase mitten in der Stadt.
Über eine edle hölzerne Treppe erreichten Morgenstern und Hecht einen mit glatt polierten Solnhofer Platten gefliesten Flur und schließlich das Büro des Generalvikars. Als Morgenstern an die mächtige Eichentür klopfte, ertönte ein sonores »Immer herein«.
Morgenstern drückte die Tür auf – und sah tatsächlich drei Männer an einem gewaltigen Konferenztisch sitzen. Offenbar den Generalvikar mit seinem schwarzen Priesteranzug. Den Bischof, den sogar Morgenstern aus der Zeitung kannte, und – das war eine echte Überraschung – den direkten Vorgesetzten von Peter Hecht und Mike Morgenstern: Kriminaldirektor Adam Schneidt aus Ingolstadt.
Morgenstern warf einen Blick hinüber zu Hecht und sah, dass dem genauso die Luft wegblieb wie ihm selbst. Was hatte das zu bedeuten?
Man schüttelte Hände, dann hatten die Kommissare am Tisch Platz zu nehmen. Morgenstern schaute vom Bischof zu Adam Schneidt. Noch ehe er fragen konnte, ergriff Bischof Haubner das Wort.
»Meine Herren, entschuldigen Sie, falls wir Sie hier etwas überrumpelt haben sollten. Aber die Sache ist für uns, für die Diözese Eichstätt, ausgesprochen heikel. Deswegen hat Herr Seidl sich die Freiheit genommen, umgehend mit Herrn Schneidt in Ingolstadt Kontakt aufzunehmen und ihn zu unserem kleinen vertraulichen Treffen zu bitten.«
Vertraulich? Morgenstern war bisher davon ausgegangen, dass das Heft des Handelns bei ihm lag. Aber das war anscheinend ein Irrtum. »Sie kennen sich?«, fragte er und schaute nacheinander Schneidt und die beiden geistlichen Würdenträger an.
Der Kriminaldirektor nickte und versuchte, dabei nicht zu hochmütig zu wirken.
Die Antwort übernahm der Generalvikar: »Herr Schneidt ist, was Sie wahrscheinlich nicht wissen, auf ganz vorbildliche Art und Weise in unsere katholische Gemeinschaft eingebunden. Er ist bereits seit einigen Jahren Ritter vom Heiligen Grab zu Jerusalem.«
Morgenstern war ratlos. »Was soll das sein?«
»Die Ritter vom Heiligen Grab sind eine sehr verdienstvolle Gemeinschaft von Laien, die sich um die Christen im Heiligen Land bemühen und ansonsten in unserer säkularen Gesellschaft als geistlicher Sauerteig wirken – ohne aber darum großes Aufheben zu machen. Man wird dazu berufen, es ist eine große Ehre.«
»Ein katholisches Netzwerk«, folgerte Morgenstern und fragte sich, wie Adam Schneidt, sein weitgehend humorloser Ingolstädter Vorgesetzter, als »Sauerteig« wirken konnte. »Sauertopf« hätte es besser getroffen. Die Sache roch für ihn nach einem elitären Honoratiorenclub. Tatsache war, dass die Informationskette unter solchen Menschen kurz war. Das würde Ermittlungen nicht unbedingt leichter machen.
»Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Kaffee, Wasser, eine Coca-Cola?«, fragte Generalvikar Seidl.
Kopfschütteln.
»Nun gut. Wir, die Diözesan-Leitung, sind, äh, vom Tod unseres Mitbruders, Domkapitular Eisengruber, erschüttert, das können Sie sich vorstellen. Wie Sie vielleicht wissen, sind wir alle hier noch nicht sehr lange in unseren Ämtern, wir hatten in den vergangenen Jahren eine Fülle von Neustrukturierungen, die auch vor dem Stuhl des heiligen Willibald nicht haltmachten.«
Seidl knetete seine schlanken, feingliedrigen Hände. »Wir sind also nicht sehr erfahren mit Krisen wie dieser. Unsere verschiedenen Vorgänger hatten da unglücklicherweise mehr Expertise. Aber ich versichere Ihnen: Sie werden von uns jedwede Unterstützung erhalten.«
Das ist ja wohl das Mindeste, dachte Morgenstern.
»Es gibt da einige vertrauliche Informationen, die wir Ihnen gleich zu Beginn geben müssen.«
Hecht und Morgenstern beugten sich auf ihren ledergepolsterten antiken Stühlen weit nach vorn, und Morgenstern konnte nicht an sich halten: »Herr Eisengruber hatte eine verbotene Beziehung?«, platzte er heraus. Und schob gleich noch eine Frage hinterher: »Frau oder Mann?«
Der Bischof sah ihn missbilligend an, überließ aber das Reden seinem Stellvertreter Seidl. Der fragte leicht empört: »Wie kommen Sie denn auf so etwas? Nein, keine Beziehung.« Er presste kurz die Lippen zusammen.
»Jedenfalls wissen wir von keiner. Und irgendwann, das kann ich Ihnen versprechen, kommen uns solche Dinge immer zu Ohren. Es wimmelt in dieser Welt von Denunzianten, die nichts lieber tun, als solchen Klatsch und Tratsch umgehend an höchster Stelle schriftlich anzuzeigen – also entweder bei mir oder gleich direkt bei unserem Herrn Bischof, was letztlich aufs Selbe hinausläuft. Aber nein, Herr Eisengruber hat sich tadellos an den Zölibat gehalten. Er ist ganz in seiner Berufung aufgegangen.«
»Was war’s dann?«, fragte Morgenstern und merkte zu spät, dass er gerade ein wenig respektlos klang. Adam Schneidt runzelte bereits gefährlich die Stirn.
»Wenn Sie mich vielleicht in Ruhe erklären lassen würden«, sagte der Generalvikar, der aus Tausenden von Gesprächen mit Untergebenen gewiss nicht gewohnt war, permanent unterbrochen oder gedrängt zu werden.
»’tschuldigung.«
»Sehen Sie: Wir haben in unserer Diözese seit zwei Wochen ein riesiges Problem. Ein Problem, von dem nur eine Handvoll Menschen weiß. Ein Problem, das wir so diskret und umsichtig wie nur irgendwie möglich beheben müssen.«
»Haben Sie wieder Kirchensteuern verzockt?«, fragte Morgenstern und biss sich noch im selben Moment auf die Zunge. Keine Sekunde später spürte er einen harten Tritt gegen das Schienbein. Adam Schneidt funkelte ihn über den Eichentisch hinweg an.
»Nein, Herr Morgenstern. Wir haben gar nichts ›verzockt‹, um mit Ihren Worten zu sprechen. Obwohl es in unserem Fall tatsächlich auch um Geld geht. Sogar um eine sehr beträchtliche, eine schmerzhaft hohe Summe.«
»Also doch«, sagte Morgenstern und rieb sich das schmerzende Bein.
Der Bischof hatte eine schmale schwarze Mappe vor sich liegen, die ihnen bisher nicht aufgefallen war. Sie bestand im Wesentlichen aus einem gefalteten Stück Pappe mit zwei Gummibändern; damit ließen sich Dokumente aller Art knickfrei ablegen und transportieren. Morgenstern kannte das von seinen Kindern: In solchen Mappen versuchten sie, am Tag vor den Ferien ihre Schulzeugnisse unfallfrei nach Hause zu bringen.
Bischof Haubner entfernte jetzt sorgfältig die beiden Gummibänder und klappte den Deckel auf. Zum Vorschein kamen mehrere Fotos und einige Blätter im A4-Format. Er nahm eines der Farbfotos und legte es mitten auf den Tisch. Morgenstern konnte das Motiv nicht gleich erkennen. Was zu sehen war, erinnerte ihn im ersten Moment an ein Aquarium mit vergoldetem, verschnörkeltem Barockrahmen und gleichfalls verschnörkeltem Deckel. Es war ein rechteckiger gläserner Kasten. Mangels Wasser war es aber doch eher ein Terrarium, und auch das war natürlich Unfug. Hinter den Glasscheiben waren kleine graue Säckchen zu erkennen.
Morgenstern zog das Foto zu sich heran. Die Säckchen waren mit Zetteln beschriftet, möglicherweise war das Latein, aber so genau war das nicht auszumachen. Dazwischen funkelten weiße Perlen. »Was ist das?«, fragte er – und sah ganz nebenbei, dass sein Kollege, der direkt neben ihm saß, schon eine Idee hatte.
Wie ein besonders gelehriger Schüler fragte Hecht: »Sind das, sind das … Reliquien?«
Bischof Haubner nickte. »Ich habe noch mehr Bilder davon. Ja, das sind Reliquien, und zwar nicht irgendwelche, wenn ich das einmal so sagen darf.«
Er nahm das Foto wieder an sich. »Was Sie hier sehen, ist der Schrein mit den Reliquien des heiligen Willibald. Der Schrein, der sich an der Westseite unseres Doms im sogenannten Willibaldschor befindet. Direkt über dem Altar. Und genau hinter der berühmten Marmorskulptur des Bildhauers Loy Hering, die unseren Bistumsgründer zeigt.«
»Dann sind in den seltsamen Säckchen also lauter Knochen?«, fragte Morgenstern.
»Diese ›seltsamen Säckchen‹, wie Sie das nennen, sind aus feinster Seide genäht. Eine unserer Benediktinerinnen aus dem Kloster St. Walburg hat sie vor vielen Jahren angefertigt. Das war Ende der 1990er Jahre, damals ist der Schrein zum letzten Mal aus dem Dom gebracht worden. Die Diözese hat seinerzeit eine umfassende wissenschaftliche Untersuchung vornehmen lassen. Von einem Anthropologen. Auf seinen Rat hin haben wir die Gebeine unseres Bistumsgründers in einem Alkoholbad reinigen und dann mit Schellack festigen lassen. Dann wurde alles aufwendig geschmückt.«
Er blickte kurz auf einen Zettel, auf dem er sich Details notiert hatte. »Geschmückt mit Perlmutt, Glas- und Granatperlen, Korallen und echter Goldspitze. Seitdem waren die Gebeine wieder an ihrem angestammten Platz im Dom.« Der Bischof nahm einen Schluck Wasser und stellte dann sein Glas bedächtig vor sich und der Mappe ab.
»Waren?«, fragte Morgenstern.
»Waren«, sagte der Bischof. Und Morgenstern verstand. Das verschlug nun sogar ihm die Sprache. Er sah Hecht und Adam Schneidt an. Hecht war genauso entgeistert wie er. Schneidt, der gut vernetzte Grabesritter, blickte staatstragend den Bischof an, ein von seiner eigenen Bedeutung ergriffener Zuhörer.
Generalvikar Seidl übernahm. »Meine Herren, wir werden bereits seit zwei Wochen, seit dem Johannistag am 24. Juni, von einem Unbekannten erpresst. Vielleicht sind es auch mehrere, das wissen wir nicht. Es ist jedenfalls gelungen, die Reliquien unseres heiligen Bistumsgründers aus dem Dom zu rauben.«
»Rauben?«, fragte Hecht. »Ein Raub? Am Johannistag?«
Der Generalvikar wog bedächtig den Kopf. »Wann das genau war, wissen wir nicht. Und es ist nicht im Wortsinne Raub. Raub würde Gewalt bedeuten. Es war Diebstahl. Jemand ist in den Dom eingedrungen, ist auf den Altar im Willibaldschor gestiegen, hat die Abdeckung geöffnet und den Schrein geplündert. Die vordere Glasscheibe ist eingeschlagen.«
Der Bischof kramte nach einem weiteren Foto. Es zeigte die Situation im Willibaldschor. Über dem Altar, in knapp drei Metern Höhe, befand sich ein großer silberner Deckel, mit goldenen Ranken umrahmt, auf dem mit gleichfalls goldenen Lettern etwas geschrieben stand.
»Ossa St. Willibaldi«, buchstabierte Hecht.
»Die Gebeine von St. Willibald«, übersetzte Generalvikar Seidl. »Um exakt zu sein: Es sind weit über hundert Knochenteile.«
»Das sind dann alle, oder?«
»Nein, die bedeutendste Reliquie ist nicht in diesem Schrein. Die Kopfreliquie ist in ein eigenes Gefäß gefasst und befindet sich sicher in einem Tresor.
»Gott sei Dank«, sagte Hecht.
»Und es gibt auch noch das rechte Schienbein in einem eigenen Behältnis in Turmform. Das ist die sogenannte Turmreliquie.«
»Haben Sie wirklich keinen Hinweis, wann das alles passiert ist?«, fragte Morgenstern.
Seidl rieb sich die Nase. »Nun ja, es kann theoretisch schon im März passiert sein. Wir hatten damals hier eine kleine Restaurierung am Altar vornehmen lassen. Dafür ist ein Gerüst aufgebaut worden, ein Goldschmied hier aus der Stadt, Herr Wiesenpaintner, hat einige Stellen neu verblecht. Das war eine Sache von einer Woche, dann war das erledigt.«
»Eine Woche im März««, folgerte Morgenstern.
»Ja. Da hatten wir hier die Handwerker. Aber das sind alles Menschen, mit denen wir oft zusammenarbeiten. Der Dieb kann auch später zugeschlagen haben. Wir wissen es einfach nicht.«
Der Bischof griff erneut nach seiner Mappe und zog ein weiteres Foto hervor. Darauf zu sehen war in aller Schlichtheit eine Plastiktüte von Aldi Süd. Ein weiteres Bild zeigte ein ganzes Sammelsurium der bereits bekannten Seidensäckchen, ausgebreitet auf einem Tisch. Wenn Morgenstern sich nicht irrte, war es ebenjener Tisch, um den sie gerade saßen.
»Wir haben vor einer Woche, am Herz-Jesu-Fest vergangenen Freitag, ziemlich exakt die Hälfte der gestohlenen Reliquien zurückerhalten«, sagte der Bischof. »Wir haben erfolgreich verhandelt.«
»Die Hälfte«, sagte Morgenstern. »Was hat Sie das gekostet?«
»Der Erpresser ist auf die üble Idee gekommen, die Reliquien in zwei Hälften aufzuteilen und uns also zweimal nacheinander zur Zahlung zu zwingen. Für die erste Charge hat er eine viertel Million Euro verlangt. Die hat er am Herz-Jesu-Fest bekommen. Was hätten wir sonst auch tun sollen?«
»Die Polizei einschalten!« Es war das erste Mal, dass sich Kriminaldirektor Adam Schneidt ins Gespräch einmischte. Die Kernpunkte der Erpressung hatte er ohne Zweifel unmittelbar vor dem Eintreffen seiner Mitarbeiter exklusiv erfahren. Die waren für ihn keine Überraschung. Aber dass die Diözese bewusst auf die Hilfe der Kriminalpolizei verzichtet hatte, rührte selbstverständlich an Schneidts Berufsehre.
Der Generalvikar sah still zum Fenster hinaus, Richtung Leonrodplatz. »Wir haben bislang gedacht, wir könnten diese Geschichte geräuschlos klären. Ohne öffentliches Aufsehen. Und es hat ja zunächst auch funktioniert.« Er machte eine lange Pause. Atmete schwer ein und aus. »Bis heute. Leider nur bis heute früh. Denn unser Vermittler, der den Kontakt zum Erpresser gehalten hat, ist tot. Domkapitular Engelbert Eisengruber. Wir sind in jeder Hinsicht erschüttert.«
»Wir auch«, sagte Hecht. »Es besteht kein Zweifel, dass wir es hier mit Mord zu tun haben.«
Der Bischof stöhnte. »Wir hatten das befürchtet. Aber bis jetzt noch gehofft, dass sich das nicht bestätigen würde.«
Morgenstern erklärte kurz, dass Eisengruber stranguliert worden war. Dann, in die aufkommende Stille hinein, sagte er: »Das war doch eine Schnapsidee, eine solche Sache ohne die Hilfe der Polizei abwickeln zu wollen.«
Auch wenn er sah, dass seinem Vorgesetzten die Wortwahl nicht gefiel, so erkannte er doch an dessen Nicken, dass er ihm inhaltlich recht gab.
»Es hat doch funktioniert«, wiederholte der Generalvikar.
»Aber dann nicht mehr«, fügte Morgenstern ungnädig hinzu. »Ihre Transaktion ist in einer Katastrophe geendet. Schlimmer geht’s nimmer. Ein Mann ist tot, das ist der GAU, der größte anzunehmende Unfall.«
Hecht deutete auf das Foto mit der Aldi-Tragetasche. »Und außerdem fehlt noch die Hälfte der Reliquien. Ihr Erpresser wird jetzt untertauchen, weil die Sache für ihn komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Und nur wenn Sie viel, viel Glück haben, überlässt er Ihnen den Rest einfach so. Mit freundlichen Grüßen irgendwo anonym hinterlegt. Aber darauf können wir uns natürlich nicht verlassen.«
»Sie müssen den Mörder unseres Herrn Eisengruber finden. Wenn Sie ihn haben, haben wir zugleich auch die Reliquien«, stellte Bischof Haubner klar. »Wobei es uns natürlich in erster Linie darum geht, dass der gewaltsame Tod unseres geistlichen Mitbruders gesühnt wird. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Das hat auch für uns Vorrang, bei allem Schmerz, den wir wegen der Reliquien empfinden. Was sage ich Schmerz: Wir fühlen Trauer, Verzweiflung, Empörung. Das ist es: Wir sind empört, dass irgendwo da draußen ein Mensch frei herumläuft, der alles, was uns heilig ist, mit Füßen tritt.«
»Aber Herr Eisengruber ist mit diesem Menschen in Verbindung getreten«, sagte Morgenstern. »Wie können wir uns das vorstellen?«
Der Bischof kramte erneut in seiner schmalen Mappe. »Ich habe hier eine Kopie für Sie. Es ist die Kopie eines Briefes, der direkt an mich gerichtet war und der hier drüben, gleich auf der anderen Straßenseite, in den Briefkasten des Bischofshauses geworfen wurde. Mein Sekretär hat das Schreiben geöffnet und gewohnheitsmäßig gleich mal den Eingangsstempel draufgedrückt – dann hat er mich sofort alarmiert.«
»Und wo ist das Original?«, wollte Hecht wissen.
»Im Bischofshaus, in meinem Tresor.«
Hecht griff sich die Kopie, und gemeinsam mit Morgenstern beugte er sich darüber. Es war nur eine Seite, ein simpler Computerausdruck. »Die allergewöhnlichste Schrift, ich vermute Helvetica«, sagte Hecht.
Auf der Seite prangte der Stempel mit dem Datum vom 24. Juni. Hecht begann murmelnd zu lesen. »Sehr geehrte Herren, wenn Sie den heiligen Willibald wiederhaben wollen, kostet das eine halbe Million Euro. Verteilt auf zwei Lieferungen. Bereiten Sie das Geld bis zum nächsten Freitag in kleinen, nicht durchnummerierten Scheinen vor. Den Übergabeort geben wir rechtzeitig bekannt. Wenn Sie die Polizei einschalten, werden Sie die Reliquien nie mehr wiedersehen!«
Hecht drehte das Blatt um. Die Rückseite der Kopie war leer. Er reichte das Papier an Adam Schneidt weiter, der es mit angemessen besorger Miene studierte.
Der Generalvikar ergriff das Wort. »Wir sind als Erstes sofort in den Dom, um die Sache zu überprüfen. Der Domkustos hat von nichts gewusst. Er war wie vom Donner gerührt. Das können Sie sich vorstellen. Er hatte den Reliquienschrein zuletzt im März bei dieser Restaurierungsarbeit gesehen. Da hat er interessehalber den Deckel abgenommen, weil man vom Gerüst aus leicht rankam, und da war der Schrein noch heil.« Seidl wischte auf seinem Smartphone herum. »Ich habe mir das Datum notiert. Am 24. März war noch alles heil.«
»Wer oder was ist der Domkustos?«, wollte Morgenstern wissen.
»Der Domkustos, der Summus Custos, ist der eigentliche Hausherr im Dom, der Chefverwalter, wenn Sie so wollen. Herr Klaus Hülsenbeck, Mitglied des Domkapitels.«
»Und dann?«
»Der Mesner hat eine Leiter gebracht, mit der wir den Schrein erreichen konnten. Domkustos Hülsenbeck hat den Schrein mit dem einzigen Schlüssel, den es dafür gibt, geöffnet. Der Schrein war eingeschlagen und geleert worden. Er war tatsächlich ganz und gar leer.« Eine lange Pause setzte ein, wohl um ihnen Gelegenheit zu geben, diesen Schock zu verarbeiten.
»Und dann?«, fragte Morgenstern ungeduldig.
»Dann haben wir uns im kleinen Kreis beraten, mit den Domkapitularen, die gerade erreichbar waren, was zu tun ist.«
»Und ich habe entschieden, dass wir auf die Forderung eingehen«, fügte der Bischof an. »Es war im Wesentlichen meine Entscheidung. Auch wenn Domkapitular Eisengruber zunächst der Ansicht war, wir sollten mit der Polizei, also mit Ihnen, zusammenarbeiten. Er hat uns ausdrücklich gewarnt, keinen Alleingang zu wagen, sondern geraten, den Fall sofort Profis zu überlassen.«
Er sah Morgenstern von der Seite an, und wenn nicht alles täuschte, war in seinem Blick eine gewisse Skepsis darüber zu erkennen, ob Morgenstern und Co. tatsächlich die ersehnten Spitzenprofiler gewesen wären.
»Eisengruber war also von Anfang an eingebunden?«
»Das hat sich so ergeben, ja. Er ist Jurist, Kirchenjurist. Wir haben mehrere davon im Domkapitel, aber er war der fähigste. Ich habe ihn sofort hinzugebeten«, sagte der Bischof. »Ich schätze seinen Rat.«
»Aber Sie haben ausgerechnet in diesem Fall nicht auf ihn gehört«, gab Morgenstern ungnädig zu bedenken. »Er wollte die Polizei rufen.«
»Ein Fehler. Mein Fehler«, räumte der Bischof ein und hob zum Zeichen seiner Zerknirschung die Hände, als wolle er sich freiwillig ergeben. »Wir haben alle Mitglieder des Domkapitels informiert. Und Domkapitular Eisengruber hat sich von Anfang an gegen einen Alleingang positioniert. Er ist ein Mann von glasklarem Verstand, und üblicherweise gelingt es ihm, seine Vorstellungen bei all unseren Beratungen durchzusetzen. Ich habe das schon sehr oft erlebt. Er ist ein Analytiker, wie es sie nur selten gibt. Seine Stimme hat Gewicht.«
Generalvikar Seidl nickte: »Er hat uns genau erklärt, welche zwei Wege wir gehen können. Beide schienen uns möglich. Er wollte den Fall an die Polizei geben. Aber ausgerechnet dieses Mal hat er sich gegen die Meinung des Herrn Bischof, die im Übrigen auch meine Meinung war, nicht durchsetzen können.«
Der Bischof übernahm wieder: »Sie wissen, dass ich noch nicht sehr lange im Amt bin. Ich bin neu hier, mein Vorgänger hat resigniert. Ich sehe es als meine Aufgabe an, für Ruhe im Bistum zu sorgen – und für gute, positive Nachrichten.
»Und dann passiert ausgerechnet so eine fürchterliche Geschichte«, sagte Morgenstern. »So viel zum Thema positive Nachrichten.«
»Ich habe Domkapitular Eisengruber klargemacht, dass die Reliquien zu wertvoll sind, um es drauf ankommen zu lassen. Wir konnten das Risiko unmöglich eingehen. Und am Ende haben wir das alle so gesehen. Auch Eisengruber.«
»Eisengruber hat sich also von Ihnen breitschlagen lassen«, fasste Morgenstern zusammen.
»Ich würde das etwas anders formulieren. Er hat sich der Mehrheitsmeinung angeschlossen. Wir haben über dieses Treffen Protokoll geführt, und Eisengruber hat darin ausdrücklich vermerken lassen, dass er sich zusammen mit zwei weiteren Domkapitularen gegen ein Handeln auf eigene Faust ausgesprochen habe.«
»Das ist ja interessant«, sagte Morgenstern. »Aber wieso hat dann ausgerechnet er die Übergabe gemacht? Das ist doch nicht logisch.«
»Sie sagen es«, gab Bischof Haubner zu. »Aber das rührt nur daher, dass Sie Herrn Eisengruber nicht kannten. Er war ein Mann mit klaren Überzeugungen und einem fast schon soldatischen Pflichtbewusstsein. Das trifft es wohl am ehesten: ein wahrer Soldat Gottes. Und deswegen hat er sich nach seiner Niederlage in der Abstimmung bereit erklärt, persönlich die Übergabe zu übernehmen. Das ist eine knifflige Sache. Es war klar, dass wir da einen Menschen mit starken Nerven brauchen.«
»Es hat sich auch sonst keiner drum gerissen«, gestand der Generalvikar. »Wenn es Eisengruber nicht gemacht hätte, wäre es wohl auf mich hinausgelaufen.« Er schüttelte sich kurz bei dem Gedanken, dass dann wohl auch er es gewesen wäre, der an diesem Morgen leblos aus dem Triebwerkskanal an der Aumühle gezogen worden wäre, und nicht der bedauernswerte Domkapitular.
»Wie dürfen wir uns die erste Geldübergabe vorstellen?«, fragte Morgenstern. »Wie ist das über die Bühne gegangen?«
Seidl zog die Schultern hoch. »Das hat komplett Herr Eisengruber übernommen. Wir haben uns bei der Liga-Bank die ersten zweihundertfünfzigtausend Euro geholt, so diskret, wie das nur möglich ist.«
»Liga-Bank?«, fragte Morgenstern.
»Ein kirchliches Geldinstitut, speziell für alle Bediensteten der katholischen Kirche. Es gibt eine Filiale hier in Eichstätt, gleich neben dem Domplatz.«
»Und Sie können da mal so eben eine viertel Million Euro in bar klarmachen?«
Der Bischof räusperte sich. »Der Bischöfliche Stuhl, ähm, also ich, ich habe einen persönlichen Verfügungsfonds. Das lässt sich relativ unbürokratisch regeln. Die Bank musste das Geld aber aus ihrer Zentrale in Regensburg holen. Und der Filialleiter hat es ins Bischofshaus gebracht. Persönlich und ohne Aufsehen. In zwei Tragebeuteln von der Caritas. Weiß mit dem Aufdruck ›Ohne Liebe ist alles nichts‹. Ich habe die Bündel nachgezählt – es waren ausschließlich Fünfzig-Euro-Scheine, immer hundert Scheine mit einer Banderole gebündelt, dann wieder zehn solche Banderolen zusammen in Plastikfolie eingeschweißt und vakuumverpackt. Die Beutel habe ich später an Herrn Eisengruber übergeben.«
Generalvikar Seidl hob den Finger. »Die Liga-Bank hat alle Scheine registriert. Es waren neue Scheine, ich kann Ihnen gleich die Auflistung der Nummern geben.«
»Sehr gut«, sagte Hecht. »Das ist doch schon mal was.« Er rechnete nach: »Eine viertel Million in Fünfzigern, das sind stolze fünftausend Scheine.«
»Die Bank hat es nachgewogen. Das ist ein Gewicht von über viereinhalb Kilo. Ein halber Wassereimer, um es profan zu sagen.«
»Da hatte Herr Eisengruber aber ganz schön zu schleppen«, meinte Hecht. »Und der Erpresser auch. Also: Wie ging die Übergabe vonstatten?«
»Wir haben eine Handynummer bekommen, unter der wir Kontakt aufnehmen sollten. Das hat Herr Eisengruber übernommen und sich als Kontaktmann vorgestellt. Der Erpresser hatte einen klaren Plan. Es musste alles ganz schnell gehen.«
»Also nochmals: Wie ist diese Transaktion abgelaufen?«
Der Bischof zog geräuschvoll die Luft zwischen den Zähnen ein: »Engelbert Eisengruber hat Weisung erhalten, das Geld in einer einfachen Tüte bereitzuhalten und weitere Anweisungen abzuwarten. Das lief dann über sein Festnetztelefon. Damit wurde er an den Fuß der Willibaldsburg beordert. Es gibt da einen alten Bierkeller der Hofmühl-Brauerei. Der liegt direkt an der Straße.«
»Und da ist er hingegangen?«
»Richtig.«
»Das wäre dann aber der Moment gewesen, wo man den Erpresser erwischt hätte!« Adam Schneidt schlug mit der flachen Hand auf die Tischplatte.
Alle anderen schauten irritiert auf ihn. Einen solchen Gefühlsausbruch hatte keiner erwartet – am wenigsten Schneidt selbst. Er wurde prompt für einen Moment rot.
»Entschuldigung, da habe ich mich jetzt wohl vergessen. Aber es ist doch nicht zu fassen, dass Herr Eisengruber mutterseelenallein ein solches Manöver durchführen muss.«
Der Bischof lächelte säuerlich. »Wir haben es hier nicht mit einem Dilettanten zu tun, das war klar.«
»Ja und?«, trieb Morgenstern das Gespräch voran.
Bischof Haubner seufzte erneut. »Es ist sozusagen der Klassiker. Am Eingang von diesem Bierkeller war ein kleines Funkgerät abgelegt. So ein lächerliches aus Plastik. Ein Kinderspielzeug.«
Generalvikar Seidl griff in seine Jackentasche und zauberte das kleine Gerät heraus. »Eisengruber hat sich das Gerät geschnappt, es eingeschaltet – und dann war der Erpresser dran. Er hat unseren Mittelsmann zur Burg hinaufbeordert, ein paar hundert Meter, da gibt es einen alten Eingangstunnel, der in den Burghof führt.«
»Den kenne ich«, sagte Morgenstern. »Dieser riesige Tunnel, wenn man mit dem Auto von der Innenstadt kommt.«
»Nein, da gibt es auf der anderen Seite noch einen zweiten, kleineren. Und als Eisengruber hingekommen ist, also zum Eingang dieses Tunnels, war da ein Gittertor, und das war abgesperrt. Weil es schon Abend war. Der Erpresser hat Eisengruber erklärt, dass er den Beutel mit dem Geld durchschieben soll. Das hat er dann getan.«
Hecht folgerte messerscharf, was dann passiert war: »Und der Erpresser ist von der Innenseite gekommen, hat sich das Geld geschnappt und ist verschwunden.« Er ließ es sich nicht nehmen, zu diesem niederschmetternden Resümee eine kleine Melodie zu intonieren. Die wohlbekannten Klänge einer Zither, gespielt von Anton Karas – das Motiv aus dem Filmklassiker »Der dritte Mann«.
Morgenstern verstand die Anspielung nicht, der Generalvikar aber sehr wohl. »Ja«, sagte er. »Das war wie bei Orson Welles damals in Wien. Weg war er.«
»Aber Orson Welles, oder vielmehr seine Figur Harry Lime, ist trotzdem geschnappt worden«, sagte Hecht. »Unser Mann leider nicht. Vorausgesetzt, es war überhaupt ein Mann.« Er dachte nach und verkündete: »Möglicherweise war das ja ganz in Ihrem Sinne. Sie wollten ihn gar nicht erwischen, um den zweiten Teil der Reliquien nicht zu gefährden.«
»Genau so war das. Aber das konnte der Erpresser nicht wissen. Er hat sich jedenfalls brav an die Abmachung gehalten. Wir haben hinterher neben dem Tor eine Nachricht gefunden, einen Zettel.«
Morgenstern erinnerte die Aktion zunehmend an eine Schnitzeljagd, wie er sie schon an mehreren Kindergeburtstagen mit seinen Söhnen in Nürnberg erlebt hatte. Da waren die Knirpse einem Zettel nach dem anderen durch die halbe Stadt gefolgt – der zu findende Schatz lag fast jedes Mal irgendwo im Haus des Geburtstagskindes im Keller. Man hätte also clevererweise gleich am Anfang mal auf Verdacht dort nachsehen sollen und sich damit die ganze Lauferei vielleicht ersparen können.
Wieder zauberte der Bischof aus seiner Mappe eine Kopie des Zettels. Ein DIN-A4-Blatt in einer Klarsichtfolie mit einem einzigen aufgedruckten Wort: »Cobenzl-Loch!«