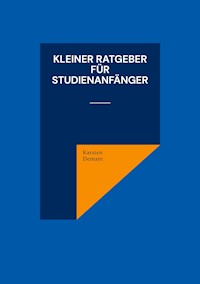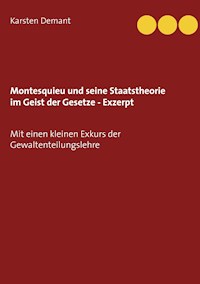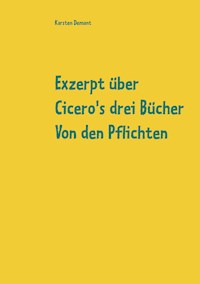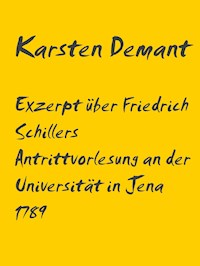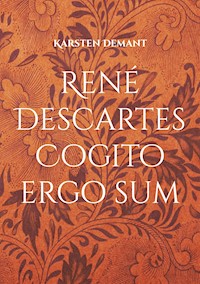
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein Rationalist, der die Welt verbessern und die Sprache der Vernunft liebte, der mit den bestehenden gesellschaftlichen Zuständen unzufrieden war, das war René Descartes. Idealist mit seinem Dualismus von Körper und Seele, Materialist in Ansätzen seiner Gedanken der Natur gegenüber. Sein "Cogito, ergo sum (Ich denke, also bin ich)", was er als unbezweifelbar sah, war der Vater einer neuzeitlichen Denkweise. Diese Ausarbeitungen seiner philosophischen Werke sind für den interessierten Leser ein Einblick in seine Gedanken und Gefühle. Derbe gesellschaftliche Veränderungen mochte er nicht, trotz seines Widerspruchs zwischen Erkenntnis- und Morallehre. In der Aneignung von Wissen sah er die Grundlage für das spätere Leben eines Menschen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
René Descartes
Rene Descartes ist am 31. März 1596 in La Haye, Touraine geboren und am 11. Februar 1650 in Stockholm gestorben. Er galt zu seiner Zeit als einer der größten Philosophen, Mathematiker und Physiker. Seine Weltanschauung wurde besonders durch die Lehren von Nikolaus Kopernikus (1473 - 1543), Giordano Bruno (1548 - 1600) und Galileo Galilei (1564 - 1642) geprägt. Er versuchte das Denken neu zu begründen, welches auf die Vernunft ausgerichtet ist. Damit verlässt er den Weg vom mittelalterlichen, feudalistischen religiösen Denken. Es war für ihn ein Weltbild, was nur auf den Glauben beruhte.
Descartes war tiefster Dualist. Er ging grundsätzlich von zwei voneinander unabhängigen, nicht ableitbaren ewigen Substanzen aus, wo es eine materielle Substanz (res extensa) und eine geistige Substanz (res cogitans) gibt. Im Jahre 1617 trat er freiwillig in den Kriegsdienst ein und nahm am 30-jährigen Krieg (1618 - 1648) teil. An den Feldzügen in Böhmen und Ungarn war er mit beteiligt. Seine naturwissenschaftlichen Studien hat er ca. 1625 abgeschlossen. Das war für ihn der Beginn, sich dem Menschen "an sich" zuzuwenden. Ganz besonders interessierten ihn Fragen über das moralische Verhalten und die Stellung in der Natur. Alles Fragen, die die kommenden Philosophen zum Gegenstand ihrer Untersuchungen machten. Erkenntnistheoretisch blieb er auf den Boden des metaphysischen Idealismus. Er hat viel daran gesetzt, die Existenz Gottes mit Ansätzen einer wissenschaftlichen Methode beweisen zu können. Deshalb ist es interessant, seine Zeit etwas genauer zu betrachten. Auf der einen Seite reflektiert er die ökonomisch im Kommen erstarkende Bourgeoisie in Europa, andererseits machte er politische Zugeständnisse an den Feudalabsolutismus, dem allmächtigen Klerus. Trotz seiner Inkonsequenz ist die Grundrichtung seines philosophischen Systems mechanisch materialistisch.
René Descartes geschichtliche Wirksamkeit
Descartes gilt als Begründer einer neueren, modernen Philosophie. Eines von der Vernunft überzeugten moderneren frühneuzeitlichen Rationalismus. Das Denken sollte durch die Vernunft neu begründet werden. Ein Abwenden vom mittelalterlichen religiösen Denken, dessen Weltbild auf den Glauben beruhte. Die Scholastik, diese mittelalterliche Philosophie, die Glaubenswahrheiten der Religion als Vernunftsprinzip nachweisen wollte, stand man immer skeptischer gegenüber. Das Denken wurde jetzt zum Prinzip erhoben und nicht der Glaube. Dieses philosophische Denken von René Descartes wurde kritisch-konstruktiv von Spinoza, Leibniz, Kant und Hegel übernommen und modifiziert. Eine andere philosophische Linie, die der von Descartes gegenüber stand, war die baconsche Erfahrungsphilosophie, die von Hobbes, Locke und dem französischen Materialismus des 18. Jahrhunderts.
Konkret-historische Bedingungen zu Descartes Zeit
Es war die Zeit Ludwigs XIV. Das Papsttum verlor an internationaler Bedeutung. Dem damaligen allmächtigen Klerus (Feudalabsolutismus) stand eine ökonomisch erstarkende Bourgeoisie gegenüber, die sich von der Kirche abwandte. In den letzten 100 Jahren hatte man große Entdeckungen in allen Gebieten der Natur gemacht. Man hat durch die Beobachtung und dem Nachdenken Naturgesetze herausgefunden. Durch diese rasante Entwicklung in den Erkenntnissen schien den Menschen nichts mehr unmöglich. Die damaligen vorherrschenden scholastischen Ansichten wurden verworfen und man ist zur Beobachtung des Seienden übergegangen. Es war eine Zeit, wo der Zweifel tief verwurzelt war und man sich nach Sicherheit sehnte. Statt Nachdenken und Beweis sind Schläue und Macht das Ausschlaggebende in der politischen Gesellschaft. Geistige Ziele dienten dem Zweck einer Privilegierung teilhaft zu werden. Ein praktisch bewegender Geist aus der Philosophie und der geschichtlichen Entwicklung der Menschheit ist nicht zu erkennen stattdessen nur gelehrte Unterhaltungen. Die Wissenschaft mit Kopernikus und Galilei löste sich von der religiösen Bevormundung. Alles wurde jetzt hinterfragt, ob das stimmt, was die Kirche erzählt. Galilei fordert die Freiheit der Wissenschaft mit einer unverfälschten Erkenntnis der Welt. „Die Natur ist das aufgeschlagene Buch, in dem jeder lesen und lernen kann, der die rätselhafte Schrift zu entziffern vermag.“ Descartes kam aus keinen ärmlichen Verhältnissen, so das man davon ausgehen kann, dass sein Rationalismus (cogito ergo sum) sich an das bürgerliche Individuum richtete mit einem zugespitzten Moralintellektualismus. Er sieht die Wissenschaft nicht als Privilegierung, sondern als eine Veränderung im Sinne der Menschen. Er zog sich zurück, den mit einer steigenden Position und dem Gefallen an deren Genuss sinkt die Leistungsfähigkeit.
Sein Rationalismus
Descartes möchte einen Neuanfang in den wissenschaftlichen Betrachtungen, die über jeden Zweifel erhaben sind. Er hatte genug von der mittelalterlichen Wissenschaftsauffassung. Jede Wissenschaft war der Theologie untergeordnet. Eine neue Form wissenschaftlicher Rationalität sollte her, die wissenschaftlich begründet werden kann, wo Philosophie und die Wissenschaft auf ein neues und sicheres Fundament gestellt werden. Damit fängt er an, alles in Zweifel zu setzen. Er bezweifelt alle unsicheren Erkenntnisse, um somit einen absolut sicheren Anfang zu finden. Mit „Ich denke, also bin ich“ ist er der Meinung, diesen absoluten Anfang gefunden zu haben, aber nicht in der Theologie, sondern im „Ich-Bewusstsein“ oder im Selbstbewusstsein. Dies geschieht, indem er an den sinnlichen Eindrücken zweifelt, an der materiellen Welt überhaupt. Damit löst sich das „Ich“ aus dieser Welt heraus. In der Wissenschaft darf aber der Zweifel nicht fehlen. Er dient der Wissenschaft zu Korrektur eines noch nicht ausgereiften Wissens und mit dessen Hilfe Theorien bearbeitet und weiterentwickelt werden. Das ist ein Hauptmangel von Descartes, indem er den prinzipiellen Zweifel aus der Entwicklung der Wissenschaft herauszieht. Alles jedoch, auch der Zweifel ist bestimmt von den Zusammenhängen der materiellen Welt. Und genau das ist das Problem bei Descartes, welches er auch weiß, aber er kann die Frage nicht beantworten, wie das wissenschaftliche Subjekt zu seinen Gegenständen gelangt. Zur Beantwortung dieser Frage nimmt er Gott. Mit ihm stellt er einen Übergang her. Gott verknüpft das denkende „Ich“ mit seinen Gegenständen. Gott ist unendlich und durch seine Allmacht kann Gott alles Schaffen, was das „Ich“ denken kann. Gott ermöglicht eine Erkenntnis der Welt.
Rationalismus ist eine erkenntnistheoretische Richtung, wo die Vernunft und das abstrakte begriffliche Denken als Hauptquelle der Erkenntnis gelten. Sichere Erkenntnis ist aber nur das, was der denkende Verstand in klaren Begriffen ausdrücken kann. Es werden Erkenntnisse aus dem reinen Denken hergeleitet. Der Verstand ist somit in der Lage zu erkennen und stellt eine eigenständige Quelle substanzieller Erkenntnis dar. Ganz charakteristisch ist hier die Lehre von den angeborenen Ideen, die nicht aus der menschlichen Erfahrung stammen. Das geht bis in die sittlichen Prinzipien und Normen hinein. Das sittliche Verhalten des Menschen wird aus der Vernunft erklärt.
Fazit:
Man versucht die Natur des mathematischen und theoretischen Wissens in den Naturwissenschaften zu erklären. Denken und Handeln ist rational, wenn es vernunftgemäß und begründet ist.
René Descartes Zeitgenossen
Galileo Galilei 15. Februar 1664 in Pisa – 29. Dezember/8. Januar 1642 in Arcetri bei Florenz, war ein italienischer Universalgelehrter
Francis Bacon 22. Januar 1561 in London – 9. April 1626 in Highgate bei London, war ein englischer Philosoph, Jurist und Staatsmann
Johannes Kepler 27. Dezember 1571 in Weil der Stadt – 15. November 1630 in Regensburg, war ein deutscher Naturphilosoph, Mathematiker, Astronom, Astrologe, Optiker und evangelischer Theologe
Hugo Grotius 10. April 1583 in Delft – 28. August 1645 in Rostock, war ein politischer Philosoph, reformierter Theologe, Rechtsgelehrter und Aufklärer
John Selden 16. Dezember 1584 in Salvington, Sussex – 30. November 1654 in Whitefriars, war ein englischer Universalgelehrter
Antoine Arnauld 5. Februar 1612 in Paris – 8. August 1694 in Brüssel, war ein französischer Philosoph, Linguist, Theologe, Logiker und Mathematiker
Werke von René Descartes
1. Musicae compendium 1618
2. Regulae de la Méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences 1637 (Von der Methode des richtigen Vernunftgebrauchs und der wissenschaftlichen Forschung) Anhänge: Dioptrique, Meteorologie, La Géométrie
3. Meditationes de prima philosophia 1641 (Meditationen über die Grundlagen der Philosophie – eines der Hauptwerke des Rationalismus)
4. Principia philosophiae 1644 (Die Prinzipien der Philosophie)
5. Inquisitio veritatis de l´âme 1647
6. Les Passions de l´âme 1649 (Die Leidenschaften der Seele)
7. De homine posth. 1662
8. Le Monde de Descartes ou le traité de la lumieré (1632/1633) 1664 veröffentlicht
Begriffsübersicht seiner Philosophie und Definitionen
Wesentliche Elemente seiner Physik
Sie handelt vom Körper und den mechanischen Bewegungsgesetzen, die Körperwelt (materielle Substanz) existiert ewig und unendlich.
Descartes reduziert die Ausdehnung auf den mathematischen Raum oder den Raumgrößen. Das Denken ist das Attribut der geistigen Substanz, demzufolge ist die Ausdehnung nach Abzug der sinnlichen Eigenschaften, dass Attribut der körperlichen Substanz. Die Bewegung zählt er nicht dazu. Sie ist wie die Körpergestalt ein Modus der materiellen Substanz. Durch die Unendlichkeit der Bewegung und ihren Erscheinungsformen zieht er den Schluss, dass die Bewegung von einem Zustand in einen anderen übergehen und damit verändern kann, die Größe (Quantum) der Bewegung jedoch in der Natur konstant bleibt. Für ihn ist es das Gesetz von der Unzerstörbarkeit der Materie und ihrer Bewegung. Trotzdem gibt es materielle Ansätze. Die in diesem Gesetz erfasste universelle physikalische Bewegung ist zugleich auch die Realisierung der materiellen Einheit der Welt. Das Universum wird aus sich selbst erklärt, so wie bei ihm das sittliche Verhalten des Menschen aus ihm selbst erklärt wird. Er leitet diese Dinge aus seiner natürlichen Beschaffenheit ab.
Absolut sicheres Wissen
Wann irrt der Mensch? Wenn er in seinem Bewusstsein eine Vorstellung oder Meinung hat, dass etwas so oder so sei, was aber außerhalb seines Bewusstseins gar nicht so ist, wie er es sich vorstellt. Hier irrt der Mensch in der Sache. Ein weiterer Irrtum tritt ein, indem er der Meinung ist, dass er sich nicht irrt. Weiterhin ist es möglich, dass der Mensch weiß, dass er sich geirrt hat, aber nicht weiß, worin er sich geirrt hat. Stimmt allerdings die Meinung mit der Realität außerhalb meines Bewusstseins überein, nennt es Wissen. Von Täuschung redet man, wenn es keine Übereinstimmung mit der Wirklichkeit gibt. Ist die Täuschung allgemein, dann ist die Wissenschaft auf den falschen Weg. Eine wissenschaftliche und rationale Methode muss sich auch rational begründen und ableiten lassen.
Eine solche Ableitung wissenschaftlicher Rationalität versucht Descartes in seinen „Meditationen über die Philosophie“ zu geben. Es ist eine wissenschaftliche Begründung wissenschaftlicher Rationalität. Die Einzelwissenschaften verfahren nicht rational, da sie ihre Methoden selber nicht rational ableiten. Deshalb bedarf es der Philosophie. Für Descartes befindet dich die mittelalterliche Wissenschaft auf einen unwahren Weg. Deswegen bedarf es eines Neuanfangs.
Wahrheitskriterium (Erkenntnistheorie)
Das Wahrheitskriterium legt Descartes in seinen „Meditationen de prima philosophia“ 1641 (Meditationen über die Grundlagen der Philosophie) sehr eindrucksvoll dar. Es zählt zu den Hauptwerken des Rationalismus. Alles, was klar und deutlich gedacht und eingesehen werden kann, wie die eigene Existenz als denkendes Wesen existiert ebenso gewiss und objektiv wie ich selbst. „Gewiss war ich da, wenn ich mich von etwas überzeugt habe.“ Ich bin und ich existiere ist, wenn ich es im Geiste auffasse, notwendig wahr. Was ich klar und deutlich einsehe, ist wahr. Klarheit und Deutlichkeit sind die Kriterien, das etwas wahr ist. Das wahre Wissen kommt aus dem klaren und deutlichen Denken. Diese Erkenntnis bezieht er nicht auf die Naturwissenschaften. Ich bin ein denkendes Wesen mit Intuitionen, die so einfach sind, dass man sie nicht abweisen kann. Diese Klarheit gibt es nicht durch empirische Forschung, sondern durch Denken. Deutlich sind die Gedanken, wenn sie hinreichend voneinander getrennt sind. Alle Grundsätze muss man ablegen und durch die Vernunft bessere setzen, damit ist man in der Lage, ein besseres Leben erreichen zu können. An diesem Punkt sind wir bei der Moral, Ethik und Sitte angelangt. Das Individuum muss sich im Sinne des Allgemeinwohls selbst kontrollieren.
Bezogen auf Gott: Alles was in uns ist, kommt von ihm. Sofern unsere Vorstellungen dunkel und verworren sind, kann das nur an unserer eigenen Unvollkommenheit liegen. Unvollkommenheit ist aber ein Mangel an göttlicher Herkunft. Unsere klaren und deutlichen Vorstellungen kommen ganz von Gott. Das Klare und Deutliche muss wahr sein, da Gott sonst nicht vollkommen wäre.
Dualismus (Der Geist wird über die Materie gestellt)
Man geht von der Existenz Zweier miteinander wechselwirkender, voneinander verschiedener „Substanzen“ aus. Geist und Materie. Descartes teilt das Seiende in die res extensa und res cogitans. Eine Objektwelt (Leib und Körper) und eine Gedankenwelt (Seele und Geist). Für Descartes stehet fest, es gibt zwei voneinander unabhängige, nicht ableitbare ewige Substanzen, eine materielle Substanz und eine geistige Substanz. Das „Ich“ ist eine denkende Sache.
Materie ist ausgedehnt, aber wiederum nicht denkend. Diese beiden Dinge sind vollständig getrennt.
Nur der reine Gedanke zählt. Das „Ich“ im Bewusstsein verliert theoretisch den Kontakt mit dem nicht denkenden Wesen. Das Gehirn erzeugt den Kontrast zwischen Außenwelt, Körper und mentalen Sphäre. Das Problem ist der Widerspruch Mensch und Vernunft.
Mensch (körperliche Substanz) – Vernunft (geistige Substanz).
Dieser Dualismus führt zur Frage nach der Verbindung zwischen diesen radikal unterschiedlichen Seiten. Descartes sieht hier den Übergang in einer von Gott gefügten Verbindung über die Zirbeldrüse.
Substanzen
Drei grundsätzliche Arten von Wesenheiten:
Nicht ausgedehnt: Ich – Denken – Seele
Ausgedehnt: Glas – Rotwein – Farbe – Flüssigkeit – Gefäß (Glas)
Zur klaren und deutlichen Idee einer körperlichen Substanz gehört die Ausdehnung, res extensa.
Res extensa: Physischer Körper, hat Ausdehnung, ist teilbar, zerstörbar, unterliegt den Regeln der Kausalität und existiert ewig und unendlich. Der Mensch ist körperliche Substanz und funktioniert wie eine Maschine.
Res cogitans: Ist ausdehnungslos, unteilbar, unsterblich.
Denken, auch im Zweifel. Geist – Materie
„Es gibt außerhalb meines Geistes materielle Dinge, die Eigenschaften haben, die ich klar und deutlich von ihnen erkenne: Ausdehnung, Gestalt, Größe, Zahl, Ort und Zeit. Dies sind alles Gegenstände der Geometrie und Mathematik.
Naturphilosophie: Alle Substanz besitzt Ausdehnung, deshalb könne es keine Atome und kein Vakuum geben. Bewegung erfolgt durch Kontakt, durch Druck und Stoß anderer Körper. Alle tierischen und unbewussten Bewegungen werden durch unbewusste Mechanismen kontrolliert, durch einen Automatismus im Lebewesen. Modell des Menschen als Maschine, was aus einem physikalischen Körper und einer rationalen und unsterblichen Seele besteht.
Ich denke, also bin ich (Cogito ergo sum)
Er hat festgestellt, dass man sich wahnsinnig täuschen kann. Die Täuschung kann richtig und falsch sein. In einem aber täuscht er sich nicht, nämlich, dass er es ist, der gerade denkt. Selbst wenn er denkt und er läge falsch, ist es ihm ganz gewiss, dass er es ist, der gerade denkt und darum existieren muss. Ich denke, also bin ich, ist das Fundament, das er im Augenblick des Denkens existiert. Alles, was intuitiv gesehen und klar ist, existiert ebenso gewiss und objektiv wie ich selbst als denkendes Wesen. Er zweifelt an allem. Zweifel ist Denken. Ich zweifle, also bin ich.
Gibt es irgendetwas, was er nicht bezweifeln kann? Woher wüsste er dies und woher kommen die Vorstellungen? Stammen sie von ihm oder vom sogenannten Täuschergott, um ihn zu täuschen? Er kann mich so lange täuschen, wie er will, ich kann so lange Zweifeln wie ich will, aber eines ist mir gewiss, dass ich bin und existiere. Damit ist er und seine Existenz notwendig wahr. Ein Zweifel braucht immer einen Zweifler. Damit hat Descartes einen Gegenstand gefunden, was ihm sicheres Wissen erlaubt, nämlich sich selbst. Sein „Ich“ ist der erste wahre Gegenstand, der ihm unmittelbar gegenwärtig ist. Er ist da und existiert.
Wer ist aber das „Ich“? Der Körper gehört nicht dazu, den er ist bezweifelbar. Der Mensch auch nicht, da er aus Leib und Seele sich zusammensetzt. Die Seele im eigentlichen Sinne auch nicht, da sie in ihrem Sein auf den Leib bezogen ist. Ebenso wird die Seele als Empfindung gesehen, da sie in Beziehung auf körperliche Dinge dem Zweifel verfallen ist.
Wie steht es mit dem Denken? Denken ist das Moment der Seele, was nicht auf Sinnliches bezogen ist. Solange wie ich denke, solange bin ich. Das, was ich bin, darf nicht aus dem Bewusstsein kommen. Was ich bin, muss unbezweifelbar sein, wie die Existenz des Ich's. Ich kann also nur bestimmt werden als ein denkendes Ding. Was ist ein denkendes Ding? Das „Ich“ unterscheidet sich von der Welt der sinnlichen und der intellektuellen Dinge, die es im Zweifel als nicht existierend setzt. Das „Ich“ unterscheidet sich von allem anderen Dingen (sinnlichen und intellektuellen Dingen), was man sich nicht bildlich vorstellen kann. Es ist bei Descartes kein Gegenstand der Einbildungskraft oder Fantasie, sondern es ist ein intellektuelles Ding. Das „Ich“ ist der einzige Gegenstand des Denkens, auf den der Zweifel nicht anwendbar ist. Ich kann nichts klarer und deutlicher erfassen als meinen Geist, weil ich von ihm die erste zweifelsfreie Erkenntnis habe, solange ich denke, bin ich.
Das „Ich“ muss mit einem Gedanken verbunden sein. Ich denke, also bin ich ist das Fundament, das ich im Augenblick des Denkens existiere. Descartes zweifelt an allem. Zweifel ist Denken. Zur Erkenntnis gelangt man durch Zweifel. Man kann alles anzweifeln, außer das man zweifelt. Alles, was intuitiv gesehen und klar ist, existiert ebenso gewiss und objektiv wie ich selbst als denkendes Wesen. Geistig kann ich nur denken. Dieses Denken erfasst den Gehalt, um den es geht. Der Geist wird über die Materie gestellt.
Cogito ergo sum ist die unbezweifelbare Gewissheit, wo Inhalte klar und deutlich dem Selbstbewusstsein gegeben sind. Fragwürdig das Sein der Außenwelt und die leibliche Existenz (Traum). „Mag alles, was ich mir vorstelle oder zu erkennen glaube, fragwürdig sein, so existieren doch meine Vorstellungen von diesem Gegenstand und damit auch ich.“
Charakteristisch für seine Methode ist die Abstraktion. Dieses analytisch-synthetische Schlussverfahren ist die logische Methode des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten.
Ich bin ein denkendes Ding – Descartes Gedanken
Man kann an den unmittelbaren Wahrnehmungen zweifeln, da ich nie durch sichere Merkmale den Schlaf vom Wachzustand unterscheiden kann. Was gibt mir die Gewissheit, dass ich in diesen Moment nicht im Bett liege und alles nur träume? Selbst wenn ich getäuscht werde, kann es nur zwischen Denken und Gegenstand meines Denkens treten, aber niemals zwischen meinem „Ich“ und meiner Denktätigkeit. Unbezweifelbare Tatsache ist, ich denke, also bin ich. Das ist eine unumstößliche Gewissheit, die mir niemand nehmen kann. Nur der reine Gedanke zählt, das heißt, mit den reinen Gedanken kann ich die Welt erkennen. Das Wissen kommt aus dem klaren und deutlichen Denken. Es ist also etwas, was absolut sicher ist, ich denke. Ich bin ein denkendes Wesen. Die Grundlage allen Denkens sind klare und deutliche Gedanken. Es sind Intuitionen, die so einfach sind, dass man sie nicht abweisen kann. Klarheit gibt es nicht durch empirische Forschung, sondern nur durch Denken. Deutlich sind die Gedanken, wenn sie hinreichend getrennt sind.
Beispiel: Ein Buch ist ein Gegenstand. Ich kann das Buch unterscheiden zwischen Farbe und Gegenstand. Ich habe somit Farbiges und Ausgedehntes. Es sind zwei Aspekte dieses Gegenstandes, die hinreichend getrennt sind. Es wird alles so weit durchdrungen, bis nichts mehr fragwürdig erscheint. Ein Schauen bis auf den Grund, wo es nicht mehr weiter geht.
In der Selbsterfahrung begreift es sich als denkendes Wesen. Der Mensch erfährt (Kenntnis) sich als denkendes Wesen in einer Welt, in der es ausgedehnte Substanzen gibt. Ich bin ein denkendes Ding im Unterschied zu den Körpern als ausgedehnte Dinge (Dualismus).
Materielle Substanz – geistige Substanz
Der Zweifel
Descartes geht davon aus, dass mit Sicherheit die Sinne den Menschen täuschen können. Da er aber nur richtige Aussagen über die Welt zulassen und finden will, ist es nötig, an sein bisheriges eigenes Weltbild zu zweifeln. Er ist bemüht, ein grundlegendes sicheres Wissen aufzubauen. Es soll eine Wissenschaft der Wahrheit sein. Ihm ist bewusst, dass er sich sehr häufig geirrt hat und viel Falsches gelernt hat. Er weiß genau, dass man nicht jede einzelne Aussage bezweifeln kann, da dies zu keinem Ende führen würde. Was er aber für unerlässlich hält, ist die Prüfung jener Grundlagen, auf die sich alles aufbaut. Die erste Grundlage unseres Wissens bilden die menschlichen Sinne, und da sie Sinne uns täuschen können, sind sie nicht zweifelsfrei. Ist man sich einer Sache unsicher und hat Zweifel, so hat man seine Zustimmung zurückzuhalten. Hat man Zweifel, ist ein Bestreben zur Korrektur sichtbar, um zu wissen, ob man richtig oder falsch liegt, was wiederum durch die Sinne geschieht. Jedoch nicht bei Descartes. Er träumt oft Dinge, die es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Da kommt ihn der Gedanke, dass unsere ganze Sinnenwelt nur ein Traum gibt. Doch Träume sind in Zweifel zu ziehen und damit auch die Welt, die er bis hierher als existierend betrachtet hat. Doch eine Sache ist beim Zweifel unbestreitbar. Wer zweifelt, muss existieren. Zweifel ist denken und wer denkt existiert. Ich denke, also bin ich.
Sinnestäuschung
Meine Sinne können mich täuschen. Gemeint sind Dinge außerhalb meiner Vorstellung oder Gedanken. Was gibt mir aber die klare Gewissheit, dass meine Erkenntnisse, die ich aus der Wahrnehmung beziehe, nicht doch allesamt zweifelhaft sind, also mich optisch täuschen. Was kann man aber gegen diese direkte Wahrnehmung schon ernsthaft einwenden, wenn ich daraus zweifeln würde, dass ich gerade hier sitze und das hier lese?
Traum
Aber auch an den unmittelbaren Wahrnehmungen kann man zweifeln. Ich kann schließlich nie durch sichere Merkmale den Schlaf vom Wachzustand unterscheiden. Was gibt mir die genau Gewissheit, dass ich in diesen Moment nicht eigentlich im Bett liege und alles nur träume? Doch gibt es Abbilder von den Sinnen, von Eigenschaften wie die Ausdehnung von Körpern, der Räumlichkeit, Zeit, Anzahl (Mathematik), die allein aus der Vernunft entspringen.
Seele und Leib
Die Seele ist die höchste Eigenschaft der Willensfreiheit und steht mit dem Körper in einer unmittelbaren Beziehung. Descartes war ein Verfechter der Zweiteilung von Körper und Seele in getrennten Entitäten. Körper und Seele bilden trotz Trennung eine Einheit. Nach Descartes steuert das Gehirn als oberste Instanz den Körper. In der Medizin begegnet man heute noch eine Trennung von psychischen und physischen Beschwerden und Therapien. Es ist keine absolute Trennung, da man weiß, dass alles in einem wechselseitigen Einfluss steht und eine organische Einheit bildet. Selbst im herkömmlichen Sprachgebrauch sitzt noch teilweise ein Dualismus in uns. Man will sich etwas von der Seele oder einem ist eine Last von der Seele gefallen.
Weit vor der Zeit von Descartes sah man den Körper als Sitz der unsterblichen Seele an, wo der menschliche Körper nur seine Hülle sein soll. Descartes betrachtet jedoch den menschlichen Körper als eine Maschine an, die vom Gehirn aus gesteuert wird. Er nennt es res extensa. Die Welt des Körperlichen besteht aus kleinsten Teilchen und hat eine definierte Ausdehnung. Daher wird der Körper in der Metaphysik als ausgedehnt betrachtet. Der Körper ist nicht in der Lage, das Denken hervorzubringen, sondern ist nur zur Aktion und Reaktion verdammt. Demgegenüber steht eine denkende Substanz, die res cogitans. Es ist eine Welt des Gedanklichen, hat keine Grenzen im Raum und ist immateriell. Die denkende Substanz sorgt für unsere Gefühle, Wahrnehmung bis hin zur willentlichen Handlung und gilt als unsterblich. Die denkende Substanz muss aber in der Seele enthalten sein. Nach Descartes geschieht diese Wechselwirkung im Gehirn über die Zirbeldrüse. Jedes Denken ist für ihn ein bewusster Vorgang, dem er sich sicher ist.
Seele und Wille
Wir hatten schon festgestellt, dass die Seele die höchste Eigenschaft der Willensfreiheit sei. Sie hat die Aufgabe, die Leidenschaften des Menschen durch den Willen einzuschränken und mit Freiheit zu lenken. Dieser Anspruch an die Willensfreiheit machte sich die bürgerliche Ethik zu eigen. Ihr Einfluss ging von Spinoza bis in die klassisch deutsche Philosophie. Philosophiegeschichtlich bekommt diese Lehre mit Spinoza eine materialistische Richtung, da er den Dualismus von Gott und Natur aufhebt.
Die subjektiv-idealistische Richtung hat in der Entwicklung des Idealismus von Berkeley bis Wolff und Leibniz gewirkt. Das "Ich" wurde bei Kant und Fichte zur bestimmenden Kategorie der theoretischen und praktischen Unternehmensphilosophie. Auch Hegel, Schelling und Feuerbach sind durch das rationalistische Prinzip seiner Philosophie (anthropologische Tendenz) stark beeinflusst worden.
Wissen und Wille
1. Glückseligkeit kann nicht auf Wissen beruhen, da der Mensch irrt.
2. Beim Willen aber tut man das, was gut ist, er ist unabhängig und es ist erreichbar.
3. Ist der Wille vom Wissen abhängig, so ist er nicht frei, da das Wissen durch irren nicht in unserer Macht steht.
Materialismus: Freiheit des Willens heißt, mit Sachkenntnis entscheiden zu können.
Definition Wissen: Beruht auf Erziehung und der Aneignung von gesetzmäßigen Vorgängen in der Natur, Gesellschaft und im Denken.
Definition Glückseligkeit: Gesellschaftliche Umstände, die den Menschen in seinem Wesen befriedigen.
Wissen und Wille sind bei René Descartes getrennt.
Definition Wille: Synonyme für den Willen sind Absicht, bestreben, Gedanke, Intuition, Plan, Vorhaben, Vorsatz, wollen, Zielsetzung und Zweck.
Es ist ein bewusst gerichtetes Streben eines Menschen zur Erreichung bestimmter gesetzter Ziele. Seine zwei Komponenten sind der Intellekt (Denken, Erkenntnis) und die Gefühle. Da der Wille immer zielgerichtet ist, setzt es eine gewisse Kenntnis des Ziels voraus. Die Verwirklichung wird mit der Willenshandlung vollzogen, die einmal in der Herausbildung einer Absicht sowie das Fassen eines Entschlusses beinhaltet, sondern auch dessen Ausführung. Der Wille darf nicht nur eine auf das Individuum gerichtete psychische Erscheinung betrachtet werden, sonder gilt ebenso für Menschengruppen, ein sogenannter gemeinschaftlicher Wille bestimmter Interessengruppen oder eines Volkes. Ein gemeinschaftlicher Wille kann in der Ablehnung von Rüstung und der Lieferung von Waffen in andere Länder zum Ausdruck kommen. Hier gibt es vielfältige üble Erscheinungen in der Gesellschaft, die einige Teile des Volkes verändert sehen will. Für eine Gesellschaft ist der Wille von größer Bedeutung. Er wird durch das Lernen in der Schule, der Erfahrung aus dem Leben eines Individuums, den sozialen Kontakten, den gesellschaftlichen Verhältnissen, dem Bildungsstandard und der Gesundheit geprägt.
Gehirn
Es steuert nahezu alle wichtigen Körperfunktionen, verarbeitet Sinneseindrücke und ermöglicht sämtliche Denkprozesse.
Gedanken
Verstand
Das Vermögen zu erkennen. Bei dem Vermögen des Erkennens sehe ich, dass es sehr beschränkt ist und gering in mir vorhanden ist.
Das Vermögen zu erkennen. Bei dem Vermögen des Erkennens sehe ich, dass es sehr beschränkt ist und gering in mir vorhanden ist.
Urteile
Blinder Trieb, wo ich deren Vorstellungen durch die Sinne und nicht durch sichere Urteile für wahr gehalten habe.
Seine Methode
Man darf nur das als wahr annehmen, was geprüft wahr ist. Was also erwiesen ist.
1. Man zerlegt alles in Einzelteile und prüft alle einzelnen Bestandteile, ob sie wahr sind.
2. Wenn man sie überprüft hat, ob sie wahr sind, kann man alles wieder zusammensetzen zu einem großen Ganzen.
3. Dann schaut man, ob das große Ganze in sich schlüssig ist, also ein System ist.
Σ Dann hat man ein neues Ganzes.
Bis dieses Wissen da ist, gibt es eine provisorische Moral.
Descartes Hauptregeln der Methode
Das ganze Wissen, was wir jetzt haben, basiert auf Grundlagen, die vorgegeben sind und überliefert sind. Also muss alles neu durchdacht werden. Dies muss auf der Methode der Mathematik geschehen, da diese Methode am sichersten ist. Ein mathematisch klarer Aufbau der Welt, eine klare Fundierung.
1. Man soll nichts für wahr halten, wenn es nicht bewiesen ist. Es muss alles bewiesen und begründet sein. Unanzweifelbar also.
2. Die Probleme, die man hat, werden in Einzelteile zerlegt, und zwar so lange, bis man zu einfachen Abschnitten kommt, die dann intuitiv zu lösen sind. Beispiel das Dreieck. Es hat drei Ecken. Dass es drei Ecken hat, sieht man schon intuitiv. Ich muss hier nichts mehr beweisen, was ein Dreieck ist. Diese Intuition ist für Descartes die Grundlage. Es werden die Dinge so weit heruntergebrochen, bis man intuitiv erkennt, dass es wahr ist. Das macht man dann mit jedem Problem.
3. Diese Einzellösungen werden wieder zusammengesetzt zu einem Gesamtkonzept. Erst Destruktion, dann ein Zusammensetzen zu einem System.
4. Dann schauen wir, ob alles zusammenpasst. Das Fundament ist die intuitive Erkenntnis.
Σ Damit will Descartes das Weltwissen auf eine neue sichere Basis stellen, um überhaupt erst einmal zu denken anzufangen. Er sagt, so wie es jetzt ist, so können wir nicht weiter machen, da alles unsicher ist, was wir wissen.
Das einfachste und fasslichste ist das absolute Gewissen, das heißt, ich weiß, dass es da ist. Das Gewissen, das es existiert. Dieses einfachste und absolute gewissen ist für Descartes das Selbstbewusstsein des Menschen. Diese Lehre findet philosophiegeschichtlich bei Spinoza ihre unmittelbare Fortsetzung. Er hebt den Dualismus auf und gibt damit der Philosophie von Descartes eine materialistische Richtung. Die subjektiv-idealistische Grundlage der Erkenntnistheorie „Ich denke, also bin ich“, wirkte bei Berkeley, Leibniz und Wolff weiter.
Das „Ich“ bei Kant und Fichte.
Auch Hegel, Schelling und Feuerbach sind durch sein philosophisch rationalistisches Prinzip stark beeinflusst worden.
Das Bewusstsein und die Sinne
Das Bewusstsein war für Descartes das Denken und seine Fähigkeit, sinnvolle Tätigkeiten auszuführen. Dieses Attribut macht den großen Unterschied zwischen Mensch, Tier und der Maschine aus. Das Tier setzt er mit der Maschine praktisch auf eine Stufe. Ihre Empfindungen und ihre Bewegungen folgen rein mechanischen Gesetzen, und alles, was auf physikalische Gegebenheiten basiert, kann keine Seele in sich tragen. Würde der Mensch keinen Geist besitzen, so wäre der menschliche Körper mit all seinen Sinnen und Empfindungen auch nichts anderes als ein Automat. Da er aber die Fähigkeit besitzt zu denken und sich seiner Umgebung bewusst wird, kann man davon sprechen, dass in ihm eine Seele vorhanden ist. Seine Schlussfolgerung aus dieser Erkenntnis kann nur sein, dass alles, was in der Lage ist zu denken, eine Seele hat und alles, was eine Seele hat, denken kann. Das eine ist ohne dem anderen nicht möglich.
Sinnliche Wahrnehmungen haben für ihn nicht denselben Stellenwert wie die Einsichten, denn diese gewinnt man nur durch Denken. Die Sinne können uns jedoch leicht täuschen und ihre Bilder sind unklar. Aus diesem Grund weiß man nicht genau, ob die Sinne sich nicht immer irren. Er geht sogar so weit, dass jenes Weltbild, welches aufgrund sinnlicher Wahrnehmungen gewonnen wird, mit einer Traumwelt vergleicht. Er sieht keinen Unterschied zwischen Traum und sinnlicher Wahrnehmung.
Dasein Gottes
Gott kann wie die Körperwelt nicht wahrgenommen werden. Daher muss die Idee eines höchsten Wesens wie das menschliche Denken notwendig einer Wirkung einer unendlichen geistigen Substanz sein, also einer angeborenen Idee.
Angeborene Idee: eine von Außen empfangene und selbst gebildete Idee. Das Denken stellt hier ein Modus der göttlichen Substanz dar. Die Seele und die Materie sind verbunden durch Gott.
Descartes fragt sich, woher kommt beim Menschen die Idee, dass es Gott gibt. Das menschliche Denken ist die Wirkung einer unendlichen geistigen Substanz. Er baut ein ganzes Reich der Ideen auf. Gott ist nur, weil der Mensch die Idee von Gott hat. Wir haben eine denkende Substanz und ein Leib, der ausgedehnt ist. Die denkende Substanz muss in der Seele enthalten sein. Zwischen beiden Substanzen sitzt die Zirbeldrüse. Mit ihr können wir durch unsere Gedanken auf den Körper Einfluss nehmen. Das Problem ist bei Descartes, wenn es zwei Substanzen gibt, die unabhängig voneinander existieren, dann können diese auch nicht in einer wechselseitigen Beziehung stehen und er fragt nicht danach, woher die Idee der Idee überhaupt kommt.
René Descartes/Briefe
(Universal Bibliothek - Ausgewählte Schriften, Verlag Philipp Reclam jun. Leipzig 1980 (Seite 342 - 345)
In seinen Briefen in den Jahren 1634 kommt ganz klar zum Ausdruck, dass Descartes von einer Veröffentlichung seiner Schrift absieht. Warum?
1. Seine Schrift, auf die Aussagen von Galilei aufgebaut ist.
2. Er mit der Kirche keine Auseinandersetzung haben möchte und unliebsamen Bekanntschaften aus dem Weg gehen will.
3. Er sucht die Stille und Ruhe des Geistes.
4. Er will es nicht darauf ankommen lassen, denn dann stände die Wahrheit seiner Schrift gegen die Wahrheit der Kirche.
21. Mai 1643 Brief an die Pfalzgräfin Elisabeth (1618 – 1680) (Seite 348)
Primitive Begriffe, nach denen wir alle unsere anderen Erkenntnisse bilden.
Es gibt nur sehr wenig Begriffe (Seins, Zahl, Dauer usw.), die allem zukommen, was wir begreifen können. Für den Körper haben wir den besonderen Begriff der Ausdehnung. Aus diesem folgen die Begriffe der Gestalt und der Bewegung.
Für die Seele allein haben wir nur den des Gedankens, indem die Wahrnehmungen des Begriffsvermögens und die Neigungen des Willens inbegriffen sind.
Für die Seele und den Körper haben wir nur den ihrer Vereinigung, von welchem die Kraft abhängt, die die Seele hat, um den Körper zu bewegen und der Körper wirkt auf die Seele zurück, indem Gefühle und Leidenschaften verursacht werden.
Descartes will, dass die ganze Wissenschaft, dass ganze Wissen der Menschheit durch diese Begriffe richtig unterschieden werden können. Es sollen dem Begriff nur Dinge zugeschrieben werden, die auch zu ihm gehören.
Warum? Erklären wir eine Sache oder eine Schwierigkeit mithilfe eines Begriffs, was dem nicht zukommt, können wir uns irren. Ein Begriff kann nur aus sich selbst verstanden werden, also ursprünglich.
Diese Aussagen werden in den „Meditationen“ ausführlich behandelt. Er versucht die Begriffe verständlich zu machen, die der Seele allein zukommen und die anderen nur dem Körper angehören. Daher wird zuerst die Art und Weise der Verbindung zwischen Seele und Körper dargelegt, ohne diejenigen wie oben erwähnte zu nennen.
Die Kraft, wo die Seele auf den Körper wirkt, wird verwechselt mit der Kraft, die auf einen anderen Körper wirkt. Die verschiedenen Qualitäten der Körper (Schwerkraft, Wärme usw.), die vom Körper unterschiedliche Existenzen besitzen (Substanzen), haben wir Qualitäten genannt. Um bestimmte Dinge zu begreifen, bedienen wir uns mit Begriffen, um den Körper zu erkennen bis hin zur Seele. Der Begriff der Kraft sollte auf die Seele, die den Körper bewegt, verstanden werden und nicht wie in der Physik mit der Schwerkraft.
13. Juli 1638 Brief an Jean-Baptiste Morin (1583-1656), frz. Mathematiker und antikopernikanischer Astronom (Seite 350/351)
Ursache – Wirkung
Aussage
Es wäre leicht, irgendeine Ursache einer Wirkung anzupassen.
Descartes
Tatsächlich kann man mehrere Wirkungen verschiedenen Ursachen zuordnen. Es ist aber viel schwieriger, eine gleiche Ursache mehrerer verschiedener Wirkungen anzupassen, falls sie nicht die wirkliche ist. Es gibt aber auch Wirkungen, wo ihre wahre Ursache abgeleitet werden kann.
Problem in der Physik
Nur der Versuch, sich einige Ursachen auszudenken, mit denen man Vorgänge in der Natur erklären kann, wird keinen Erfolg haben.
Descartes Lösung
Bezogen auf die Phänomene der Natur: Ihre wirklichen Qualitäten, substanziellen Formen, Elemente und ähnliche Dinge, deren Zahl fast unendlich ist, vergleicht man nur damit, dass alle Körper aus Teilchen zusammengesetzt sind, wie man es bei mehreren mit bloßem Auge sieht und bei anderen nicht. Alles, was ich sehe, das Salz, der Wind, die Wolken, der Schnee, der Donner, der Regenbogen usw., wenn man diese Dinge davon ableitet, so sieht man gegenüber den anderen, dass die von mir erklärten Wirkungen keine anderen Ursachen haben, aus denen ich sie ableite.
27. Mai 1641? Brief an Marsenne (Seite 351)
Gleichgültigkeit und freier Wille
Gleichgültigkeit ist ein Zustand, indem der Wille sich befindet und entweder für das eine oder das andere Partei ergreifen kann. Aus der Erkenntnis heraus zu entscheiden, was wahr und falsch ist, ist etwas anderes.
Der niedrigste Grund der Freiheit besteht darin, sich für Dinge entscheiden zu können, denen man gänzlich gleichgültig gegenübersteht.
Positive Fähigkeit
Jene, die unter Gleichgültigkeit verstehen, dass man sich von zwei Gegensätzen für den einen oder den anderen entscheidet.
Descartes hat nie geleugnet, dass die positive Fähigkeit sich im Wille befindet. Den Willen finden wir gar nicht in allen Handlungen vor. Einmal als Entscheidung und ohne Entscheidung.
Beispiel: Das geht sogar so weit, wenn ein augenscheinlicher Grund uns zu einer Sache drängt, bei der es schwierig ist, sich für das Gegenteil zu entscheiden und es letztendlich doch tun. Es steht uns immer frei, uns selber daran zu hindern, eine Sache zu verfolgen, die uns klar bekannt ist oder das man eine augenscheinliche Wahrheit zugibt, wo wir nur unseren freien Willen bezeugen.
Weitere Beachtung
Freiheit kann nur in den Handlungen des Willens betrachtet werden, bevor sie ausgeübt werden im Augenblick selbst.