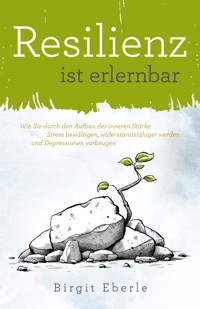
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Resilienz – wer sich für eine gesunde und gelassene Lebensführung interessiert, stößt heute unweigerlich auf diesen Begriff. Resilienz bezeichnet die seelische Widerstandskraft, die es Menschen erlaubt, Krisen zu überwinden und gestärkt aus ihnen hervorzugehen. Damit sind nicht nur schicksalhafte Katastrophen gemeint, sondern auch der alltägliche Stress, der uns zuweilen an den Rand eines Burn-Out bringt.
Trauer zulassen, aber nicht in Resignation verharren, sondern das (Selbst-)Vertrauen zum Weitermachen finden – das können Menschen mit hoher „Stehaufmännchen-Kompetenz“.
Doch was besitzen resiliente Menschen, was andere nicht haben? Diese Frage stellt sich die Wissenschaft seit den 1950er Jahren und konnte bislang eine Handvoll Umwelt- und Persönlichkeitsmerkmale identifizieren.
Die frohe Botschaft: Resilienz ist für jeden Menschen erlernbar!
Birgit Eberle gibt nicht nur Einblicke in die Resilienzforschung, bekannte Längsschnittstudien und Erkenntnisse der Epigenetik – sie benennt mit „7 Säulen der Resilienz“ die zentralen Eigenschaften, die eine Persönlichkeit flexibler und widerstandsfähiger gegenüber den täglichen Belastungen und den Schicksalsschlägen machen.
Selbstwirksamkeit, Optimismus und Akzeptanz bilden darunter wichtige Merkmale, die nicht angeboren sind, sondern sich gezielt trainieren lassen. Hier hilft ein vielfältiger Werkzeugkasten, der Tools aus NLP, Selbstmanagement und Achtsamkeitstraining entlehnt.
„Resilienz ist erlernbar“ bietet Lesern, die sich für wissenschaftliche Hintergründe interessieren und solchen, die praktische Anwendungsmöglichkeiten suchen, gleichermaßen Fakten und Anregungen. Prüfen Sie selbst mithilfe des Buches Ihr Potenzial in puncto Resilienzfähigkeit und lernen Sie, Ihre seelischen Abwehrkräfte zu trainieren!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Resilienz ist erlernbar
Wie Sie durch den Aufbau der inneren Stärke Stress bewältigen, widerstandsfähiger werden und Depressionen vorbeugen
BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenInhaltsübersicht
Resilienz ist erlernbar
Wie Sie durch den Aufbau der inneren Stärke Stress bewältigen, widerstandsfähiger werden und Depressionen vorbeugen
1. Auflage
Copyright © 2019 – Birgit Eberle
Alle Rechte vorbehalten.
Die Rechte des hier verwendeten Textmaterials liegen ausdrücklich beim Verfasser. Eine Verbreitung oder Verwendung des Materials ist untersagt und bedarf in Ausnahmefällen der eindeutigen Zustimmung des Verfassers.
Guide to Contents
Inhaltsübersicht
Inhaltsübersicht
Vorwort: Resilienz – ohne Kratzer durch die Krise?
Teil 1: Wissenschaftlicher Hintergrund – erben oder lernen wir Resilienz?
Nurture vs. Nature – Erziehung oder Genetik: Werde ich resilient gemacht oder geboren?
Das hormonelle Stress-System – unser Partner in puncto Resilienz
Resilienz kann jeder trainieren – zu jeder Zeit
Resilienz – eine Fähigkeit für (alltägliche) Katastrophen?
Teil 2: Praxis – die 7 Säulen der Resilienz
Säule 1:„Ich weiß, ich kann es schaffen“ – Selbstwirksamkeit
Säule 2:„Wenn das Leben dir Zitronen gibt …“ – Optimismus
Säule 3: Raus aus der Opferrolle – Gefühle regulieren und Verantwortung übernehmen
Säule 4: Hilfe annehmen - Sozialkompetenz und Netzwerkorientierung
Säule 5: Ziele und Visionen
Säule 6: Vom achtsamen Rosinenessen – Wie Sie die Realität akzeptieren
Säule 7: Kreative Lösungen finden
Wie erziehe ich mein Kind zu einer resilienten Persönlichkeit?
Nachwort: Ihre Resilienz soll Ihnen dienen
Impressum
Quellenverzeichnis
Vorwort: Resilienz – ohne Kratzer durch die Krise?
Vorwort: Resilienz – ohne Kratzer durch die Krise?
Ein stärkeres Selbstbewusstsein, eine höhere Stresstoleranz, eine positivere Kommunikation – der moderne Mensch strebt nach Verbesserung in allen Lebensbereichen. Dabei beschäftigen wir uns längst nicht mehr nur mit technisch messbaren Werten wie Kalorien, Blutdruck und Umsatzzahlen. Unsere Gesellschaft entdeckt allmählich die psychischen Ressourcen, die uns zu einem erfüllteren und entspannteren Leben verhelfen.
Seit geraumer Zeit stoßen Interessierte in Massenmedien, Fachliteratur und Coaching-Programmen auf den Begriff Resilienz. Er bezeichnet die Fähigkeit der Seele, Schicksalsschläge zu überstehen und gestärkt aus der Krise hervorzugehen. Manche Psychologen nutzen dafür das plastische Bild von einer „seelischen Stehaufmännchen-Kompetenz“. Der Fokus, den die Fachwelt aktuell auf das Thema Resilienz richtet, suggeriert, es handele sich dabei um eine psychologische Neuentdeckung.
Doch bereits seit der Antike faszinieren uns jene Charaktere, die Widrigkeiten überstehen und nicht daran zerbrechen. Menschen, die aus ihrer persönlichen Katastrophe mit neuer Energie heraustreten gleich dem sagenumwobenen Phönix aus der Asche. Resiliente Persönlichkeiten sind deshalb häufig die Akteure unserer Mythen und Märchen. So wie Odysseus, der auf seiner jahrelangen Irrfahrt göttliche Herausforderungen, den Tod seiner Freunde und Phasen des Wahnsinns übersteht, bevor er endlich nach Hause zurückkehrt. Oder Hänsel und Gretel, die bittere Armut erleben, von den Eltern verlassen und ihrer Freiheit beraubt werden, bevor sie sich durch einen kreativen Einfall retten können. Auch die filmischen Blockbuster der modernen Welt – von Rocky bis Star Wars – konfrontieren ihre Protagonisten mit widrigen Lebensumständen, unmoralischen Verführungen und Verlust. Gerade die durchlebte Krise lässt das Publikum die Erfolge der Hauptfiguren noch leidenschaftlicher bewundern.
Wer Modelle für Resilienz in der realen Welt sucht, stößt zuerst auf die Überlebenden von Katastrophen und Kriegen. Als starke Seelen gelten etwa diejenigen, die beim Anschlag auf das World Trade Center im Jahre 2001 Hilfe leisteten. Wir erahnen die seelische Unverwüstlichkeit bei den Menschen, denen beim Tsunami in Thailand 2004 ihre Angehörigen von der Flutwelle entrissen wurden, und bei all jenen, die aus Bürgerkriegsgebieten flüchten, um eine bessere Existenz für sich und ihre Kinder zu erreichen.
Beeindruckende Einzelschicksale führen uns vor Augen, wie Menschen einer schweren Kindheit entwachsen und sich mit plötzlichen Schicksalsschlägen arrangieren: Bill Clinton zählt zu den populärsten Präsidenten der USA – doch Dekaden früher, als er im Hause seines nach Alkohol und Glücksspiel süchtigen Stiefvaters Bedrohung und Gewalt erlebte, hätte wohl niemand diese Karriere vorausgeahnt.
Stephen Hawking erhielt im Alter von 20 Jahren die Diagnose Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) – eine Krankheit, die ihn schließlich an den Rollstuhl fesselte und ihm seine Stimme raubte. Dennoch fand er die Kraft, mit seinen populärwissenschaftlichen Büchern ein breites Publikum für die Welt der Physik zu begeistern.
Vom Körper auf Höchstleistungsniveau zur absoluten Bewegungslosigkeit von der Brust abwärts – dieses Schicksal musste Christina Vogel verkraften. Die Radsport-Olympiasiegerin, die sich gerade auf der Jagd nach einem ewigen Rekord befand, erlitt im Jahre 2018 nach einem Trainingsunfall eine Querschnittslähmung. Dennoch verkündete sie jüngst in einem Interview: „Ich finde neue Ziele!“ Aktuell engagiert sich die 28-Jährige im Stadtrat ihrer Heimatstadt Erfurt und arbeitet als Medienberichterstatterin bei Sportereignissen.
Marc Wallert hat die Resilienz im Anschluss an sein persönliches Trauma gar zu seiner Berufung erkoren. Während eines Familienurlaubs geriet der Göttinger im Sommer 2000 in die Gewalt der islamistischen Terrorgruppe Abu Sayyaf. 140 Tage verbrachte der damals 27-Jährige als Geisel im Dschungel der Philippinen. Heute arbeitet Wallert als Resilienzcoach.
Doch seelische Widerstandskraft brauchen nicht nur Helden und Katastrophenbetroffene. Auch ein normales Leben bietet viele Krisen, Schicksalsschläge und latente Stressbelastungen, an denen Menschen potenziell zerbrechen können.
Einige Personen begegnen diesen Herausforderungen gelassener als andere. Sie scheinen eine innere Qualität zu besitzen, die ihre Persönlichkeit vor Traumata, schwierigen sozialen Bedingungen oder einer schweren Kindheit schützt, sodass die Lebensbelastungen keine sichtbaren Spuren in der Seele hinterlassen. Resilienz befähigt die Betroffenen dazu, im Nachhinein ein normales Leben zu führen, das nicht mehr auf verheerende Krisen oder einen schweren Start schließen lässt.
Doch worin besteht die Resilienz eigentlich? Der Begriff ist abgeleitet vom lateinischen resilire, was so viel heißt wie „zurückspringen“ oder „abprallen“. Bevor Psychologen ihn entdeckten, nutzte ihn in erster Linie die Materialkunde. Ein resilienter Stoff springt auch nach Verformen, Zusammenpressen und Verdrehen wieder in seine ursprüngliche Form zurück. Wie ein Schaumgummiball, den Sie in Ihrer Hand bis auf ein Minimum seiner Masse zusammendrücken können, ohne dass er daran Schaden nimmt. Öffnen Sie die Finger und lösen den Druck, kehrt der Ball sekundenschnell wieder in seine ursprüngliche Dimension zurück.
Der menschlichen Psyche bescheinigen Fachleute eine ähnliche Flexibilität, wie sie der Schaumstoffball an den Tag legt. „Wir verstehen darunter die Eigenschaft, in elementaren Krisen, aber auch im Alltagsstress rasch in einen seelischen Normalzustand zurückzukehren", erklärt der Psychiater Professor Klaus Lieb, der das Deutsche Resilienz Zentrum in Mainz mitbegründete. „Und wir gehen von einer Fähigkeit aus, die prinzipiell jeder erlernen und trainieren kann."
Dabei zeigt sich Resilienz nicht als Einzelfähigkeit, sondern als Konglomerat aus unterschiedlichen Schutzfaktoren und Persönlichkeitsmerkmalen. In der Konsequenz existiert nicht das Trainingsprogramm für Resilienz, sondern ein bunter Werkzeugkasten, der mit zuweilen altbekannten Techniken darauf abzielt, Persönlichkeitselemente wie Selbstwirksamkeit, Optimismus oder Sozialkompetenz zu stärken.
Um Ihnen einen umfassenden Überblick zu bieten, teilt sich dieses Buch in zwei Bereiche: In Teil I erfahren Sie, wie die Wissenschaft die Widerstandskraft der Seele entdeckte und welchen Anteil Gene und Erziehung an ihr haben. Außerdem widmet er sich der Entstehung von Stress und den größten Stressfaktoren im menschlichen Dasein, die unsere Resilienz erfordern.
Der zweite Teil des Buches erklärt, welche persönlichen Kernkompetenzen die Resilienzfähigkeit im Einzelnen ausmachen und wie Sie diese praktisch stärken können. Lassen Sie sich inspirieren und entdecken Sie das Potenzial Ihrer seelischen Abwehrkräfte.
Teil 1: Wissenschaftlicher Hintergrund – erben oder lernen wir Resilienz?
Teil 1: Wissenschaftlicher Hintergrund – erben oder lernen wir Resilienz?
Eine Seele, die nach Stress wieder in ihre Ausgangsform zurückspringt wie ein Schaumstoffball? Diese Vorstellung von Resilienz entwickelte sich bereits in den 1950er Jahren. Damals tauchte der Begriff resilient erstmals in einem psychologischen Zusammenhang auf. Und zwar, als die Entwicklungspsychologin Emmy Werner im Jahre 1955 auf der hawaiianischen Insel Kauai eine wegweisende Studie ins Leben rief.(1) „The children of Kauai: resiliency and recovery in adolescence and adulthood“ – den Titel der Publikation könnte man etwa mit „Die Kinder von Kauai: Unverwüstlichkeit und Erholung in Jugend und Erwachsensein“ übersetzen. Was soll „Unverwüstlichkeit“, oder Resilienz, in diesem Zusammenhang bedeuten?
Die Psychologin hatte ursprünglich erforschen wollen, wie die ungleichen Startbedingungen von Kindern den späteren Verlauf ihres Lebens beeinflussen. Von insgesamt 698 Kindern, die Werner ab dem Zeitpunkt ihrer Geburt beobachtete, waren 210 Kinder in besonders problematische Bedingungen hineingeboren worden: Sie erlebten Armut, Vernachlässigung, elterliche Trennung, Krankheit, Misshandlung und Alkoholismus in der Familie. Wie die Forscher vorausgeahnt hatten, bekamen eben diese Kinder im späteren Leben mehr Schwierigkeiten als ihre Altersgenossen mit besseren Startbedingungen: Sie wurden häufiger kriminell, zeigten psychisch und körperlich einen schlechteren Gesundheitszustand und erreichten weniger Erfolg im Beruf. Um ein vollständiges Bild vom Langzeiteffekt der Kindheitsumgebung zu erlangen, kontrollierte Emmy Werner die Lebensumstände ihrer Studienteilnehmer während mehrerer Dekaden. Sie erhob erste Daten ihrer Schützlinge nach Vollendung ihres ersten Lebensjahres und wiederholte die Untersuchung jeweils mit 2, 10, 18, 32 und 40 Jahren. Eine derart langfristig angesetzte Verlaufsstudie stellt in der wissenschaftlichen Welt auch heute noch eine Ausnahme dar.
Im Laufe der Jahrzehnte kristallisierte sich neben dem prognostizierten Negativ-Schicksal der Kinder aus Problemverhältnissen noch eine Überraschung heraus: Etwa ein Drittel der in schwierigen Bedingungen geborenen Kinder blieben von ihrem Schicksal seelisch scheinbar unberührt. Sie unterschieden sich im späteren Leben de facto nicht von jenen Kindern, die wesentlich bessere Bedingungen zum Lebensstart genießen durften. Diese Kinder bezeichnete Werner in der Kauai-Studie als resilient, also „unverwüstlich“, wenn sie trotz 4 gegenwärtigen Hoch-Risikofaktoren bei ihrer Geburt (z.B. Armut, Krankheit der Eltern, Sucht oder Kindesmisshandlung) nicht psychisch erkrankten.
Abbildung 1 - Ergebnisse der Kauai-Studie 1955-1995
Für Werner warf diese Beobachtung eine Frage auf: Was wendet das Schicksal dieser unverwüstlichen Charaktere zum Besseren? Welche Lebensumstände oder Persönlichkeitszüge unterscheiden die resilienten Kinder von den anderen Kindern aus prekären Verhältnissen? Emmy Werner vermutete bestimmte Resilienz-Faktoren, die bereits kurz nach der Geburt ihre Wirkung zeigen, zumal sich die positivere Entwicklung der resilienten Kinder schon früh in ihrem Leben abzeichnete. Es muss daher Umstände geben, die einem Kind seine hohe Resilienzfähigkeit quasi in die Wiege legen.
Beim Identifizieren der Resilienz-Faktoren unterschied die Forscherin zwischen Merkmalen der Persönlichkeit, des Elternhauses und der externen Umwelt. Das Fazit der Kauai-Studie brachte schließlich die folgenden Ergebnisse:
Persönlichkeit: Kinder, deren Temperament bei Erwachsenen positive Reaktionen auslöst, entwickeln statistisch gesehen eine höhere Resilienzfähigkeit. Wenn Babys von Geburt an dazu neigen, zu lächeln und positiven Kontakt zu suchen, erweist sich das als schützender Faktor im Vergleich zu Kindern, die weniger lächeln oder häufiger schreien. Jahre später zeigt sich, dass Kinder, die bereits im Vorschulalter relativ selbstständig agieren und im Schulalter eine hohe Fähigkeit zur Problemlösung besitzen, im Vergleich zu ihren Altersgenossen statistisch gesehen resilienter sind.Familie: Ganz besonders wichtig für die Resilienz eines Kindes ist es, mindestens eine stabile Bezugsperson zu erleben. Heute gehen Forscher davon aus, dass eine gute Bindung an die Mutter oder eine andere Bezugsperson das Stressempfinden bei Kleinkindern signifikant beeinflusst. Kinder, die sich sicher an ihre Mutter gebunden fühlen, bilden in belastenden Situationen weniger vom Stresshormon Cortisol. Stärker unter Stress stehen hingegen Kinder, die eine ambivalente Bindung erfahren oder ohne feste Bindung aufwachsen. In der Kauai-Studie wurde außerdem klar, dass Mütter mit guter Schulbildung und Frauen, zwischen deren Schwangerschaften mehr als zwei Jahre lagen, resilientere Kinder hatten. Auch die religiöse Überzeugung der Eltern förderte statistisch gesehen die Resilienz der Kinder.
Umwelt: In der weiteren Umwelt zeigte Emmy Werner vor allem Faktoren auf, die als unterstützende Beziehungen zur Resilienzfähigkeit eines Kindes beitragen: Gleichaltrige Freunde, Nachbarn, Lehrer und Lehrerinnen oder selbstgewählte Ersatzeltern stärken die seelische Widerstandsfähigkeit eines Kindes.
Aktuell existiert noch eine zweite Langzeitstudie, die ähnlich angelegt ist wie die Kauai-Studie. Sie startete im Jahr 1972 mit 1037 Kindern aus der neuseeländischen Kleinstadt Dunedin.(2) Auch hier wollten die Forscher in zahlreichen unterschiedlichen Fragestellungen herausfinden, inwieweit die Bedingungen zu Beginn eines Lebens seinen weiteren Verlauf prägen. Noch heute nehmen 97 Prozent der Probanden, die im Jahre 2019 etwa 47 Jahre alt sind, an den regelmäßigen Untersuchungen und Evaluierungen teil. In der großen Tendenz bestätigen die Resultate jene von Emmy Werners Kauai-Studie: Kinder, die in gute Verhältnisse hineingeboren werden, haben auch im späteren Leben statistisch gesehen eine höhere Chance auf Erfolg, Gesundheit und psychische Stabilität. Nur etwa ein Drittel der Babys aus Problemverhältnissen erweist sich als resilient und erreicht den Lebensstandard der glücklichen Starter. Doch in der Dunedin-Studie konzentrierten sich die Forscher vor allem auf das Schicksal der nicht-resilienten Kinder aus Risikoverhältnissen: Jene Kinder aus Dunedin, die in ihrer frühen Kindheit Risikofaktoren wie Armut und Gewalt ausgesetzt waren, tragen in ihrem späteren Leben ein dreimal so hohes Risiko, kriminell oder drogenabhängig zu werden. Auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Übergewicht kommen bei ihnen weit häufiger vor.
Insgesamt entfielen auf das kleine Segment von nicht-resilienten Kindern aus Problemverhältnissen überproportional große gesundheitliche und gesellschaftliche Belastungen im späteren Leben. Die Gruppe machte etwa ein Fünftel der 1037 Studienteilnehmer aus, enthielt aber 40 Prozent der extrem Übergewichtigen und 54 Prozent der Raucher. Sie verursachte 57 Prozent der Krankenhausaufenthalte, verbrauchte 66 Prozent der Sozialleistungen, umfasste 77 Prozent der alleinerziehenden Mütter und 81 Prozent der Gesetzesübertretungen. Insgesamt verursachten damit 20 Prozent der Teilnehmer der Dunedin-Studie ganze 80 Prozent der gesellschaftlichen Probleme und Kosten.
Abbildung 2- Ergebnisse der Dunedin-Studie 1972-2019
Doch was entscheidet schlussendlich, ob ein Kind relativ ruhig oder rau durch sein späteres Leben geht? Die frühe Prägung durch schwierige Familienverhältnisse oder vielleicht doch die familiär vererbten Gene? Und inwieweit lassen sich Umwelt- und Erbguteinflüsse überhaupt scharf voneinander abgrenzen?
Das vorsichtige Fazit der neuseeländischen Wissenschaftler lautete: Nicht bei der Geburt, doch in einem Alter von etwa 3 Jahren, lässt sich relativ sicher voraussagen, ob ein Mensch im späteren Leben psychische und gesundheitliche Schwierigkeiten entwickelt. Wird ein Kind in ein problembehaftetes Umfeld hineingeboren, sollte es zumindest bis zum Abschluss seines dritten Lebensjahres einige der von Emmy Werner definierten Schutzfaktoren erlebt haben, damit es eine gute Chance hat, aus dem schlechten Start ein gutes Leben zu machen. Die Resilienz, die den Dunedin-Kindern aus dem Ghetto in späteren Jahren eine befriedigende Existenz ermöglichte, führen die Wissenschaftler damit wie Emmy Werner in erster Linie auf eine frühe Prägungsphase zurück.
Nurture vs. Nature – Erziehung oder Genetik: Werde ich resilient gemacht oder geboren?
Nurture vs. Nature – Erziehung oder Genetik: Werde ich resilient gemacht oder geboren?
Ist für unsere spätere Resilienz allein die kindliche Früherziehung verantwortlich oder können wir psychische Stabilität auch erben? Die Frage, wie stark Genetik und Prägung jeweils auf das Leben eines Individuums einwirken, ist in der Fachwelt als „Nurture vs. Nature“ bekannt. In der Praxis scheint sie allerdings kaum beantwortbar: Wäre die frühe Prägung entscheidend, würden Babys aus Problemvierteln zu stabilen Erwachsenen heranwachsen, wenn sie nur ihre ersten Lebensjahre in einer gutbürgerlichen und psychisch gesunden Familie verbringen könnten. Umgekehrt würde ein Säugling aus der Mittelschicht durch seine genetische Ausrüstung nicht geschützt, wenn er in prekäre Verhältnisse hineinadoptiert würde. Solche Tauschmodelle lassen sich in der menschlichen Realität kaum finden und absichtsvoll höchstens mit Mäusen durchführen.
Beim Menschen sind Forscher deshalb darauf angewiesen, Gene zu finden, die mit bestimmten Verhaltensweisen und Schicksalen assoziierbar sind. Nur sie könnten Aufschluss darüber geben, ob Eigenschaften wie Resilienz allein der Erziehung oder auch dem Erbgut geschuldet sind.
Gibt es ein Resilienz-Gen?
In den 1990er Jahren entdeckten Forscher den bislang vielversprechendsten Kandidaten für ein Resilienz-Gen. Sein Name lautet 5HTTLPR. Dieses Gen steuert bei jedem Individuum, wie effektiv das Glückshormon Serotonin in seinem Gehirn ausgeschüttet und abgebaut wird. Darüber hinaus reguliert 5HTTLPR ein Enzym, das seinerseits für den Abbau des Stresshormons Noradrenalin zuständig ist.
5HTTLPR existiert in der menschlichen Population in einer langen und einer kurzen Variante.(3) In der langen Ausführung organisiert 5HTTLPR den Serotoninstoffwechsel mustergültig. In der kurzen Variante sorgt es dagegen dafür, dass das Serotonin relativ lange im Spalt zwischen zwei Nervenzellen verbleibt. Die Rezeptoren auf der Zelloberfläche, die durch Serotonin aktiviert werden, stumpfen unter diesem Dauerreiz allmählich ab. In der Folge entfaltet das Glückshormon weniger Wirkpotenzial beim betroffenen Menschen. Gleichzeitig fehlen den Personen mit der kurzen 5HTTLPR-Variante die nötigen Enzyme, um das Stresshormon Noradrenalin abzubauen. Mit dieser hormonellen Ausstattung scheinen die Individuen genetisch dazu verdammt, schlechter gelaunt und schneller gestresst zu sein als andere. Damit könnten sie – wie Wissenschaftler vermuteten – potenziell eher depressiv und weniger resilient sein.





























