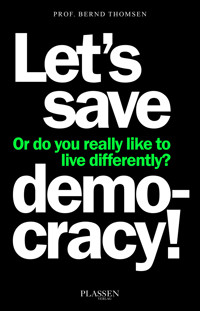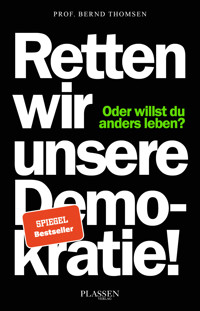
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Plassen Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Demokratie ist viel mehr als eine Staatsform. Sie ist eine Lebensform! Doch unsere Art zu leben droht zu sterben. Mit erstaunlicher Leichtigkeit packt der Autor dieses gewichtige Thema an. Ein Sachbuch, das Spaß macht. Weil es lebendig erzählt wie ein Roman oder ein spannender Podcast. Mit dabei: Joe Biden, Sanna Marin, Robert Habeck, Justin Trudeau und viele weitere Länderchefs. Nach fünf Jahren Forschung bekommt der Leser jetzt hunderte Learnings aus 39 Ländern, spannende Fakten, Zukunftsforschung, eine fundierte Analyse und inspirierenden Optimismus. Und vor allem: die Lösungsformel, wie unsere Demokratie zu retten ist. Eine unverzichtbare Lektüre für alle, die unsere Art zu leben lieben. Auch für Leser, deren Business nicht Politik ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
PROF. BERND THOMSEN
Retten wir unsere Demokratie!
Oder willst du anders leben?
Copyright 2024:
© Börsenmedien AG, Kulmbach
Gestaltung Cover: Daniela Freitag, Team Thomsen
Fotos: S. 18 Vojtech Bartonicek, S. 58 Justin Campbell, S. 150 Jon Tyson, S. 196 Christoph Amend, S. 312 Benny Rotlevy, Rückumschlag Mariana Vusiatytska, Klappe Privat, Félix L. Salazar
Gestaltungsidee Layout: Team Thomsen
Umsetzung, Satz und Herstellung: Daniela Freitag
Lektorat: Claus Rosenkranz
Druck: Mohn Media Mohndruck GmbH, Gütersloh
ISBN 978-3-86470-967-8
eISBN 978-3-86470-968-5
Alle Rechte der Verbreitung, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, der fotomechanischen Wiedergabe und der Verwertung durch Datenbanken oder ähnliche Einrichtungen vorbehalten.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über <http://dnb.d-nb.de> abrufbar.
Postfach 1449 • 95305 Kulmbach
Tel: +49 9221 9051-0 • Fax: +49 9221 9051-4444
E-Mail: [email protected]
www.plassen.de
www.facebook.com/plassenverlag
www.instagram.com/plassen_buchverlage
For eight blue eyes,four born in the USA, four in Germanyand my true pride:Nico, Collin, Vasco and Leon.
Retten wir unsere Demokratie. In 5 Kapiteln.
Kapitel eins DAS MANDAT.
Kapitel zwei CO-LAB IN MIAMI.
Kapitel drei ONE-2-ONE MIT JOE BIDEN.
Kapitel vier NEUNTES CO-LAB AM GARDASEE.
Kapitel fünf DEBRIEFING IN NEW YORK.
Prolog
Reader’s Manual
Die Lösungsformel. Und die Maßnahmen
Epilog
Danksagung
Endnoten
Beispiel: 90 % der Länder, die den weltweit besten sozialen Aufstieg haben, gehören auch zu den besten Demokratien der Welt (vollständige Demokratien).
PROLOG
Wieder Lust auf Demokratie
Acht Jahre ist es her. Da wollte ein Verlag, dass ich ein Buch schreibe. Alles war vorbereitet, das Thema, der Inhalt, der Titel, der Vertrag. Und vor dem Büro des Verlagsleiters wartete bereits ein Blind Date: eine Ghostwriterin, die meine knappe Zeit kompensieren sollte. Ich musste mich kneifen, ob das gerade alles wirklich passierte.
Aus dem Buch wurde nichts. Einen weiteren unter den unzähligen Ratgebern dieser Welt zu schreiben war nicht mein Ding. Aber wer da vor der Tür wartete, war spannend. Ein echtes Multitalent. Eine Verlagsleiterin. Eine Autorin unzähliger Bücher, auch von Prominenten. Vor allem aber eine Wissenschaftsjournalistin, die „anders“ denken konnte. Irgendwann saßen wir zum Lunch bei einem Italiener zusammen. Während sie mir bohrende Fragen über mich stellte, bohrte ich in meinen leckeren, von einer Parmesanwaffel umgebenen Bandnudeln. So lecker, dass mir erst beim Espresso auffiel, dass sie die ganze Zeit nur mitschrieb. In diesen zwei Stunden fand sie heraus, wofür ich tatsächlich seit meiner Kindheit brenne: die Demokratie. In den nächsten Jahren sollte ich sie mit der Größe dieses Buchthemas fast um den Verstand bringen.
Wusstest du, dass sich 76 Prozent der Menschen nicht für Politik interessieren?2 Und 59 Prozent gar keine Bücher kaufen?3 Den Nichtlesern die Schuld für ihr Desinteresse zu geben war mir zu einfach. Vielleicht mussten Bücher nur anders sein. Packender. Persönlicher. Leichter zugänglich auch im Komplexen. Ein Sachbuch könnte doch viel mehr Spaß machen, wenn es Wissen lebendig erzählt. Wie ein Roman. Oder ein spannender Podcast. Verlage sahen das ganz anders: Ein so ernstes Thema wie Demokratie müsse ernst behandelt und dürfe nicht erzählerisch umgesetzt werden. Aber muss ein Buch über ein solch wichtiges Thema, das uns alle angeht, wirklich schwer verdaulich sein, um als seriös zu gelten? Und muss es zwingend aus der Feder von Politikern oder Politologen stammen?
Und dann gab es diese eine Nacht, in der ich auf der Bettkante meiner kleinen Tochter saß. Mein jüngster Sohn hatte sich zuvor in das Bett seiner Schwester geschlichen. Bedrückt beobachtete ich, wie sie friedlich aneinandergekuschelt schliefen. Ich war zu ihnen ins Kinderzimmer gekommen, weil ich kurz vorher eine erschütternde Dokumentation über die Kinder vom „Bullenhuser Damm“ gesehen hatte. Nachdem sie in das KZ Neuengamme transportiert worden waren, unternahmen die Nazis unmenschliche medizinische Versuche an ihnen. Alle 20 wurden 1945, in der Endphase des Zweiten Weltkriegs, in einem Keller erhängt, nachdem es angeblich ins Bett gehen sollte. „Wer von euch will die Mama wiedersehen?“, wurden die Kinder gefragt, die zwischen fünf und zwölf Jahren waren, also genau im Alter meiner jüngsten Kinder. Ein grauenhaftes Beispiel für den Machtmissbrauch, den Autokratie ermöglicht. Unterdrückung. Unfreiheit. Unbeschreibliches Leid. Tod. Was im letzten Jahrhundert im Dritten Reich geschah, passiert andernorts auch heute noch. In China etwa und in unzähligen anderen Ländern, deren Bürger nicht in einer Demokratie leben dürfen. Autokratien schränken ein, bevormunden und bekämpfen Andersdenkende. Meine Sorge, dass meine Kinder einmal nicht die Freiheiten leben dürften, die ich so schätze, brach auf einmal durch. In jener Nacht war mir klar, dass ich ein Buch über Demokratie schreiben werde. Aber ein anderes. Es sollte weniger um Theorie und trockene Fakten als vielmehr darum gehen, wie wir Demokratie lebendig leben können. Denn ich wollte ja auch die 76 Prozent nicht an Politik Interessierten und die 59 Prozent gewinnen, die (noch) keine Bücher kaufen. Das alles hat mehrere Jahre gedauert. Genauer gesagt fünf.
Vieleicht gehörst du ebenfalls zu den Menschen, die sich wenig für Politik interessieren. Wenn ja, hat das vermutlich gute Gründe. Und wenn es auch nur der ist, all die schlechten Nachrichten nicht mehr hören zu können. Das geht mir genau wie dir.
Unsere Demokratie ist gefährdet durch Populismus und Extremismus, angefeuert durch Klima- und Fluchtkrisen, Desinformation, auch mithilfe künstlicher Intelligenz, Echoräume in sozialen Medien, soziale Ungleichheit … Deshalb habe ich in diesem Buch Demokratie anders betrachtet. Denn Menschen, selbst wenn sich viele nicht für Politik interessieren mögen, sind sehr wohl am eigenen Leben interessiert. Verstehen wir also Demokratie nicht nur als Staatsform, sondern als Lebensform, ja als Lifestyle, dann geht uns das Thema doch alle an. Nur so können wir die Demokratie retten! Wenn ich junge Eltern mit Kinderwagen im Park sehe, will ich, dass ihnen niemand reinredet, wie viele Kinder sie haben dürfen oder eben nicht. Das ist ihre Entscheidung. Oder wenn es darum geht, ob sie heiraten und wenn ja, wen. Dann ist das auch ihre Entscheidung und nicht die des Staates. Ich bin fest davon überzeugt, dass auch Innovationen nur entstehen, wenn Menschen tun dürfen, was sie gern tun. Wenn sie frei sind.
Überall auf der Welt, wo mir nicht irgendjemand diktiert, was ich zu tun und zu lassen habe, finde ich das Leben wunderbar. Und das ist nur in Demokratien der Fall. Deshalb bin ich, was die Zukunft angeht, optimistisch. Das mag bei der aktuellen Weltlage naiv klingen. Ist es aber nicht. Denn tatsächlich hast du es selbst in der Hand, so zu leben, wie du willst. Wie das geht, verrate ich dir in diesem Buch. Ich kann aber auch in drei Wörtern sagen, was ich erreichen will: Lust auf Demokratie!
Mit der Demokratie und ihren Bürgerinnen und Bürgern, ob Ärztin oder Putzmann, ist es wie in einer Beziehung, die in die Jahre gekommen ist: Schenkt einer dem anderen keine Aufmerksamkeit mehr, hat der Anfang vom Ende bereits begonnen. Und das Ende ist Trennung. Die Gefahr, dass sich Bürger von der Demokratie trennen, ist global so groß wie nie zuvor. Die Spaltung freier Gesellschaften zerfrisst die Demokratie, also unser Leben, so wie wir es lieben. Daher lohnt es sich für uns alle, die Demokratie zu retten. Wir müssen es sogar tun! Sonst bekommen wir die Bedrohungen der Menschheit nicht in den Griff: Kriege, Klimawandel und künstliche Intelligenz. Ganz zu schweigen von dem, was China vorhat: Bis zum Jahr 2049 will die Volksrepublik zu ihrem hundertjährigen Bestehen ihrem Lebensmodell, das faktisch eines der Unfreiheit ist, zur Weltmarktführerschaft verholfen haben.
Was braucht es also, um die Demokratie zu retten? Zunächst einmal müssen wir uns trauen, Regeln zu brechen – und genau das ist mein Job. Klingt verrückt, oder? Damit meine ich natürlich nicht, dass ich professioneller Falschparker bin oder immer bei Rot über die Ampel gehe. Vielmehr darf ich Firmen und Regierungen dabei helfen, Ungelöstes und scheinbar Unlösbares zu lösen. Dafür muss man anders denken, als man bisher gedacht hat. Denn Regeln zu brechen ist nichts anderes, als out of the box zu denken. Die herrschenden Konventionen zu kennen und dann neue Wege zu suchen, um etwas besser zu machen. In meinem Job geht es vor allem darum, von außen auf ein Problem zu gucken (Politikerinnen und Politiker sind nur drin. Und innerhalb des Systems oft betriebsblind.), mit Betroffenen zu reden, unabhängig zu denken, den verschlungenen Pfad aus Herausforderung, Zukunft und Lösung zu finden. Genau das habe ich in diesem Buch getan. Der Demokratie mangelt es zum Beispiel gerade an Wertschätzung. Aber das ist nur ein Symptom, nicht die Ursache. Und wie man diese behebt, dazu habe ich in den letzten Jahren Antworten gefunden.
Zu den überholten Regeln, die ich meine, gehört auch jene, dass nur Politologen und Historiker sich mit Demokratie befassen dürfen. Ich bin keines von beidem. Ernst meine ich es dennoch. Die beiden einzigen Themen, bei denen ich mich gut auskenne, sind Zukunft und Strategie. Sollte ein zeitgemäßes Buch über Demokratie nicht exakt das mitbringen? Frisches Denken im Demokratiedschungel und frisches Blut im Bücherwald? Auf jeden Fall braucht es eine neue Strategie zum Wohle der Demokratie. Deshalb war die Demokratie seit jeher die Kundin, die ich haben wollte.
Also, lehne dich zurück und genieße die folgende Geschichte. Du brauchst nur weiterzublättern und schon spürst du sie hoffentlich: die Lust auf Demokratie.
Reader’s Manual
Die meisten Leute mögen keine Bedienungsanleitungen. Warum also braucht es ausgerechnet eine für ein Buch? Weil dieses anders ist als normale Bücher. Hol das Beste aus deinem Leseerlebnis heraus, indem du dir einen Moment Zeit nimmst, um dieses kurze Reader’s Manual zu lesen.
Das ganze Buch hat zwei Farbcodes. Direkt nach diesem Reader’s Manual geht es los und endet nach dem fünften Kapitel: Schwarz auf weiß findest du eine Erzählung, die Fiktion ist, aber genauso hätte stattfinden können. Weiß auf schwarz findest du „Prints“, die dich durch das ganze Buch begleiten. Sie enthalten all die Fakten und das Wissen klassischer Sachbücher, nur eben kurz und leicht verständlich.
Auf dieser Doppelseite siehst du sie am linken und rechten Rand. Entscheide einfach selbst, ob du die Story dafür unterbrichst oder sie gerade zu spannend ist, weshalb du einfach weiterliest. Die Prints warten auf dich. Es gibt sechs verschiedene Prints, die du auch an den Symbolen gut unterscheiden kannst.
FACT PRINTS liefern dir aktuelles Hintergrundwissen zum jeweils gerade behandelten Thema.
FUTURE PRINTS stellen Erkenntnisse der Zukunftsforschung vor.
JOIN PRINTS sind Denkspiele für dich. Du entscheidest, ob du sie nur in deinem Kopf „spielen“ oder mit anderen teilen willst. Dafür findest du jeweils einen QR-Code.
SCORE PRINTS – am Ende der Kapitel 1 bis 4 – zeigen dir die Zwischenstände an. Es sind ausgewählte Learnings, die zur Rettung der Demokratie beitragen können.
ACTION PRINTS schildern, nachdem die Strategie zur Rettung der Demokratie gefunden ist, beispielhafte Maßnahmen zur Umsetzung. Über Maßnahmen, die bereits in der Story oder in Prints behandelt wurden, erfährst du relevante Hintergründe.
QUOTE PRINTS sind wörtliche Zitate.
Wann immer du einen QR-Code siehst, kannst du mehr erfahren. Oder Ideen teilen. Scanne einfach den QR-Code mit deinem modernen Smartphone und schon bekommst du zum Thema der Seite weiterführende Infos, Fotos und Filme.
Zwischen den Kapiteln findest du, was in den Wochen passiert, in denen du nicht dabei bist.
Diese Doppelseiten zwischen den Kapiteln haben den Farbcode weiß auf schwarz, sie sind also ebenfalls nicht fiktiv. Dort kannst du einen Blick hinter die Kulissen einer Unternehmensberatung werfen. Sie offenbaren tagtägliche, sonst für die Öffentlichkeit nicht zugängliche Prozesse. Und damit das so authentisch wie möglich ist, berichte ich dir dort aus unserer eigenen Unternehmensgruppe, also aus erster Hand.
Unten auf jeder Seite siehst du, in welcher Woche das Kapitel, das du gerade liest, stattfindet, und oben, jeweils in Kleinbuchstaben, als Erstes, in welchem Kapitel, und als Zweites, in welchem Topic du gerade bist.
Am Ende dieses Buches gibt es eine Lösungsformel. „Winning Formula“ würde wohl ein bisschen dick aufgetragen klingen, aber immerhin stecken in diesem Buch fünf Jahre Forschung in 391 Ländern der Welt, darunter alle 22 vollständigen Demokratien. (Natürlich war das keine One-Man-Show, denn ich habe das nicht allein geschafft, sondern mit vielen Helfern, denen ich dafür so dankbar bin!)
In der Geschichte wirst du außerdem eine Figur kennenlernen, die Ben heißt. Vielleicht wirst du dich fragen, ob die Ähnlichkeiten mit dem Autor zufällig oder beabsichtigt sind. Für die Zukunft der Demokratie ist das jedenfalls nicht wichtig.
Basis dieses Buches ist sogenannte Preta-Forschung2, die verschiedene Methoden mit dem Ziel besonders hoher Aussagekraft der Studienergebnisse kombiniert. Zur Preta-Forschung zählen auch weltweite Indizes, die du immer wieder im Buch findest (siehe Fact Prints), allen voran der Demokratieindex (Symbol Freiheitsstatue), mit dem alle anderen Indizes verglichen werden. Sie sind ein flammendes Plädoyer für die Demokratie.
Die Heldin dieses Buches heißt übrigens Agora. Agora ist nicht nur der Geburtsort der Demokratie, sondern bedeutet im Portugiesischen auch: Jetzt!
Viel Spaß beim Lesen!
So sieht das Smartphone-Icon
mit einem QR-Code aus.
Einfach mit deinem modernen
Smartphone scannen, schon bekommst
du zum Thema der Seite weitergehende Infos,
Fotos und Filme auf deinen Screen.
Auch kannst du damit deine
„Denkspiele“ der Join Prints teilen.
Kapitel eins
DAS MANDAT.
Topic eins Blind Date.
Ms. Agora. Dieser Name sagte mir nichts und auch mein Team hatte keine Anhaltspunkte zu der Unternehmerin, auf die ich gerade im Hamburger Hotel Vier Jahreszeiten am Neuen Jungfernstieg wartete.
„Seine Chefin sei nur kurz in Hamburg und der Assistent legte mir partout nicht offen, worum es geht. Aber du solltest sie dennoch treffen!“, hatte mir Yvonne, meine Persönliche Assistentin, gesagt.
Weil ich der Intuition meiner PA vertraute, saß ich nun ohne jeden Anhaltspunkt auf einem der, wie Hanseaten sagen, gediegenen Sofas in der eleganten Wohnhalle des Hotels, die von Hamburgern liebevoll als „Wohnzimmer“ bezeichnet und als solches genutzt wird. Der große, unter Denkmalschutz stehende holzgetäfelte Raum wirkte trotz der von schweren Samtvorhängen eingerahmten großen Panoramafenster und des Lichts, das die Kronleuchter verbreiteten, mitten am Tag gedämpft. Mein Blick schweifte durch die von Regentropfen überzogenen Scheiben nach draußen. Die Alster-Fontäne war kaum zu erkennen durch den Schleier, der über der winterlichen Stadt lag. Dank der vielen Passagen in Hamburgs Innenstadt hatte ich den Weg von unseren Büros am Gänsemarkt zum Hotel fast trockenen Fußes zurückgelegt. Kein anderes Bundesland wies im vergangenen Jahr mehr Sonnentage auf als Hamburg. Gerade aber zeigte sich die Stadt mal wieder von ihrer „besten“ Seite. Hoffentlich trug Ms. Agora einen Schirm bei sich.
Ich lehnte mich zurück und schlug die Beine übereinander. Meine schwarzen Schnürschuhe reichten dabei fast auf Augenhöhe, weil ich so tief in den Kissen des dick gepolsterten Sofas versank. Ich schaute mich in dem weitläufigen Raum um: Das Mobiliar war luxuriös, gepflegt und traditionell, es herrschte eine fast andächtige Atmosphäre. Überall standen Blumenbouquets. Nur wenige Tische waren besetzt, vorwiegend von älterem, internationalem Publikum, das meist in Zweiergrüppchen leise miteinander sprach. „Was sagte das über eine potenzielle Mandantin aus, wenn sie sich in einem so traditionellen, ja irgendwie steifen Ambiente treffen wollte?“, dachte ich und ertappte mich dabei, dass auch ich, der ich sonst eher eine moderne Location bevorzugte, dem Charme dieses Grand Hotels genauso erlag wie Tom Hanks oder Sophia Loren.
Im Kamin prasselte ein Feuer. Ich beobachtete die geschäftigen Kellner, die sich schnell und zugleich auf leisen Sohlen bewegten, und genoss die wenigen entspannten Minuten. Irgendwie freute ich mich auf diese mysteriöse Ms. Agora. Während ich den letzten Schluck von dem Ostfriesentee mit braunem Kandis nahm, den der Kellner auf dem Couchtisch platziert hatte, dessen Oberfläche einem goldenen Tablett glich, überlegte ich, ob mein Gast wohl Hunger haben würde? Ich hätte ihr den geräucherten Hamburger Aal auf Rührei und pfannengeröstetem rustikalen Schwarzbrot empfehlen können, hätte er nicht inzwischen unter Artenschutz gestanden. Da ich null Ahnung hatte, was mich erwartete, stellte ich mich auf nichts anderes als ein entspanntes Gespräch mit einer Unbekannten ein. Und essen musste ich ohnehin, sozusagen eine kulinarische Garantie, keine Zeit zu verschwenden.
Punkt 14 Uhr unterbrachen Kirchenglocken meine Gedanken. Als ob St. Petri, St. Nikolai und St. Michaelis, letztere Kirche besser als „Hamburger Michel“ bekannt, um die Wette läuteten. Konnte man die wirklich bis hier hören?
„Reisegepäck hat bei uns einen eigenen Eingang. Bitte hier lang, die Dame“, sagte jemand im Hintergrund. Unmittelbar darauf klackerte ein Stakkato von Absätzen auf dem Marmorboden, das schließlich von dem dicken Perserteppich verschluckt wurde, der unter meiner Sitzgruppe vor dem Kamin lag.
Ich erhob mich und noch während ich mich umdrehte, sagte eine freundliche und jugendliche Stimme: „Sie müssen der Professor sein. Ich bin Agora, danke, dass Sie sich Zeit für mich nehmen!“
Vor mir stand eine ältere Dame im aufgeknöpften Trenchcoat, auf dessen Schultern noch Spuren des Regens zu sehen waren. Darunter trug sie ein roséfarbenes Seidenkostüm. „Chanel“, tippte ich im Stillen und wunderte mich, wie eine so elegante Dame tatsächlich ohne Schirm unterwegs sein konnte. An ihrem rechten Arm hing eine der feinen Lederhandtaschen, deren Designer es zu vermeiden wussten, ein effekthascherisches Logo zu platzieren, und in der linken Hand hielt sie ein edles Seidentuch. Jedes graue Härchen ihrer eleganten Hochsteckfrisur saß perfekt, und das, obwohl sie das Tuch vermutlich kurz vorher noch zum Schutz vor Regen trug. Ihr Blick wendete sich kaum merklich zum Concierge, der sie zu mir geleitet hatte und im Hintergrund stehen geblieben war, worauf er ihr sofort den Mantel abnahm und sich mit einer angedeuteten Verbeugung verabschiedete.
Mit einem Lächeln reichte mir Agora die Hand. Ihre Augen waren von einem klaren, kühlen Blau und strahlten Intelligenz und Scharfsinn aus. Die vielen Fältchen in ihrem Gesicht, die davon erzählten, dass diese Frau schon viel erlebt hatte, standen in starkem Kontrast zu ihrem lebhaften Blick. Auch ihr Händedruck war erstaunlich fest für die langen, feingliedrigen Finger einer Hand, die einer Pianistin hätten gehören können. Ich bot ihr einen Platz an. Sie wählte den Sessel links neben der Couch. Wie aus dem Nichts tauchte der Tea Master auf, um ihre Bestellung aufzunehmen. Ich betrachtete Agora noch etwas genauer. Sie saß aufrecht, ja fast steif im Sessel. Ihre gesamte Erscheinung strahlte Eleganz und Autorität per Wimpernschlag aus. Wie alt sie wohl sein mochte? Schwer zu sagen, sie wirkte greisenhaft und jugendlich, zart und robust zugleich. Eine spannende Kombination.
Der Kellner wollte Agora die Speisekarte reichen, doch sie winkte mit einer kurzen Handbewegung ab. „Den Aal mit Rührei bitte, und einen Assam. Mit etwas Kandis. Vielen Dank.“ Während der Kellner ihr erläuterte, warum ihr Wunschgericht nicht mehr auf der Karte stand, lächelte ich in mich hinein: Dass sie ausgerechnet das bestellen wollte. Notgedrungen wich Agora auf Rösti mit Lachs aus. Der Blick des Tea Masters wanderte zu mir. „Für mich das Gleiche, bitte.“
Der Teamaster verbeugte sich vor Agora, als sei sie eine Königin. Kaum war er weg, wandte sich Ihre Majestät mir zu. Mit einer unerwartet hektischen Bewegung strich sie über den glatten Stoff ihres Rocks. Diese Frau wusste vermutlich genau, was sie wollte. Aber sie wirkte auch angespannt, wenngleich ich mir den Grund dafür nicht erklären konnte. Wahrscheinlich würde sie mir gleich mitteilen, warum wir uns hier trafen und was sie auf dem Herzen hatte. Aber sie sagte nichts, sondern lächelte nur und schaute mich mit offenem und interessiertem Blick an. Ungewöhnlich lange. Nicht unangenehm. Im Gegenteil.
„Sie sind nicht das erste Mal in Hamburg?“, fragte ich sie nach einer weiteren angenehmen Ewigkeit. Statt auf meine Frage zu antworten, kam Agora nun doch zur Sache. „Ich wende mich an Sie in einer etwas delikaten Angelegenheit.“ Sie verstummte und wartete, bis der Kellner, der erneut aus dem Nichts auftauchte, den Tisch auch für ihren Tee eingedeckt hatte. „Ich führe ein sehr traditionsreiches Familienunternehmen mit Niederlassungen unterschiedlicher Größe und Mitarbeiterzahl auf der ganzen Welt. Wir sind Marktführer. Die Besten in unserem Feld.“
So etwas hörte ich nicht zum ersten Mal. Sie schien wohl eine dieser Hidden Champions zu sein, die ihren Erfolg meist nicht an die große Glocke hängen. Bei dem Selbstbewusstsein, das sie an den Tag legte, vor allem aber bei der von ihr angesprochenen Marktrelevanz, hätte ich allerdings schon einmal von ihr gehört haben müssen.
Agora atmete tief durch. Auf mich wirkte es, als würden ihr die folgenden Worte nicht leicht über die Lippen kommen. „Ich bin sehr stolz auf mein Unternehmen. Unser Produkt ist denen der Konkurrenz haushoch überlegen, Kunden und Personal waren in der Vergangenheit sehr zufrieden. Ich will mich nicht beklagen, die Geschäfte gehen gut …“
Agora hörte wieder auf zu sprechen, als der Kellner mit unserem Tee zurückkehrte. Während er servierte, widersprach ich ihr stumm. Meine Gesprächspartnerin würde schließlich nicht mit dem CEO einer Managementberatung zusammensitzen, wenn alles bestens wäre. Ihr Interesse galt vermutlich nicht einem netten Teatime-Talk. Zumal sie ja gar nicht wissen konnte, was für ein netter Kerl ich bin, witzelte ich in Gedanken.
Mit präzisen Handbewegungen entfaltete Agora ihre weiße Stoffserviette, ließ zwei Stück Kandis in die Tasse mit dem schwarzen Tee, den der Kellner eingegossen hatte, fallen und nahm anschließend ihren Gesprächsfaden wieder auf: „Wissen Sie, in einigen Ländern laufen die Geschäfte reibungslos, in anderen hingegen kommt es vermehrt zu Komplikationen. Es gibt zunehmende Uneinigkeit in unserem internationalen Steuerungsgremium, was die Unternehmensausrichtung angeht. Schwächen in der Führung der einzelnen Niederlassungen. Unzufriedenheit, Frustration und Widerstand im Team. Seit einiger Zeit kommt es vermehrt zu Streiks. Manchmal scheint es mir, als sei unser Unternehmen und unser Produkt für alle zu selbstverständlich geworden. Als sei unsere Firma, unsere Tradition, die langanhaltenden Erfolge, die Kraft hinter unserer Marke nicht mehr von Relevanz. Ich kann das wirklich nicht nachvollziehen!“
Die Jugendlichkeit und Dynamik, die Agora bisher ausstrahlte, war im Handumdrehen einer gewissen Erschöpfung gewichen. Ihr Gesicht schien plötzlich eingefallener, die Augen müde, die Haltung gebeugter. Erstaunlich, wie sich die Stimmung eines Menschen von einem Moment zum anderen so verändern konnte.
Wieder verstummte Agora, als der Kellner den Lachs servierte. Agora nahm Gabel und Messer und schnitt ein Stück vom Rösti ab. Ich nahm einen Schluck Assam. Eine Weile genossen wir beide schweigend, während ich über die von ihr gewählte Formulierung, ihr Produkt sei zu selbstverständlich geworden, nachdachte, die mich unweigerlich an ein klischeehaftes Ehepaar denken ließ. Nicht selten gewöhnten sich die Partner über Jahre aneinander, wurden bequem, vermissten Überraschendes. Es fehlte an gegenseitigem Interesse und vor allem Wertschätzung und keiner engagierte sich mehr, den anderen für sich zu gewinnen. Und eines Tages verlangte einer plötzlich wegen angeblicher Unvereinbarkeit der Charaktere die Scheidung. Genauso wirkte Agora gerade: als hätte ihr Partner sie vor vollendete Tatsachen gestellt.
„Unser Unternehmen ist so viel besser als die Konkurrenz!“ Mit Nachdruck legte sie ihr Besteck zurück auf den Teller. „Mittlerweile mache ich mir ernsthaft Sorgen, ob es uns in 30 Jahren noch geben wird. Um diese Frage positiv zu beantworten, wünsche ich mir Ihre Hilfe!“ Sie sah mir wieder lang in die Augen und beendete die Pause schließlich mit: „Vermutlich ein ungewöhnliches Briefing für Sie!?“
„Nein!“, antwortete ich ebenso kurz wie unaufgeregt. Das sanfte Lächeln und das neugierige Blitzen in Agoras Augen wertete ich als gutes Zeichen. Vielleicht war sie eine potenzielle Mandantin, die trotz einer nicht zu leugnenden Überheblichkeit, ja beinahe Arroganz in der Lage sein konnte, eine andere Sichtweise zuzulassen oder vielleicht sogar anzunehmen. Letzteres ließ mich Yvonnes Empfehlung schätzen, ausnahmsweise ein „Business Blind Date“ akzeptiert zu haben.
Ich griff erneut nach meiner Teetasse und trank einen Schluck und noch einen, bevor ich meiner Gesprächspartnerin schließlich erläuterte, dass seit den disruptiven Veränderungen, die vielen Menschen erst nach dem Niedergang von Unternehmen wie Nokia und Kodak bewusst geworden waren, Vorstände regelmäßig dieses Briefing im Gespräch mit uns formulierten.
„Der Unterschied zu Ihnen mag allerdings darin liegen, dass viele Vorstände nur die Kraft der Provokation nutzen. Sie selbst aber mögen noch gar nicht recht an eine Dramatik glauben, um dann doch die Schonungslosigkeit jener erarbeiteten Wahrheit, ob positiv oder negativ, von uns zu hören. Kurz: Die tatsächliche Sorge, die ich bei Ihnen spüre, mag in anderen Fällen nicht immer so groß sein.“ Einigen Unternehmern und Managern fehlte auch die Erfahrung, dass gute Berater keine Wattebäuschchen werfen, nur weil wichtige, Land auf, Land ab bekannte Persönlichkeiten die Empfänger der Arbeitsergebnisse sind. Das sagte ich ihr aber nicht. „Was haben Sie denn bisher unternommen, um sich der Frage, ob es Sie im Jahr 2050 noch geben wird, zu widmen?“
Agora musste nicht lang überlegen. „Nun ja, zunächst habe ich den Auftrag zur Optimierung unserer Prozesse intern auf Länderebene in Gremien und Arbeitsgruppen und dann extern an Beratungsfirmen erteilt.“ Dabei reihte sie wie selbstverständlich Namenskürzel bekannter Unternehmensberatungen aneinander, was mir zeigte, dass sie sich durchaus auskannte. „Leider“, fuhr sie fort, „klang vieles wie ein Echo unserer eigenen Leute. Mit den üblichen Quick Fixes, die man mir vorschlug, ging es keinen Millimeter vorwärts. Die Probleme blieben, sie haben sogar zugenommen. Ganz ehrlich: Sie sind mein letzter Versuch, auf externe Beratung zu setzen.“
„Welches sind denn die problematischsten Niederlassungen?“, wollte ich von ihr wissen.
„Probleme gibt es in Indien und Brasilien, in den USA, in einigen europäischen Niederlassungen, zum Beispiel in der Türkei, aber auch in Deutschland, einem diffizilen Markt, jahrzehntelang solide, läuft es nicht mehr rund. Das Gleiche gilt für Frankreich, Spanien und Italien. In Europa funktioniert es zwar besser als in den USA, aber von ‚gut‘ kann man derzeit gerade mal in den skandinavischen Ländern und vielleicht noch der Schweiz und Kanada sprechen.“
Dieses internationale Monopoly ließ mich aufhorchen. Der eigenartige Mix aus problematischen Märkten erschloss sich mir jedoch nicht. Warum machte sie bloß ein solches Geheimnis aus ihrem Business?
„Und ja, Sie sehen das richtig. Ich bin tatsächlich in großer Sorge. Umfragewerte in den kritischen Ländern haben ergeben, dass das Vertrauen in unser Produkt sinkt. Und das darf ich nicht zulassen.“ Sie schlug mit der flachen Hand auf die Lehne ihres Sessels, fasste sich aber schnell wieder. „Darf ich ganz offen sprechen?“
Ich nickte ihr ein „Selbstverständlich“ zu.
„Ich habe das Gefühl, dass die Konflikte fast überall zunehmen. Aber statt Bereitschaft zu zeigen, die Ursachen der bestehenden Probleme auszumachen und das Unternehmen nach den länderspezifischen Bedürfnissen neu auszurichten, fokussiert sich ein Großteil der Führungsmannschaft auf interne und externe Machtkämpfe.“ Mir fiel auf, dass sie von „Mannschaft“ sprach. „Dabei polarisiert genau das noch mehr.“ Sie schüttelte den Kopf. „Manchmal frage ich mich wirklich, was in den Köpfen meiner Leute vorgeht.“
„Mögen Ihre Mitarbeiter Sie?“, lenkte ich ihre Aufregung in eine neue, wenngleich nicht zwingend pulsärmere Richtung.
„Also bitte! Ich will nicht geliebt, ich will respektiert werden!“ Agoras Widerrede kommentierte ich mit einem unsichtbaren Schmunzeln. In solchen Gesprächen passierte es anfangs oft, dass Unternehmer versuchten, Emotionen außen vor zu lassen oder ihre emotionalen Entscheidungen rational zu begründen. Chefs sind auch nur Menschen und sie treffen die meisten Entscheidungen emotional, selbst die finanziellen, wie es schon der Tiefenpsychologe Sigmund Freud und aktuell der Verhaltensökonom und Wirtschaftsnobelpreisträger Prof. Richard Thaler mit seinen Arbeiten zu Abweichungen menschlichen Verhaltens von der Rationalitätsannahme bewiesen.
„Glauben Ihre Leute an Sie?“, versuchte ich erneut, mehr als nur Protest bei ihr auszulösen. Denn ich bin davon überzeugt: Menschen wollen für Unternehmen arbeiten, von ihnen kaufen und in Firmen investieren, an die sie glauben. Mitarbeitende müssen mögen, was sie tun, damit sie sich täglich gern den Wecker stellen. Vertrauen in die Aufrichtigkeit der unternehmerischen Motive treibt sie nicht weniger an als betriebswirtschaftliche Faktoren.
Die Antwort auf meine Frage blieb mir Agora schuldig. „Sehen Sie nur, es hat aufgehört zu regnen“, sagte sie stattdessen. „Wollen wir uns etwas die Beine vertreten?“, schlug ich vor, um unserem Gespräch eine neue Dimension hinzuzufügen. Im Hinterkopf hatte ich dabei noch mehr: Ich wollte einige Etappen auf dem Weg nutzen, um ihr zu zeigen, wie erfolgreiche Unternehmen der Zukunft ticken.
Topic zwei Walk and Talk.
„Sie hatten ein Steuerungsgremium erwähnt“, hakte ich nach, während wir in Richtung Außenalster marschierten. „Arbeiten Ihre Niederlassungen denn international zusammen oder operieren sie eher weitgehend getrennt voneinander?“ Agora schaute mich überrascht von der Seite an, einmal mehr, ohne zu antworten. Scheinbar war Ihre Majestät gewohnt, dass Ihre ausbleibenden Antworten als Schweigebefehl galten. Leider musste ich sie enttäuschen und beharrte auf einer Antwort: „Agora?“
„Weitgehend getrennt, bei vergleichbaren Geschäftsmodellen“, erwiderte sie knapp. Schweigend liefen wir weiter. Wieder überraschte sie mich, diesmal mit einem für ihr fortgeschrittenes Alter ungewöhnlich schnellen Schritt. Entweder sie kannte sich gut in Hamburg aus oder sie gehörte zu jenen Menschen, die selbst auf unbekanntem Terrain wussten, wohin sie wollten. Auf jeden Fall erinnerte mich ihre Geschwindigkeit eher an eine sportliche Disziplin als an einen innovativen Spaziergang, den wir in unserer Beratungsgruppe „Walk-and-Talk Meet“ nannten. Den Begriff „Walk and Talk“ verwendeten Film- und Fernsehproduktionen ursprünglich als Storytelling-Technik, um zu suggerieren, wie beschäftigt eine fiktive Figur war. Für mein Team und mich bedeutete diese Form eines auf wenige Gesprächsteilnehmer beschränkten Meetings eher das Gegenteil. Sie entfaltete ihre Kraft durch Entschleunigung und Bewegung an frischer Luft.
„Was ist denn Ihre Exitstrategie?“, fragte ich, um Agoras Schrittgeschwindigkeit zu bremsen.
„Wie bitte?“ Sie sah mich irritiert an, während sie ihr Tempo tatsächlich reduzierte. „Wie kommen Sie darauf, dass ich aufgeben will?“
„Sind Sie sicher, dass Sie das nicht wollen?“
„Aber natürlich!“ Das Ausrufezeichen hinter ihrer Antwort war förmlich in der Luft zu lesen.
„Also auf mich wirken Sie wie ein klassischer Übernahmekandidat.“
„Das ist jetzt nicht Ihr Ernst!“ Agora blieb abrupt stehen. Ich spürte die Entrüstung, die sie nur mit Mühe unterdrücken konnte, und dachte: Na bitte, hat geklappt. Endlich Butter bei die Fische! Diese norddeutsche Redewendung brachte es auf den Punkt. Sobald die geschmacksverstärkende Butter auf dem gebratenen Fisch war, durfte gegessen werden. Wir konnten also endlich zum Wesentlichen kommen, um das sich meine Gesprächspartnerin seit Beginn elegant herumdrückte. Vermutlich hatte noch niemand gewagt, so etwas zu ihr zu sagen.
„Nur damit wir uns verstehen: Ich habe eine wertvolle Errungenschaft zu verwalten. Und kommen Sie mir jetzt bloß nicht damit, dass ich Kosten einsparen und Mitarbeiter entlassen muss. Das habe ich schon zu oft gehört.“
Ich war hingerissen von den neuen Facetten, die meine bisher eher unterkühlte Gesprächspartnerin offenbarte. Und auch ein wenig davon, dass es mir gelungen war, sie aus der Reserve zu locken. Ich mochte ihre Leidenschaft und auch die Bockigkeit, die sie gerade an den Tag legte.
„Aber man nimmt mich und meine Errungenschaft gar nicht mehr wahr. Ich bin wie …“, sie rang nach den treffenden Worten, „… wie Luft. Alle atmen mich, aber keiner macht sich bewusst, woher der Sauerstoff kommt. Manchmal frage ich mich, ob ich zu alt für diese Aufgabe geworden bin.“
„Wen sehen Sie denn als Ihre unmittelbare Konkurrenz?“, warf ich, während wir uns wieder in Bewegung setzten, sachlich ein, um sie dabei zu unterstützen, sich etwas zu beruhigen.
„China!“, kam es wie aus der Pistole geschossen.
„Und warum?“ „Warum“ ist für mich das wichtigste Wort eines Beraters.
„Weil die dortige Art der Unternehmensführung auf Kontrolle und Angst basiert. Und das widerspricht meinen Werten, die auf Eigenverantwortung, Gleichberechtigung, Austausch und Konsens fußen.“
Welch gute Botschaft, dachte ich.
Schweigend schlenderten wir am Restaurant des Fernsehkochs Tim Mälzer vorbei. Nach meinem Fragenhagel der letzten Minuten verzichtete ich darauf, weiter zu bohren, damit sich Agora in Ruhe umsehen konnte. Nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 wurde die Straße „Alsterufer“ mit Schutzmaßnahmen für das hier befindliche Generalkonsulat der USA ausgestattet, das wir gerade passierten. Während sich ihr Blick nach links dem Prachtbau im klassizistischen Stil zuwandte, dem Weißen Haus in Washington nachempfunden, wanderte meiner nach rechts zur Alster. Ich spürte gerade die gleiche Zufriedenheit, hier zu sein, wie jeden Montag- und Mittwochmorgen, wenn ich keine dunklen Schnür-, sondern helle Laufschuhe trug, sofern ich in Hamburg war. Wie schön die Hansestadt doch war.
„Kaufmann!“, murmelte Agora mit ernster Miene vor sich hin, ohne mich anzuschauen. Ihr unvermittelter Gedankensprung zum hanseatischen Kaufmann ließ mich ihre Unternehmensentwicklung positiver sehen. Denn die dem Hanseaten zugeschriebenen Werte Verlässlichkeit, Anstand und Fairness waren schon immer eine harte Währung und würden Ökonomien künftig mehr prägen als bisher. Nachhaltiges Wirtschaften und Verantwortung für das Gemeinwohl werden heute nicht mehr nur dem hanseatischen Kaufmann zugeschrieben, sondern sind entscheidende Zukunftskriterien qualitativer Ökonomien.
Das war nicht immer so. Als der gern zitierte Begriff des Ehrbaren Kaufmanns im Jahr 1517 mit Gründung einer gleichnamigen Interessengemeinschaft seinen Ursprung nahm, war „ehrbar“ nicht gleichbedeutend mit „ethisch“. Als ehrbar galt, wer Erfolg hatte. Und das hatten die Kaufleute, zum Beispiel in der Hanse. Sie etablierten Hamburg als Knotenpunkt, dem prosperierenden Seehandel sei Dank. Dabei waren sie viel mehr ökonomisch ausgerichtet und viel weniger moralisch. Es gehörte einfach zum guten Ton des eigenen Geschäfts, weltweit einen guten Namen zu haben. Am anderen Ende der Welt galten andere, manchmal keine und oft wechselnde Gesetze. Da war der Handschlag, war Vertrauen, waren Verbindungen ohne kurzfristiges Denken elementar. Ihr ernster Tonfall jedoch, mit dem Agora den „Kaufmann“ noch einmal wiederholte, mochte nicht recht zu meinem Gedanken der zukunftssicheren Ausrichtung auf qualitative Ökonomie passen.
„Agora?“, fragte ich deshalb. Reflexhaft drehte sie sich um: „Der Druck der chinesischen Konkurrenz auf unsere Märkte nimmt von Tag zu Tag zu.“
Ich konnte ihre Sorge im Hinblick auf China nachvollziehen. Die zu beobachtende Kapitalismusdepression fiel mit einem Hype des Staatskapitalismus zusammen. Die Ökonomien westlicher Länder hätten ein Katalysator für den Wandel hin zu einer qualitativen Ökonomie sein können, nur leider begannen die meisten Unternehmen das Ausmaß von Chinas wirtschaftlicher Machtausweitung gerade erst zu verstehen.
„Haben Sie Lust auf eine kleine Spritztour? Ich würde Ihnen gern etwas zeigen.“ Um aus der gedanklichen Sackgasse zu finden, in die Agora wohl gerade geraten war, schien es mir erneut Zeit für einen Ortswechsel. Ich checkte meine Car-Sharing-App, die mir einen verfügbaren Wagen in einigen Metern Entfernung gegenüber vom Hotel Fontenay anzeigte.
„Oh“, entfuhr es Agora, als ich den ID.3 startete. „Kaum zu hören“, kommentierte sie den E-Volkswagen, mit dem Tesla das Leben weniger leicht gemacht werden sollte. Ein paar Minuten später fuhren wir auf der anderen Seite der Außenalster entlang, eine beliebte Strecke der Touristenbusse, die den Gästen der Stadt die imposanten Villen und Gärten wohlhabender Hamburger zeigten. Keine 20 Minuten davon entfernt, am Holstenplatz, wo in Hamburg viele Kulturen aufeinandertrafen, lag unser früheres Headquarter: ein großes Bürogebäude, in deren beiden obersten Etagen wir viele Jahre lang die Gruppe führten.
„Ich würde Ihnen gern die Vergangenheit unseres Unternehmens zeigen“, sagte ich, während ich den Wagen in die Tiefgarage lenkte. Mit dem Aufzug fuhren wir in die oberste Etage, die sich öffnenden Lifttüren gaben den Blick frei auf die Lobby unserer alten, leergeräumten Büros, nur die in das geflämmte Eichenparkett eingelassenen Firmenbuchstaben aus poliertem Edelstahl erinnerten noch an unsere Arbeit hier. Agora ging an eine große, runde Fensterfront, die sie, wie sie sagte, an die Kommandozentrale eines Überseeschiffs erinnerte und eine fantastische Aussicht über die Dächer Hamburgs freigab. Ein Traumblick gerade jetzt, wo der Himmel nach dem Regen ganz klar war. Südöstlich lag die Elbphilharmonie und südwestlich wiesen die Hafenkräne den Weg zur Elbchaussee. „So hat man früher gearbeitet.“
Sie drehte sich mit erstauntem Gesichtsausdruck zu mir. „Das ist hier doch schön. Und modern. Warum ist das Vergangenheit?“
„Die Zukunft von Arbeit hat nun mal nichts mehr mit einem Chef und Mitarbeitern zu tun, die alle ganz selbstverständlich hinter verschlossenen Türen sitzen. Als Unternehmen, das sich täglich mit Zukunft befasst, wollten wir nicht in Büros von gestern zu Hause sein, auch wenn sie noch so schön sind, sondern die Zukunft des Arbeitens vorleben. Kreativität auf der einen Seite und Soziabilität, unter der wir gemeinschaftliches Zusammenwirken verstehen, auf der anderen Seite sind die entscheidenden Faktoren des menschlichen Miteinanders, ja der Alleinstellung von Menschen gegenüber Maschinen. Diese beiden Parameter machen die freien Gesellschaften dieser Welt zukunftsfähig. In der Vergangenheit wurde ein Unternehmen durch Produkte und Dienstleistungen, oft mühsam über Jahrzehnte etabliert, erfolgreich. Aber in der heutigen Zeit gibt es keinen Kredit mehr auf die Vergangenheit.“ So in etwa hatte es Karl Lagerfeld, der verstorbene Hamburger und Chefdesigner von Chanel, einmal treffend formuliert.“ Agoras Lippen umgab ein süffisantes Lächeln. Sie schien meine Anspielung auf ihr Kostüm verstanden zu haben.
„Früher stellte man sich den Ausdruck von Unternehmenserfolg so vor.“ Ich ging mit ausgebreiteten Armen durch die große Chefetage. „Fahrstuhl direkt ins Office, Eckbüros für verdiente Kollegen, Vorzimmerdamen, selbstschließende, geräuschabsorbierende Türen und eine Etage nur für die Geschäftsführung, natürlich ganz oben, über allem. Aber die Welt hat sich verändert. Die Menschen sind mündiger geworden, haben ein viel stärkeres Bedürfnis nach Teilhabe, Sinnhaftigkeit ihres Tuns und bestärkenden Erfahrungswelten. Das gilt besonders bei Wissensarbeitern. Das Team, die zusammenarbeitende Community erfährt eine viel höhere Wertschätzung. Dieser Gemeinschaftsgedanke wird sich künftig noch stärker durchsetzen. Also haben wir uns entschlossen, unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen die Freude an partizipativem Denken und den Spaß am Miteinander-Arbeiten auch durch entsprechende Bürolandschaften aktiv zu ermöglichen. Und wir lernen viele interessante und inspirierende Leute kennen, weil wir nicht abgeschottet sind von anderen Unternehmen. Im Mit- statt im Nebeneinander erfährt Gemeinschaft eine ganz neue Bedeutung.“
Agoras skeptische Miene traf mich, noch bevor ich fertiggesprochen hatte. Dieser Blick war mir aus Gesprächen mit anderen Unternehmenslenkern vertraut. Wahrscheinlich dachte sie gerade, dass das für Start-ups gelten mochte, aber nicht für ein Unternehmen ihres Kalibers. „Wer glaubt, in einer Co-Working-Atmosphäre seien nur Freelancer oder Anfängerfirmen zu finden, irrt gewaltig. Rund die Hälfte solcher Flächen werden weltweit schon von sogenannten ‚Corporates‘, also bedeutenden Konzernen, genutzt. Das wissen die meisten nur nicht.“
„Ich verstehe zwar noch nicht, wie genau mir das weiterhelfen wird, aber zumindest haben Sie mich neugierig gemacht.“
„Immerhin. Dann zeige ich Ihnen jetzt die Zukunft.“
Topic drei Ortstermin Gänsemarkt.
15 Minuten später rollten wir auf dem Weg zur Tiefgarage unserer neuen Hamburger Büros in Schrittgeschwindigkeit durch diese inspirierende Innercity-Mischung aus Touristen aus aller Welt, Teenies vor ihren Lieblingsläden, lässigen Stadtbummlern, aufgetakelten Luxusshoppern und geschniegelten Bankern, denen unsere Büros etwas suspekt erschienen.
Als wir in der zweiten Etage aus dem Aufzug stiegen, ging Agora wie schon zu Beginn unseres Spaziergangs entschlossenen Schrittes durch die Glastüren, die ich ihr aufhielt, in den hellen, großen Raum, der mit Tischen und vielen gemütlichen Sitzgelegenheiten eingerichtet war. Während meine Begleiterin sich umsah, winkte ich einer Gruppe von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu, die in der Mitte des Raumes an einem großen Holztisch diskutierten. Vereinzelt arbeiteten Teammitglieder auch in den bequemen Sesseln am Laptop. Sie nahmen keine Notiz von uns. Etwas abseits in einem kleinen Glasbüro saßen zwei unserer Leute in einem Videocall. Und in einer Ecke wurde auf dem Sofa gerade für unseren Futurecast, ein Videopodcast zum Thema Zukunft, ein Interview mit einem CEO geführt.
„Das ist ja interessant. Ihre Mitarbeiter wirken so … konzentriert und gleichermaßen entspannt. Eine angenehme Atmosphäre, das muss ich schon sagen. Aber ich bezweifle, ob das in einem Konzern wie dem meinen umsetzbar wäre. Wir sind die Besten in unserem Feld und damit das so bleibt, brauchen wir ein gutes Management mit klaren Strukturen. Sie verstehen, was ich meine.“
„Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass Formen von vergemeinschaftetem Arbeiten ganz unabhängig von der Unternehmensgröße mit weniger Hierarchie auskommen und zugleich viel mehr erreichen. Den Teams kommt es dann nämlich weniger darauf an, wie gut jeder Einzelne ist, sondern wie gut sie alle zusammen sein wollen, um an das Ziel, das größer ist als sie selbst, zu gelangen. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Einen Kaffee oder ein Wasser?“
Statt mir zu antworten nahm sie sich selbst eine Cola aus dem gläsernen Kühlschrank. Ich reichte ihr ein Glas aus dem Regal, aber sie lehnte ab und nahm einen ersten Schluck direkt aus der Flasche. Ich tat es ihr gleich. Während wir zu einem der Sofas im hinteren Teil des Raumes gingen, fragte sie: „Wie schaffen Sie es, dass Ihre Leute tun, was sie sollen?“ Bevor ich antworten konnte, klingelte Agoras Handy. Sie schaute auf das Display. „Bitte entschuldigen Sie, da muss ich kurz ran.“ Sie stand auf und stellte sich in ein paar Schritten Entfernung ans Fenster.
Ich nahm mein MacBook und checkte meine Mails. Zuoberst die Nachricht einer Mitarbeiterin, mit der ich am Morgen über einen wichtigen, aber schwierigen Kunden gesprochen hatte. „Wie wollen Sie das Problem lösen?“, hatte ich sie gefragt. Nachdem sie mir ihren geplanten Weg skizziert hatte, hatte sie mich gebeten, mir ihren Entwurf für eine Antwortmail schicken zu dürfen. Mit Begeisterung las ich nun ihre Zeilen. Perfekt im Lösungsweg, brillant in der Formulierung. „Das kann so raus“, schrieb ich zurück. Ich klickte auf „Antworten“, um meiner Mitarbeiterin grünes Licht zu geben, und stellte dabei fest, dass die Mail bereits an den Kunden gegangen war, den Vorstandsvorsitzenden eines großen Konzerns. Ohne mein Feedback, um das sie gebeten hatte?
Agoras laute Stimme riss mich aus meinen Gedanken. „Das darf doch nicht wahr sein. Kaum bin ich weg, läuft alles schief.“ Sie wanderte ungeduldig auf und ab. Um nicht aufdringlich zu wirken, griff ich zum Handy und rief meine Mitarbeiterin, die in einer anderen Etage saß, an.
„Sie haben die Mail ja bereits abgeschickt!“
„Ja. War etwas daran auszusetzen?“
„Nein, nichts. Alles perfekt. Hätte ich nicht besser hinbekommen.“
„Und warum hätte ich sie dann nicht rausschicken sollen?“
„Touché“, antwortete ich und bedankte mich bei ihr stolz für ihre gute Arbeit.
Mit geröteten Wangen kehrte Agora zu unserem Platz zurück und entschuldigte sich für die Unterbrechung. „Wo waren wir stehen geblieben?“ „Sie wollten wissen, wie ich meine Mitarbeiter dazu bringe, Verantwortung zu tragen und erfolgreich zu sein. Meine Antwort: Das machen sie selbst. Es geht um ein Miteinander in Eigenverantwortung. Menschen, die heute bereits 30 Jahre im Berufsleben stehen, fällt es leichter, sich unterzuordnen. Aber die jüngeren Generationen haben andere Vorstellungen von Autorität. Sie sind weniger obrigkeitsgläubig und orientieren sich stärker an digitalen Kompetenzen.“
Agora setzte sich wieder, nahm einen Schluck Cola, dann war sie wieder ganz Ohr. „Junge Menschen navigieren heute ganz anders durch die Welt, vor allem virtuell. Ihr Gehirn hat andere neuronale Verknüpfungen, was sich wissenschaftlich beweisen lässt. Ich sehe das an meinen eigenen Kindern. Nie in der Menschheitsgeschichte waren Achtjährige ihren Eltern und ihren Großeltern in einer Schlüsselkompetenz, in diesem Fall dem Umgang mit digitalen Medien, so überlegen. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie in Ihrem Unternehmen das gleiche Problem haben.“
„Ich habe aber nicht nur junge Leute. Mein Team ist, wie man heute so schön sagt, divers. Vielleicht sollte ich Ihnen an diesem Punkt mehr über uns erzählen.“
„Gern.“ Ich lehnte mich zurück und dachte nochmals an die gebutterten Fische wie vorhin an der Außenalster.
„Sie müssen wissen, dass wir eine sehr lange Tradition haben. 2.300 Jahre, um genau zu sein. Zugegeben mit einigen Höhen und Tiefen dazwischen.“ Um welches Unternehmen soll es sich da handeln? Langsam war mir Agora nicht mehr geheuer. Doch ich beschloss, erst einmal still zuzuhören und so zu tun, als habe sie sich versprochen. Vielleicht sagte sie ja auch 230 Jahre, was schon ein sehr, sehr langer Lebenszyklus für den Verlauf einer Unternehmensentwicklung war. „Ich war die Gründerin“, schob sie beiläufig hinterher.
Wie bitte? Die Gründerin – vor 2.300 Jahren?
„Wie schon angedeutet haben wir unzählige Herausforderungen gemeistert. Daher bin ich selbstbewusst, was unseren Erfolg und unsere Reputation angehen.“
„Aber?“, fragte ich. Dieses rückwärtsgewandte Selbstbewusstsein störte mich allmählich doch. Wieso wehrten sich so viele Unternehmer gegen die Tatsache, dass das Gestern die Zukunft eines Unternehmens nicht sichern konnte? Ich sagte aber nichts, weil ich sie nicht belehren wollte.
„Nun ja, in den letzten zehn Jahren beobachte ich eine zunehmende Spaltung zwischen Führung und Belegschaft, ebenso wie innerhalb der Belegschaft selbst.“
„Und worauf führen Sie das zurück?“
„Na ja, ich hatte es schon kurz angedeutet. Meine Leute sind satt und selbstzufrieden. Irgendwie können sie sich nicht auf große Ziele einigen.“
„Können Sie mir ein Beispiel geben?“
„Nehmen wir die USA. Der Vorgänger des aktuellen CEO hat es innerhalb von vier Jahren geschafft, dass es tatsächlich zur Revolte kam. Dabei hatte dessen Vorgänger die Stimmung im Unternehmen zunächst verbessert, weshalb sein Vertrag auch nach vier Jahren verlängert wurde. Nach seiner Zeit bei uns schrieb er in einem Buch … wie war das noch gleich?“ Agora öffnete ihre Tasche, holte ihre Lesebrille und ein kleines Notizheft heraus. Dann las sie vor: „‚Wir taumeln am Rande einer Krise, einer Krise, die ihren Ursprung in der fundamentalen Auseinandersetzung zwischen zwei widerstreitenden Visionen davon hat, was Amerika ist und was Amerika sein sollte.‘“2 Sie schaute von ihren Notizen hoch und fügte nicht ohne eine gewisse Entrüstung hinzu, „Wie finden Sie das?“
Diese Zeilen kannte ich doch. Wo hatte ich die bloß gelesen? Noch bevor ich reagieren konnte, sprach Agora weiter: „Es gab einmal eine Zeit, in der die Führungskräfte einer gemeinsamen Vision verpflichtet waren. Aber das ist lange her. Heute sind alle so kleinteilig geworden. Da wird mehrheitlich über die diversen Interessen gestritten und jeder versucht, dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Mittlerweile scheint es mir, als wäre dieses Auseinanderdriften unaufhaltsam.“
Während Agoras Ausführungen dämmerte mir auf einmal, wo ich die Sätze von ihrem Notizzettel gelesen hatte. Sie stammten aus der Autobiografie eines amerikanischen Präsidenten. Und schlagartig hatte ich eine Ahnung, wen ich da vor mir sitzen hatte. Dieser Moment ergriff mich, was mir im Business äußerst selten passierte. Und ich tat, was ich seit Jahren nicht mehr getan hatte. Ich spielte mit der Spitze meines rechten Daumens an der unteren, weichen Haut am Rand des Ringfingers derselben Hand, an dem sich der Ehering befindet. Seit Jahren trug ich schweren Herzens – genau um nicht damit zu spielen – den Ring nicht mehr. Das hatte perfekt geklappt. Bis heute. Was, wenn ich völlig danebenlag und mich bis auf die Knochen blamierte? Aber meine Vermutung hätte alle Ungereimtheiten, die sich seit Agoras Ankunft im Vier Jahreszeiten ergeben hatten, aufgeklärt: Dass sie mit Begriffen aus der Wirtschaft, wie zum Beispiel „Marktführer“, jonglierte, obwohl sie, wenn ich richtiglag, gar nicht aus der Wirtschaft stammte. Oder auch, dass ihr Unternehmen 2.300 Jahre alt sein sollte. Dann hatte ich mich doch nicht verhört. Ich mochte es kaum aussprechen, aber offensichtlich befand ich mich gerade im Gespräch mit einer möglichen Mandantin, die ich mir schon immer gewünscht hatte: die Demokratie!
LADY LIBERTY.
Die Freiheitsstatue wurde 1984 zum Weltkulturerbe erklärt. Sie ist ein Kunstwerk und lebendiges Symbol der Freiheit und gehört zu den höchsten Statuen der Welt. Sie wurde den USA von Frankreich als Zeichen internationaler Freundschaft geschenkt und stellt Libertas, die Göttin der Freiheit, dar. Das Monument hält eine Fackel in der rechten Hand hoch und in der linken trägt sie eine Tafel mit dem Datum der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Eine zerbrochene Kette liegt zu ihren Füßen und symbolisiert die Befreiung von Unterdrückung. Sie wurde am 28. Oktober 1886 eingeweiht.
Ergebnisse der Preta-Forschung werden in diesem Buch in Fact Prints regelmäßig mit dem Demokratieindex in Beziehung gesetzt. Das Freiheits-Icon zeigt dann jeweils den Platz der Länder im Ranking.