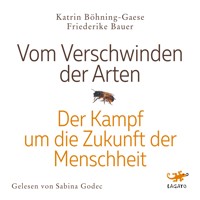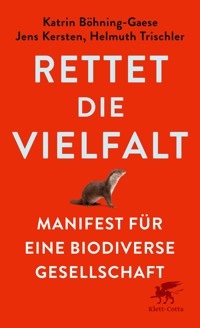
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wir brauchen die biodiverse Wende! Der dramatische Verlust der Artenvielfalt erfordert einen tiefgreifenden Wandel in allen Lebensbereichen. Die Biodiversität muss zur Grundlage unseres Zusammenlebens werden. Dies kann nur gelingen, wenn wir dabei biologische, kulturelle und technische Diversität in unserem gesellschaftlichen Leben verbinden. Dieses Manifest bietet Thesen und konkrete Lösungen, wie wir Politik, Recht und Wirtschaft ändern müssen, um die größten ökologischen Herausforderungen der Gegenwart zu meistern. Wir müssen unser Leben von Grund auf neu denken: Als industriell geprägte Wohlstandsgesellschaft haben wir die Natur ausgebeutet. Es ist an der Zeit, uns selbst als eine Spezies zu sehen, die Teil einer biodiversen Gesellschaft ist. Programmatisch offen und zukunftsorientiert zeigen die Autor:innen auf, wie sich unser Selbstverständnis ändert, wenn wir uns an einem artenübergreifenden orientieren. Es herrscht eine gefährliche Unkenntnis darüber vor, wie das massenhafte Sterben der Arten Grundlagen unserer Kultur, unserer Wirtschaft und letztlich auch unserer demokratischen Lebensweise gefährdet. Aus diesem Grund gilt es, ein neues lokales und globales Zusammenleben mit der Natur zu entfalten. Doch wie könnte und sollte eine solche biodiverse Gesellschaft aussehen? Ebenso wissensbasiert wie provokant stellen die Autor:innen derzeitige Denkmuster und Entscheidungsgrundlagen in allen Lebensbereichen in Frage: Es kommt darauf an, den Eigenwert der Natur mit der menschlichen Existenz zu verbinden, um die Möglichkeiten eines zukunftsfähigens Zusammenlebens aufzuzeigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 209
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Katrin Böhning-GaeseJens Kersten, Helmuth Trischler
Rettet die Vielfalt
Manifest für eine biodiverse Gesellschaft
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH,gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text undData Mining i. S. v. § 44 b UrhG vorbehalten
Cover: © Rothfos & Gabler, Hamburg
unter Verwendung einer Abbildung von © mauritius images/Life on white/Alamy/Alamy Stock Photos
Gesetzt von C.H.Beck.Media.Solutions, Nördlingen
Gedruckt und gebunden von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-608-96649-7
E-Book ISBN 978-3-608-12408-8
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
I. Entwicklung: Artenvielfalt und Artensterben
Was ist Biodiversität?
Wie entwickelt sich Biodiversität?
Warum verschwindet Biodiversität?
Welche Folgen hat der Verlust von Biodiversität?
Wie kann Biodiversität gefördert werden?
II. Begriff: Die biodiverse Gesellschaft
Biodiverser Konvivialismus
Menschen, Naturen, Kulturen
Von der Risikogesellschaft zur vulnerablen Gesellschaft
Der biodiverse Gesellschaftsvertrag
III. Prinzip: Konviviale Nachhaltigkeit
Von Hans Carl von Carlowitz zum Brundtland-Bericht
Kritik der nachhaltigen Vernunft
Neue Ansätze nachhaltigen Denkens
Das konviviale Nachhaltigkeitsprinzip
IV. Infrastrukturen: Ökologische Daseinsvorsorge
Die ökologische Ignoranz der Infrastrukturen
Begriff und Funktionen biodiverser Infrastruktur
Typen biodiverser Infrastruktur
Wandel der Kritischen Infrastruktur
V. Politik: Die nachhaltige Verfassungsordnung
Rechte der Natur
Nachhaltiges Eigentum
Ökologische Demokratie
Recht auf Zukunft
VI. Wissenschaft: Biodiverse Wissenskultur
Komplexes Wissen
Interdisziplinäre Erweiterung des Wissens
Partizipative Öffnung des Wissens
Vielfältige Wissensformen
Faire Wissensökonomien
VII. Wirtschaft: Biodiverse Ökonomie
Grenzen des wirtschaftlichen Wachstums, Grenzen der ökologischen Belastbarkeit
Der ökonomische Wert der Biodiversität
Langsame Hoffnung auf ökologisches Wachstum
Wachstum in der biodiversen Gesellschaft
VIII. Orientierung: Der biodiverse Imperativ
Anmerkungen
I. Entwicklung: Artenvielfalt und Artensterben
II. Begriff: Die biodiverse Gesellschaft
III. Prinzip: Konviviale Nachhaltigkeit
IV. Infrastrukturen: Ökologische Daseinsvorsorge
V. Politik: Die nachhaltige Verfassungsordnung
VI. Wissenschaft: Biodiverse Wissenskultur
VII. Wirtschaft: Biodiverse Ökonomie
VIII. Orientierung: Der biodiverse Imperativ
Dank
I. Entwicklung: Artenvielfalt und Artensterben
Wir sind Bürgerinnen und Bürger einer biodiversen Gesellschaft. Unser Leben ist existenziell von den anderen Lebewesen auf unserem Planeten abhängig, von Pflanzen und Tieren, Pilzen und Mikroorganismen. Und doch nehmen wir diese Existenzen oft nicht wahr, schätzen sie nicht wert, nutzen sie und ihre Leistungen mit größter Selbstverständlichkeit und zerstören gedankenlos Ökosysteme. Wer lebt mit uns auf dem Planeten? Es sind Millionen von Arten, die in Abermillionen von komplexen und miteinander verflochtenen Wechselwirkungen stehen. Der Wald zum Beispiel ist ein Lebensraum für zigtausende Lebewesen. Wenn wir auf dem Rücken auf dem Waldboden liegen und in die Baumkronen blicken, dann atmen wir den Sauerstoff ein, den die Bäume erzeugt haben. Die Bäume nutzen ihrerseits Pilze, um Nährstoffe im Boden aufzunehmen. Dafür liefern sie Zucker an die Pilze. Eine Wildbiene summt vorbei. Sie ist auf dem Weg zur nächsten Blüte, angelockt von Farbe, Nektar und Pollen. Sie transportiert Pollen und trägt damit zur Fortpflanzung der Pflanze bei. Ein Eichelhäher vergräbt ein paar Eicheln. Daraus werden – wenn der Vogel sie später nicht nutzt – Keimlinge. Der Wald wird sich natürlich regenerieren. Über Jahre und Jahrzehnte wachsen seine Bäume. Ihr Holz dient als Kohlenstoffspeicher, als Brennholz, als Nutzholz für Häuser, Tische und Stühle, für Papier und Musikinstrumente. Falls die Förster vor vielen Jahrzehnten die Entscheidung getroffen haben sollten, Fichtenmonokulturen zu pflanzen, dann ist alles Leben auf diesem Waldboden gefährdet. Die Bäume sterben, geschwächt von Dürre und Hitze, niedergestreckt von Borkenkäfern. Falls unser Wald an einem steilen Hang liegt, könnte das nächste große Gewitter den Boden ins Tal spülen. Die toten Bäume vermögen ihn nicht mehr festzuhalten. Im schlimmsten Fall rutscht der ganze Hang ab. Falls die Förster aber klug waren und einen Mischwald aus lokal angepassten Baumarten gepflanzt haben, kann man die Bäume jetzt ernten. Wenn man dabei umsichtig ist, werden die Keimlinge das Licht, das jetzt durch das offene Kronendach fällt, nutzen, nach oben schießen und die nächste Baumgeneration bilden. Wenn wir jedoch mit schweren Maschinen arbeiten, werden die Keimlinge zerquetscht. Der Boden wird verdichtet, und wir müssen mit viel Aufwand und hohen Kosten neue Keimlinge anpflanzen. Eine echte Überlebenschance haben diese nur, wenn es nicht zu viel Reh- und Rotwild gibt, wenn – möglicherweise gemeinsam mit Wölfen und Luchsen – die Wildbestände reguliert werden.
Es geht hier nicht um ein romantisches Idyll oder eine ökologische Utopie, sondern um die Realität unserer biodiversen Gesellschaft. Wir sind in ihr auf millionenfache Art und Weise mit unseren Mitlebewesen verbunden, in gegenseitiger Abhängigkeit, im Guten wie im Schlechten. Wie gelingt es uns, die anderen Arten in dieser biodiversen Gesellschaft wahrzunehmen? Wie können wir anfangen, biodivers zu denken und verantwortungsvoll zu handeln? Wie denken wir in dieser biodiversen Gesellschaft über die Natur, über Risiken, Nachhaltigkeit und Infrastrukturen? Wie können die politischen Strukturen und wie muss die Rechtsordnung unserer biodiversen Gesellschaft aussehen? Wie müssen wir das Wissenschafts- und Wirtschaftssystem gestalten, damit dieses biodiverse Netzwerk aus Interaktionen, von dem wir abhängig sind, erhalten bleibt oder sogar gefördert wird?
Wir sind also Bürgerinnen und Bürger dieser biodiversen Gesellschaft. Deshalb gilt es, einen biodiversen Wirklichkeitssinn zu entwickeln und Verantwortungsstrukturen zu schaffen, um die durch uns selbst gefährdete Vielfalt zu retten und zu bewahren. Verantwortungsvolles Handeln beruht auf dem Wissen über Biodiversität und dem Willen, für die Bewahrung der Artenvielfalt zu sorgen. Deshalb müssen wir zunächst genau hinschauen, wenn wir verantwortungsvoll leben wollen: Was ist Biodiversität? Was meint Artenvielfalt? Welche Folgen hat der Verlust von Biodiversität?
Was ist Biodiversität?
Der Erdgipfel von Rio de Janeiro hat im Jahr 1992 versucht, ein gesellschaftliches und politisches Bewusstsein für den Schutz von Biodiversität auf der internationalen Ebene zu schaffen. Diese Konferenz der Weltkommission für Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen hat das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological Diversity, CBD) verabschiedet. Um diesen internationalen Schutz zu entfalten, definiert das Übereinkommen die Biodiversität als »die Variabilität unter lebenden Organismen jeglicher Herkunft einschließlich u. a. terrestrischer, mariner und anderer aquatischer Ökosysteme und der ökologischen Komplexe, zu denen sie gehören; dazu gehört die Vielfalt innerhalb der Arten, zwischen den Arten und von Ökosystemen« (Art. 2 CBD).
Dies ist eine komplexe Definition für einen komplexen Gegenstand. Deshalb sollte man sich vielleicht sogar die Zeit nehmen, diese Begriffsbestimmung mehrmals zu lesen. Biodiversität umfasst erstens die Vielfalt innerhalb der Arten, zweitens die Vielfalt der Arten und drittens die Vielfalt der Ökosysteme. Aus der dynamischen Entfaltung aller Facetten entsteht und entwickelt sich unsere biodiverse Lebenswelt. In Gesellschaft, Politik und Öffentlichkeit wird oft von Artenvielfalt gesprochen, um den »sperrigen« Begriff »Biodiversität« zu vermeiden. Dabei geht das Bewusstsein für die Komplexität verloren, die aber für ein umfassendes Verständnis von Biodiversität unbedingt notwendig ist. Artenvielfalt kann vergleichsweise gut erfasst werden. Dagegen ist die Diversität innerhalb der Arten – beispielsweise die genetische Diversität – nur mit aufwendigen Methoden messbar, und es gibt nur wenige Daten. Die Diversität von Ökosystemen ist grundsätzlich schwer quantifizierbar, da Ökosysteme räumlich kaum abgrenzbar sind. Deshalb ist ein Bewusstsein von Komplexität, ja, eine Leidenschaft für Komplexität wichtig, wenn wir in einer (weiterhin) biodiversen Welt leben wollen. Zugleich ist klar, dass wir noch sehr wenig darüber wissen, wodurch die Komplexität der biodiversen Lebenswelt geprägt wird. Wahrscheinlich werden wir niemals alles durchschauen. Wenn wir also im Folgenden von »Biodiversität« sprechen, dann nicht in dem vereinfachten Sinn von »Artenvielfalt«, sondern in dem komplexen Sinn der »biologischen Vielfalt mit all ihren Facetten«: der Vielfalt innerhalb der Arten, der Vielfalt der Arten und der Vielfalt der Ökosysteme.
Wie entwickelt sich Biodiversität?
Die Biodiversität auf der Erde hat sich über einen Zeitraum von Jahrmilliarden entwickelt. Neue Arten entstehen im Laufe erdgeschichtlicher Zeiträume durch kontinuierliche Veränderungen innerhalb von Arten und über Artbildung, also die Aufspaltung einer in zwei oder mehrere Arten. Im Lauf der Erdgeschichte lässt sich eine Tendenz zur Erhöhung der Artenvielfalt feststellen. Allerdings wurde und wird diese Entwicklung immer wieder durch Massenaussterben unterbrochen. Die Auslöser waren in der Vergangenheit geologische Ereignisse, etwa großflächiger Vulkanismus. Bisher kam es zu fünf Massenaussterben. Das letzte fand vor rund 66 Millionen Jahren statt und markiert den Übergang vom Erdmittelalter zur Erdneuzeit. Es wurde durch einen Asteroideneinschlag auf der Halbinsel Yucatán im heutigen Mexiko verursacht. Ihm fielen fast drei Viertel aller Tierarten zum Opfer, darunter – mit Ausnahme der Vögel – auch die Dinosaurier.
Diesen natürlichen Schwankungen in der Artenvielfalt steht in den vergangenen Jahrhunderten und vor allem in den letzten Jahrzehnten zunehmend ein Verlust von Biodiversität gegenüber, den allein der Mensch verursacht hat. Im ersten globalen Bericht des Weltbiodiversitätsrats (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services, IPBES) haben Expertinnen und Experten festgestellt, dass von den derzeit – grob geschätzt – acht Millionen Arten auf der Erde rund eine Million vom Aussterben bedroht sind.[1] Dabei ist das Maß an Bedrohung bei den verschiedenen Tier- und Pflanzengruppen unterschiedlich ausgeprägt. Am höchsten ist es mit 70 Prozent bedrohter Arten bei Palmfarnen.[2] Auch Amphibien sind hochgradig gefährdet, also Frösche, Kröten und Lurche (41 Prozent bedrohte Arten), außerdem Haie und Rochen (37 Prozent bedrohte Arten) sowie riffbildende Korallen (36 Prozent bedrohte Arten). Darüber hinaus gehen die Bestände von Arten dramatisch zurück; Arten werden seltener. Dies sind die drohenden Vorboten zukünftigen Aussterbens; diese Arten können aber noch gerettet werden. Der Living Planet Index, der die Häufigkeit von Arten anhand ausgewählter Bestände von Wirbeltieren (Vögeln, Säugetieren, Amphibien und Reptilien) widerspiegelt, zeigt einen Rückgang um mehr als 70 Prozent über einen Zeitraum von fünfzig Jahren.[3] In Deutschland und Europa messen wir Rückgänge vor allem bei den Arten der Agrarlandschaft, das heißt auf Äckern, Wiesen und Weiden. Bei den Vögeln in Europa sind es fast 60 Prozent über einen Zeitraum von 37 Jahren.[4] Die Population der Feldlerche nahm in Deutschland in den letzten 25 Jahren um ca. 50 Prozent ab, die des Rebhuhns um 91 Prozent und die des Kiebitzes um 93 Prozent. Aber wie gesagt: Auch unter natürlichen Bedingungen sterben immer wieder Arten aus. Allerdings liegen die derzeitigen Aussterberaten mindestens zehn- bis hundertmal so hoch, einzelne Quellen setzen sie tausendfach so hoch an wie diejenigen der letzten zehn Millionen Jahre.[5]
Neben den Arten verschwinden auch natürliche Ökosysteme in einem dramatischen Umfang. Sie werden in vom Menschen genutzte und deshalb oft degradierte, das heißt in verarmte, weniger stabile Ökosysteme überführt. Die Hälfte aller Ökosysteme wurde bereits massiv verändert.[6] In den letzten dreißig Jahren ist weltweit die Ausdehnung natürlicher Wälder um eine Fläche zurückgegangen, die zwölfmal der Fläche der Bundesrepublik Deutschland entspricht.[7] In Deutschland sind nur vier Prozent der früher ausgedehnten Moore Naturschutzflächen.[8] Selbst wenn wir das Artensterben sofort stoppen könnten, würde der massive Verlust in ferner Zukunft für Paläontologinnen und Paläontologen (so es diese dann geben sollte) in den Ablagerungen der Sedimente erkennbar sein. Wir blicken also in eine düstere und verarmte Zukunft.
Warum verschwindet Biodiversität?
Doch was sind genau die Ursachen für den Verlust der Biodiversität? Es gibt fünf wichtige direkt treibende Faktoren, die sogenannten »Big Five« des Biodiversitätsverlusts.[9] Auf Platz eins steht die Landnutzung. Dies bedeutet vor allem die Umwandlung natürlicher Lebensräume wie Wälder, Savannen, Graslandökosysteme oder Feuchtgebiete in landwirtschaftlich genutzte Flächen. Die Anbaufläche wird derzeit vor allem in tropischen Ländern massiv ausgedehnt. Dort fressen sich Soja- und Palmölplantagen sowie Viehweiden regelrecht in natürliche Ökosysteme hinein. In Deutschland und Europa lauten die Stichworte: intensive landwirtschaftliche Nutzung, hoher Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln, wenig diverse Fruchtfolgen, großflächige Monokulturen, Verlust strukturreicher Landschaften und das Verschwinden von Hecken, Einzelbäumen, Bachläufen und Brachflächen.[10] Auf Platz zwei der Gründe für den Verlust von Biodiversität steht die Ausbeutung von Arten, vor allem in den Weltmeeren. Mehr als 35 Prozent der kommerziell genutzten Fischbestände sind überfischt.[11] An Land spielt in erster Linie die Jagd nach Wild (bushmeat) in tropischen Ländern eine wichtige Rolle. Der Klimawandel ist Ursache Nummer drei für den Verlust von Biodiversität. Allerdings trägt er derzeit nur in geringem Ausmaß zum Artensterben bei. Bisher ist kaum eine Art nachweislich an den Folgen des Klimawandels ausgestorben, dagegen hunderte oder tausende Arten an den Folgen der Lebensraumzerstörung und der Ausbeutung. Die Bedeutung des Klimawandels für die Bedrohung der Biodiversität wird aber in Zukunft sicher zunehmen. Vierter und fünfter Faktor für den Verlust von Biodiversität sind Umweltverschmutzung und das Einwandern gebietsfremder, sogenannter exotischer Arten. Bei der Umweltverschmutzung denkt man zunächst an Umweltgifte, an Ölkatastrophen oder Müll. Stattdessen ist die Verschmutzung durch Düngemittel der viel dramatischere Faktor. Überdüngung führt zu einer Verarmung von Pflanzengemeinschaften, zur Nährstoffanreicherung und dem »Umkippen« von Seen bis hin zu sauerstoffarmen »Todeszonen« in Meeren.[12] Exotische Arten sind dann für Ökosysteme und den Menschen gefährlich, wenn sie invasiv werden, sich ungehindert ausbreiten, andere Arten verdrängen oder Krankheitserreger übertragen.[13]
Hinter diesen direkten Einflussfaktoren stehen indirekte oder tiefliegende Ursachen, welche die oben genannten Landnutzungsänderungen und die Ausbeutung von Arten verursachen. Dazu gehören demografische und sozio-kulturelle Veränderungen, wie der Anstieg der Weltbevölkerung, der zunehmende Pro-Kopf-Konsum von natürlichen Ressourcen und eine weltweit mehr und mehr fleischbasierte Ernährung.[14] Weitere Faktoren sind ökonomische und technische Veränderungen, aber auch der Wandel von politischen Institutionen und Governance, das heißt Führungsstrukturen, soziale, wirtschaftliche und kriegerische Konflikte sowie Epidemien. Einen entscheidenden wirtschaftlichen Faktor bilden beispielsweise die globalen Handels- und Lieferketten. Es ist eine relativ junge Entwicklung, dass sich die wohlhabenden Konsumgesellschaften so viele landwirtschaftliche Produkte aus dem Globalen Süden leisten: Kaffee, Tee, Bananen oder auch Fleisch und Wurst aus Schweinen und Rindern, die mit Soja aus Brasilien gefüttert wurden, was dort zum Verlust der Regenwälder und Savannen führt. So ist auch die globale Ungleichheit für den Rückgang der Biodiversität verantwortlich.
Welche Folgen hat der Verlust von Biodiversität?
Die Veränderungen der Biodiversität haben Folgen für das, was die Natur zum Leben der Menschen beiträgt: die sogenannten Ökosystemleistungen. In einer anthropozentrischen Perspektive, die auf die instrumentellen Werte der Natur für die Menschen fokussiert, bedeutet das:[15] Die Biodiversität ist die Existenzgrundlage für die Menschen. Fast alles, was Menschen nutzen, stellt die Biodiversität bereit. Der Weltbiodiversitätsrat IPBES – das Pendant zum Weltklimarat IPCC – unterscheidet zwischen regulierenden, materiellen und nicht-materiellen Beiträgen der Natur für die Menschen. Zu den materiellen Leistungen gehören Luft zum Atmen, sauberes Trinkwasser, Nahrung, Baustoffe, Energie, Fasern oder Medikamente. Zu den regulierenden Beiträgen zählen die Bestäubung, die Samenausbreitung und die natürliche Regeneration von Wäldern, die Regulierung von Klima, Wassermenge und -qualität und die Bildung fruchtbarer Böden. Insofern ist die Biodiversität so etwas wie der Maschinenraum der Ökosysteme. Sie sorgt dafür, dass die Ökosysteme die materiellen Leistungen für das Leben der Menschen erbringen. Schließlich liefert die Biodiversität ein breites Spektrum an nicht-materiellen Werten: Schönheit, Entspannung, Erholung und psychische Gesundheit, Spiritualität, Heimat und Identität. Die Veränderungen der Biodiversität haben gravierende Folgen. Nach wissenschaftlichem Konsens gehen von den 27 Unterkategorien an Beiträgen der Natur alle bis auf drei zurück. Die einzigen Leistungen, die ansteigen, sind Nahrungsmittel und Tierfutter, Energiepflanzen, wie Ölpalmen, und Materialien wie Baumwolle.[16] Andere materielle Leistungen sind auch reduziert, ganz eklatant die Fischbestände.
Die langfristigen Folgen dieses dramatischen Wandels und des drohenden zukünftigen Rückgangs der Biodiversität für den Menschen sind schwer abschätzbar. Nur selten hat der Verlust einzelner Arten unmittelbare, durchschlagende Folgen für das ganze Ökosystem. Ein Beispiel für eine solche Schlüsselart ist der Seeotter, der in den Küstenmeeren Kaliforniens, Oregons, Washingtons und Kanadas lebt.[17] Seine starke Bejagung Anfang des 20. Jahrhunderts führte zu einem deutlichen Rückgang dieser Art. Als Folge davon nahm der Bestand seiner wesentlichen Nahrungsgrundlage, der Seeigel, zu. Seeigel beweiden in diesen Küstenregionen Tangwälder aus Braunalgen, Kelp. Diese Kelpwälder sind der Lebensraum für eine große Zahl anderer Arten, beispielsweise von Jungfischen, Moostierchen, Schnecken, Muscheln oder anderen Algen. Mit dem Verschwinden der Seeotter verschwanden auch die Tangwälder und deren ganze Diversität. Nach einem Verbot der Bejagung erholten sich die Seeotterbestände wieder, und auch die Kelpwälder regenerierten sich.
Oft hat das Verschwinden einer einzelnen Art keine direkt messbaren Effekte für das Funktionieren eines Ökosystems. Allerdings besteht Konsens darüber, dass diverse Ökosysteme stabiler und resilienter als artenarme Ökosysteme sind: Je mehr Arten, desto weniger werden Ökosysteme durch Störungen verändert und desto schneller können sie danach wieder ihren Ausgangszustand erreichen.[18] Das sieht man beispielsweise bei unseren Wäldern. Monokulturen – vor allem an Fichten – wurden in den Hitzesommern 2018, 2019 und 2020 stark in Mitleidenschaft gezogen. So starb der Wald im Harz quadratkilometerweise. Demgegenüber kamen diverse Mischwälder vergleichsweise gut durch Dürre und Hitze. Ein ähnliches Muster erkennt man beim Vergleich einer diversen, blütenreichen Wiese mit einem Rasen, der nur aus wenigen Arten besteht. Eine diverse Wiese produziert immer Pflanzenbiomasse, egal, wie trocken oder feucht Frühjahr und Sommer sind. Der Rasen jedoch verkümmert oder stirbt ab, wenn er nicht regelmäßig gegossen wird. Man spricht vom Portfolio-Effekt: Er funktioniert wie das Portfolio eines Aktienfonds. Ein Fonds mit unterschiedlichen Aktien ist stabiler als die Fokussierung auf eine einzelne Aktie und damit eine ökonomische Monokultur.
Darüber hinaus liefern diverse Ökosysteme ein breiteres Spektrum an Beiträgen für Menschen und Tiere. Beim Anbau von Fichtenmonokulturen steht eine effektive Holzgewinnung im Vordergrund. In diversen Wäldern gibt es unterschiedliche Hölzer, Blätter, Früchte und Samen und damit Lebensraum für viel mehr Tier- und Pflanzenarten, und sie bieten den Menschen Erholung. Diverse Wiesen liefern nicht nur Pflanzenbiomasse, sondern locken mit bunten Blüten Schmetterlinge und Bienen an. Sie ernähren diese mit Nektar und Pollen sowie – später im Jahr – mit ihren Samen Insekten und Vögel. Darüber hinaus bauen sie Humus auf und werden als ästhetischer wahrgenommen als monotone Grasflächen.
Kann der Verlust der Biodiversität beliebig lange weitergehen, oder gibt es planetare Grenzen? Gibt es Kipppunkte, bei deren Überschreitung das Erdsystem in einen kritischen Zustand springt, aus dem es nur mit erheblichem Aufwand oder nie mehr in den Ausgangszustand zurückgebracht werden kann?[19] Auch für Biodiversität und Ökosysteme existieren definitiv planetare Grenzen. Die Menge an Biomasse, die auf der Erde produziert werden kann, ist endlich. Allerdings ist derzeit unklar, ob für Biodiversität auf globaler Ebene klare planetare Kipppunkte existieren. Neueste wissenschaftliche Analysen aller bisher verfügbarer Daten sprechen eher dafür, dass der Verlust der Biodiversität zu kontinuierlichem Verlust der Leistungen der Ökosysteme führt.[20] Jeder Verlust einer Art erhöht das Risiko, dass die Leistungen der Biodiversität für die Menschen instabiler und schlechter werden.
Wie kann Biodiversität gefördert werden?
Angesichts der dramatischen Folgen, die der Rückgang an Biodiversität für die Menschen hat, gibt es eine Reihe wichtiger politischer, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Strategien und Maßnahmen, um einen weiteren Schwund aufzuhalten.
An erster Stelle stehen internationale Übereinkommen, etwa das Übereinkommen über die biologische Vielfalt aus dem Jahr 1992, das auf dem bereits genannten Erdgipfel in Rio beschlossen wurde und das in der Zwischenzeit 196 Nationen unterzeichnet haben.[21] Die 15. Vertragsstaatenkonferenz Ende 2022 in Montreal vereinbarte neue strategische Ziele und Maßnahmen für die Jahre 2030 und 2050.[22] Dabei geht es zum einen um Schutz und Förderung der Biodiversität. Bis zum Jahr 2030 sollen 30 Prozent der Land- und Meeresflächen unter Schutz gestellt werden (Ziel 3). Dabei ist darauf zu achten, dass der Schutz auch wirklich wirksam ist und dass die Rechte von indigenen Völkern und lokalen Gemeinschaften berücksichtigt und respektiert werden. Außerdem sollen bis zum Jahr 2030 30 Prozent der degradierten Land- und Meeresflächen wiederhergestellt werden (Ziel 2). Wichtig ist zum anderen eine nachhaltige Nutzung der Biodiversität. Dementsprechend sollen eine nachhaltige Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei gefördert werden (Ziel 10). Dazu gehört, dass das Risiko durch Pflanzenschutzmittel und gefährliche Chemikalien um mindestens 50 Prozent reduziert wird (Ziel 7). Schließlich muss die effektive Umsetzung dieser Ziele gewährleistet werden. So ist sicherzustellen, dass große und transnationale Unternehmen und Finanzinstitutionen ihre Abhängigkeit von Biodiversität, ihre Risiken wegen eines Verlusts der Biodiversität und ihren Fußabdruck auf die Biodiversität offenlegen (Ziel 15). Darüber hinaus müssen umweltschädliche Subventionen bis zum Jahr 2030 um mindestens 500 Milliarden Dollar pro Jahr reduziert werden (Ziel 18). Die reichen Länder sind dazu verpflichtet, die Länder des Globalen Südens bei der effektiven Umsetzung dieser Ziele und Maßnahmen bis zum Jahr 2030 mit 30 Milliarden Dollar pro Jahr zu unterstützen (Ziel 19). Hierauf werden wir wieder zurückkommen.
An zweiter Stelle spielen internationale institutionelle Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Politik auch für den Schutz der Biodiversität eine zentrale Rolle. Der bereits genannte Weltbiodiversitätsrat IPBES[23] fasst den Stand des globalen Wissens über Biodiversität zusammen und entwickelt regionale und globale Handlungsoptionen. Darüber hinaus erarbeitet er Stellungnahmen zu einzelnen Themen, wie etwa zur Bestäubung und zu den Werten der Natur. Er entwickelt Modelle und Zukunftsszenarien der Biodiversität. Biodiversitätsmodelle sind mit Klimamodellen vergleichbar.[24] Sie spiegeln die bisherigen Veränderungen der Biodiversität und zeigen Entwicklungsszenarien auf. Auf diese Weise können sie uns Optionen für soziale, ökonomische und politische Entscheidungen veranschaulichen.
Ein wesentliches Ergebnis der bisherigen IPBES-Berichte ist, dass Schutz und Förderung der Biodiversität nicht mehr durch Einzelmaßnahmen zu erreichen sind. Das heißt: Die Einrichtung von Schutzgebieten und die Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln sind zwar gute und notwendige Maßnahmen. Sie reichen aber nicht aus, um die Biodiversität zu erhalten. Stattdessen wird eine sozial-ökologische Transformation gefordert, also eine fundamentale, systemweite Umgestaltung der ganzen Gesellschaft, das heißt von Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Wissenschaft, Politik und Staat.[25] Die oben genannten globalen Biodiversitätsmodelle können zeigen, welche Maßnahmen notwendig sind, um die Biodiversität bis zum Jahr 2050 wieder zu erhöhen. Erstens müssen wir die Natur besser schützen. Dafür sind nicht nur große Schutzgebiete nötig, in denen übrigens durchaus Menschen leben und wirtschaften dürfen, sondern auch Renaturierung, also die Wiederherstellung von Ökosystemen. Zweitens brauchen wir eine produktive, aber nachhaltige Land- und Forstwirtschaft und Fischerei. In Bezug auf Produktivität besteht in einigen Ländern des Globalen Südens durchaus Verbesserungsbedarf, in Bezug auf Nachhaltigkeit dagegen insbesondere in den Konsum- und Wohlstandsgesellschaften. Drittens müssen wir unsere Ernährungsgewohnheiten und unser gesamtes Ernährungssystem ändern. Es ist notwendig, die Verschwendung von Lebensmitteln zu reduzieren; und für Länder wie Deutschland ist es unumgänglich, zu einer stärker pflanzenbasierten Ernährung zu finden.[26]
In Deutschland hat der die Bundesregierung beratende Wissenschaftliche Beirat Globale Umweltveränderungen (WBGU) bereits im Jahr 2011 auf die Notwendigkeit einer solchen großen Transformation hingewiesen. Der WBGU betont, dass diese nur realisiert werden könne, wenn ein neuer Gesellschaftsvertrag zwischen Regierungen und Bürgerinnen und Bürgern innerhalb und außerhalb der Grenzen des Nationalstaats geschlossen würde. Seither hat der WBGU in seinen periodischen Gutachten diese Forderung mit Nachdruck erneuert und Wege aufgezeigt, wie eine solche Transformation gelingen kann. Für den WBGU ist Biodiversitätsschutz nichts weniger als der Schlüssel für die Transformation zur Nachhaltigkeit: Deutschland müsse hier als Vorbild vorangehen und international Führung beweisen.[27]
Es ist eine große politische Herausforderung, derartige grundlegende sozial-ökologische Transformationen anzustoßen. Wenn sozial-ökologische Systeme gezielt verändert werden sollen, ist es hilfreich, zwischen flachen und tiefen Eingriffen (shallow and deep interventions) zu unterscheiden. Entsprechend können Veränderungen bei flachen und tiefen Hebelpunkten des Systems (shallow and deep leverage points) beginnen.[28] Flache Hebelpunkte setzen an einzelnen Parametern der biodiversen Entwicklung an, beispielsweise an der Altersstruktur eines Waldes oder an Feedback-Zyklen, etwa an dem Zeitraum, bis zu dem ein See Nährstoffe absorbieren kann, bevor ein Kipppunkt erreicht wird. Tiefe Hebelpunkte sind auf das umfassende Design des sozial-ökologischen Systems ausgerichtet, also zum Beispiel auf die Struktur von Informationsflüssen, wie dem Wissen der Verbraucherinnen und Verbraucher über die Herkunft eines Produkts, oder an der Regulierung des Wirtschaftssystems, etwa an Subventionen oder Steuern für die Herstellung von Produkten. Zu den tiefen Hebelpunkten gehören auch die Ziele der Maßnahmen. Was ist beispielsweise das politische Ziel von Subventionen? Ist es die Förderung der Wirtschaft oder der Gesundheit von Menschen und Natur? Auf welchen gesellschaftlichen Denkmustern und Paradigmen basieren die Maßnahmen? Bisher beruhen Maßnahmen, die zum Schutz der Biodiversität ergriffen werden, eher auf flachen Hebelpunkten, beispielsweise dem Einrichten von Schutzgebieten. Dagegen werden Veränderungen in der Regulierung des Systems, wie die Nutzung von Subventionen, um in der Landwirtschaft Gemeinwohlleistungen zu belohnen, oder der Abbau von naturschädlichen Subventionen, kaum genutzt. Noch seltener sind Maßnahmen, die an den Zielen des Systems, an Denkmustern oder Konsumstilen und kollektiven Verhaltensweisen ansetzen. Zugegebenermaßen sind diese tiefen Hebelpunkte – vor allem diejenigen, die sich auf die Veränderung von Denkmustern und Lebensstilen beziehen – politisch sehr schwer greifbar und umsetzbar. Nichtsdestotrotz haben Ansätze an tiefen Hebelpunkten ein grundlegendes Potential, wirklich nachhaltige und langfristige Veränderungen in Richtung einer neuen, biodiversen Mensch-Natur-Beziehung zu bewirken.
Einen solchen tiefen sozial-ökologischen Hebelpunkt unseres sozialen, kulturellen und ökonomischen Lebens möchten wir mit dem Begriff einer biodiversen Gesellschaft vorschlagen, in der Natur und Menschen zukunftsfähig zusammenleben. Dieses zukunftsfähige Zusammenleben werden wir in den Begriff des »biodiversen Konvivialismus« fassen, um individuelle und soziale Denkmuster zu entfalten und ökologische und ökonomische Paradigmen zu entwickeln, mit denen sich die biodiverse Gesellschaft beschreiben, verstehen und gestalten lässt. Dementsprechend schlagen wir ein neues Verständnis von konvivialer Nachhaltigkeit vor, das unser Denken über das Zusammenwirken von ökologischer Daseinsvorsorge, Infrastrukturen und Politik, Recht, Wissen und Wirtschaft in einer wahrhaft biodiversen Gesellschaft prägen kann.