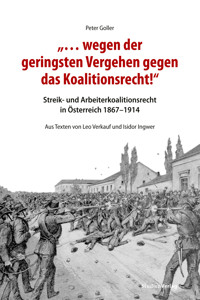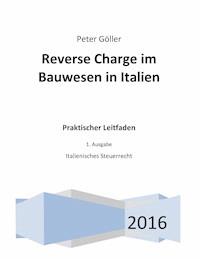
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Praktischer Leitfaden zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft "Reverse Charge" im italienischen Bauwesen. Steuerrecht - MwSt Italien
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 296
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Besten Dank an meine Kanzleipartnerin Katrin Hofer und an meine besten Kollegen Alessandro „Alex“ Zanellato und Florian Frei.
Inhalt
Einführung
Gesetzestext Artikel 17 Absatz 6 DPR 633/1972 (MwStG)
Reverse Charge bei spezifischen Bauleistungen laut Artikel 17 Absatz 6 Buchstabe a-ter) DPR 633/72
3.1 Allgemein
3.2 Definition „Gebäude“
3.3 Abgrenzung Werkvertrag vs. Lieferung mit Montage
3.4 Sachlicher Anwendungsbereich
3.5 Betroffene Bauleistungen
3.5.1 Abbruch von Gebäuden
3.5.2 Installationsgewerbe (Elektriker, Installateure usw.)
3.5.3 Fertigstellung von Gebäuden
3.5.4 Wartung und Instandhaltung
3.5.5 Koordination mit Art. 17 Buchstabe a) MwStG
3.6 Subjektiver (Persönlicher) Anwendungsbereich
3.7 Zusammenspiel mit besonderen Steuersystemen
3.7.1 MwSt nach Zu- und Abfluss - Artikel 32-bis D.L. Nr. 83/2012
3.7.2 Neues Pauschalsystem und Kleinstunternehmerregelung
3.7.3 Sonstige Ausnahmen
3.7.4 Umkehr der Steuerschuldnerschaft und Plafond
3.8 Konsortien und Bietergemeinschaften
3.8.1 Konsortien mit externer Tätigkeit
3.8.2 Konsortien mit interner Tätigkeit
3.8.3 Bietergemeinschaften
3.9 Umkehr der Steuerschuldnerschaft und Split Payment
3.10 Zeitlicher Anwendungsbereich
3.11 Angabe in Rechnung
Behandlung von umfassenden Aufträgen
4.1 Grundregel
4.2 Interne Umgestaltung von Gebäuden
Reinigungsleistungen
Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei Unterwerkverträgen laut Artikel 17 Absatz 6 Buchstabe a) DPR 633/72
6.1 Voraussetzungen
6.2 Leistungen im Baugewerbe
6.3 Beteiligte Subjekte
6.4 Vertragliche Regelung
6.4.1 Allgemein
6.4.2 Form des Vertrages
6.4.3 Hauptauftragsverhältnis
6.5 Neuerungen 2008
6.6 Neuerungen 2016
6.7 Angabe auf Rechnung
6.8 Fallstudien auf Grundlage der Entscheidungen der Finanzverwaltung
Entscheidungsfinder (Flow Chart)
Reverse Charge bei Lieferung von Gebäuden laut Artikel 17 Absatz 6 Buchstabe a-bis) DPR 633/72
8.1 Definition Wohnimmobilien, gewerbliche Immobilien
8.1.1 Wohnimmobilien
8.1.2 Gewerbliche Immobilien
8.2 Wohnimmobilien
8.3 Gewerbliche Immobilien
8.4 Grundregel
Fallbeispiele
9.1 Montage einer Stahltreppe durch einen Schlosserbetrieb
9.2 Errichtung einer Betonmauer durch einen Schlosserbetrieb
9.3 Unterscheidung Werkvertrag – Lieferung mit Montage
9.4 Reverse Charge bei komplexen Aufträgen (1)
9.5 Reverse Charge bei komplexen Aufträgen (2)
9.6 Bau eines Parkplatzes auf dem Dach eines Gebäudes
9.7 Schneeräumung
9.8 Leistungen an Anlagen eines Gebäudes
9.9 Wartung und Instandhaltung von Gebäudeanlagen
9.10 Einbau von integrieren Photovoltaikanlagen
9.11 Einbau und Wartung von Feuerschutzanlagen
9.12 Austausch von Bestandteilen einer Anlagen an einem Gebäude
9.13 Wartung von Maschinen
9.14 Ausführung der Arbeiten durch Dritte
9.15 Umkehr der Steuerschuldnerschaft bei wesentlichen Gütern
9.16 Kosten für Bereitschaftsdienst - Wartungsvertrag
9.17 Kosten für Anschluss an Versorgungsnetze
9.18 Anwendung bei nicht steuerbaren Leistungen
9.19 Anwendung bei Zimmerer oder Dachdecker
9.20 Maurer: Neubau eines Gebäudes
9.21 Maurer: Reparatur eines Gebäudes
9.22 Maurer: Reparatur einer freistehenden Mauer
9.23 Lieferung eines Heizkessels bei Einbau einer neuen Heizanlage (1)
9.24 Lieferung eines Heizkessels (Reparatur einer Heizanlage (2))
9.25 Abnahme Einbau eines Heizkessels
9.26 Reinigung Räumlichkeiten einer gewerblicher Körperschaft
9.27 Generalauftrag für den Bau eines Gebäudes
Buchhaltung, MwSt-Steuerguthaben
10.1 Rechnung
10.2 Anwendung des korrekten MwSt-Satzes
10.3 Gutschrift
10.4 Stempelsteuer
10.5 MwSt-Steuerguthaben
Strafen
11.1 Berechnung der Strafen
11.2 Kritik
11.3 Fehler bis 22.12.2015
11.4 Empfehlungen zur Korrektur
11.5 Gültigkeit der Neuerungen
11.6 Angemessenheit der Strafen – Entscheidung EUGH C-95/07 und C-96/07
Rundschreiben und Entscheide der Finanzverwaltung
12.1 Rundschreiben 14/E/2015
12.2 Rundschreiben 37/E/2015
12.3 Rundschreiben 37/E/2006
12.4 Rundschreiben 11/E/2007
12.5 Rundschreiben 19/E/2007
12.6 Ministerialentscheid 148/E/2007
12.7 Ministerialentscheid 154/E/2007
12.8 Ministerialentscheid 155/E/2007 (überholt)
12.9 Ministerialentscheid 164/E/2007
12.10 Ministerialentscheid 172/E/2007
12.11 Ministerialentscheid 187/E/2007
12.12 Ministerialentscheid 205/E/2007
12.13 Ministerialentscheid 220/E/2007
12.14 Ministerialentscheid 243/E/2007
12.15 Ministerialentscheid 295/E/2007
12.16 Ministerialentscheid 347/E/2007
12.17 Ministerialentscheid 76/E/2008
12.18 Nota 954-49553 Agenzia Entrate vom 8. April 2008
12.19 Ministerialentscheid 111/E/2008
12.20 Ministerialentscheid 113/E/2008
12.21 Ministerialentscheid 173/E/2008
12.22 Ministerialentscheid 174/E/2008
12.23 Ministerialentscheid 245/E/2008
12.24 Ministerialentscheid 246/E/2008
12.25 Ministerialentscheid 255/E/2008
1. Einführung
Im Geschäftsverkehr zwischen passiven Steuersubjekten lastet grundsätzlich der Leistende (Lieferant) die Mehrwertsteuer dem Leistungsempfänger (Kunde) an, der diese im Allgemeinen geltend machen d.h. als Vorsteuer abziehen kann.
Jedes Unternehmen in der Wertschöpfungskette handelt auf diese Weise und letztendlich wird die Mehrwertsteuer auf den Endkunden abgewälzt.
Der italienische Gesetzgeber hat in der Zwischenzeit allerdings eine ansehnliche Anzahl von Ausnahmen von dieser Grundregel vorgesehen. In den allermeisten Fällen wird die Abweichung damit begründet, dass in bestimmten Branchen ein erheblicher Missbrauch vermutet wird und große Mehrwertsteuerbeträge hinterzogen werden. Als Beispiele sind der Handel von Computerprozessoren, Umweltzertifikaten sowie der Baubereich zu nennen. Wie funktioniert der Missbrauch? Der Leistende stellt seine Leistung mit Mehrwertsteuer in Rechnung. Der Leistungsempfänger (Kunde) erhält diese Rechnung und macht die Vorsteuer geltend. Der Leistende führt allerdings die Mehrwertsteuer nicht an den Fiskus ab und somit schaut dieser durch die Finger, während der Kunde jedenfalls berechtigt ist, die Vorsteuer abzuziehen. Auf diese Weise schädigen solche Unternehmen auch die Mitbewerber, da sie die Hinterziehung der Mehrwertsteuer von vornherein in ihre Preiskalkulation einfließen lassen, während ein korrektes Unternehmen nicht mehr konkurrenzfähig ist.
Aus diesem Grund wurden bei besonders „anfälligen“ Branchen Sonderregeln eingeführt, die bereits in der MwSt-Systemrichtlinie 2006/112/EG vorgesehen sind.
Für die überwiegende Mehrzahl der Wirtschaftstreibenden stellen diese Ausnahmen jedoch überaus komplexe und lästige Bestimmungen dar, die zudem den Finanzprüfern Tür und Tor für Beanstandungen öffnen.
In diesem Sinne ist dieses Werk ein Versuch, etwas Licht in die Materie zu bringen.
2. Gesetzestext Artikel 17 Absatz 6 DPR 633/1972 (MwStG)
Nachfolgend der Artikel 17 MwStG in der Fassung gültig ab 01. Jänner 2016, mit Übersetzung der wesentlichen Absätze:
1 MwSt-Buch der Eingangsrechnungen
2 MwSt-Buch der ausgestellten Rechnungen
3. Reverse Charge bei spezifischen Bauleistungen laut Artikel 17 Absatz 6 Buchstabe a-ter) DPR 633/72
3.1 Allgemein
Das Haushaltsgesetz 2015, Artikel 1 Absätze 629 und 631 Gesetz Nr. 190 vom 23. Dezember 2014, hat die Anwendung der Umkehr der Steuerschuldnerschaft auf eine ganze Reihe von Leistungen ausgedehnt. Für folgende Bereiche muss die MwSt künftig vom Leistungsempfänger erfasst werden:
bestimmte Bauleistungen;
im Bereich Energie;
Handel von Paletten.
In diesem Buch gehe ich auf die Anwendung der Reverse Charge3 Regelung im Bereich Bauwesen und bei Reinigungsdienstleistungen ein.
3.2 Definition „Gebäude“
Zunächst erscheint es unerlässlich, den Begriff „Gebäude“ im Sinne des in diesem Buch beschriebenen Gesetzes zu definieren. Dies ist notwendig, da die Umkehr der Steuerschuldnerschaft nur dann anzuwenden ist, wenn es sich um Leistungen an einem Gebäude handelt.
Eine mögliche Definition gibt uns die Finanzverwaltung im Entscheid Nr. 46/E/1998, in welchem die Finanzverwaltung auf ein Rundschreiben des Ministeriums für öffentliche Arbeiten verweist und festlegt, dass
„als Gebäude und Bauwerk jeder Bau mit Dach zu verstehen ist, der von Straßen [Wegen usw.] oder freien Räumen oder von anderen Gebäuden durch Mauern, welche ohne Unterbrechung vom Fundament bis zum Dach reichen, abgetrennt sind, die über einen oder mehrere Zugänge von der Straße aus verfügen und über eine oder mehrere unabhängige Treppen verfügen können.“4
Laut dieser Definition sind sowohl zivile Bauten wie Wohnungen, Häuser usw. von der Regelung betroffen, als auch gewerbliche Gebäude wie Hallen, Handwerksgebäude, Gebäude für Handel usw. aber auch Teile davon, wie beispielsweise ein Raum oder eine Wohnung.
Die Begriffsbestimmung gilt für bestehende, für neue und für im Bau befindliche Gebäude.
3.3 Abgrenzung Werkvertrag vs. Lieferung mit Montage
Die Unterscheidung des zugrundeliegenden Rechtsgeschäftes ist absolut unerlässlich für die korrekte Anwendung der Bestimmungen. In der Praxis ist die Unterscheidung teilweise nicht einfach. Es gibt aber den folgenden Grundsatz: Ausschlaggebend ist die Absicht der Parteien. Dies wird in der Rechtsprechung und auch in der Praxis der Agentur der Einnahmen immer wieder betont.
Der Unternehmerwerkvertrag („contratto d’appalto“) ist in Art. 1655 ZGB wie folgt definiert:
„Der Unternehmerwerkvertrag ist der Vertrag, mit dem eine Partei die Ausführung eines Werkes oder die Leistung eines Dienstes unter organisiertem Einsatz der notwendigen Mittel und auf eigene Verantwortung um eine Gegenleistung in Geld übernimmt.“
Die wichtigsten Merkmale dieses Vertrages sind:
Ausführung durch einen Unternehmer;
Errichtung einer spezifischen betrieblichen Organisation für die betreffende Arbeit (im Gegensatz zur Lieferung von Standardprodukten);
das Ergebnis ist die Errichtung eines Werkes oder einer Leistung (und nicht die Lieferung eines Gegenstandes);
die Übernahme eines unternehmerischen Risikos mit Bezug auf Ergebnis und Entgelt (im Gegensatz zur unselbständigen Arbeit).
Wichtig und wesentlich ist aber die Abgrenzung zum Liefervertrag, insbesondere zur Lieferung mit Montage. Gegenstand des Unternehmerwerkvertrages ist ein bestimmtes Ergebnis, Gegenstand des Liefervertrages ist dagegen die Übergabe eines bestimmten Gegenstandes (in der Regel ein Standardprodukt), wobei die Montage oder kleinere Adaptierungen lediglich eine Nebenleistung darstellen und sich der Gegenstand durch die Montage bzw. die entsprechende Leistung grundsätzlich nicht verändert.
Im Werkvertrag haftet der Unternehmer für das Erreichen eines bestimmten Ergebnisses, im Liefervertrag für die Übergabe des Gegenstandes bzw. des Produktes. Der Werkvertrag wird in der Regel durch Handwerks- oder Industrieunternehmen abgeschlossen, der Liefervertrag dagegen durch Handelsunternehmen.
Beispiel: Ein Küchenstudio liefert eine Standardküche und montiert diese (Lieferung mit Montage); eine Tischlerei fertigt auf Maß eine Küche und baut diese ein (Werkvertrag).
Wichtig: Für die zivilrechtliche Einordnung der Verträge ist die Absicht bzw. der Wille der Parteien maßgebend. Es besteht grundsätzlich zwar Freiheit in der Vertragsgestaltung, dies bedeutet aber nicht, dass man durch die einfache, formelle Benennung eines Vertrages die Substanz desselben ändern oder verdecken kann.
In der Praxis wird als „objektiver Parameter“ zur Unterscheidung zwischen beiden Vertragsarten vielfach der Wert der Leistung und jener der verwendeten Gegenstände herangezogen und verglichen. Überwiegt die Leistung, geht man von einer Dienstleistung aus, überwiegt jener der Gegenstände, spricht man von einer Lieferung. Es handelt sich aber nur um eine erste grobe Orientierung, die jedoch nicht hinreichend ist. Dies wurde in verschiedenen Stellungnahmen der Agentur der Einnahmen immer wieder klargestellt. Ausschlaggebend sind der Gegenstand des Vertrages bzw. der Vereinbarung und die entsprechende Absicht der Parteien über das Ergebnis.
Eine erste Aussage der Finanzverwaltung wurde bereits mit Ministerialentscheid Nr. 360009/1976 getroffen. Grundsätzlich wird darin, unter Bezug auf das Kassationsgerichtsurteil Nr. 507 vom 17.02.1958, festgehalten, dass auf die Absicht der Vertragsparteien abzustellen ist. Es muss geprüft werden, ob für die Parteien die Leistung „fare“ oder die Lieferung „dare“ im Vordergrund stehen. Bei Lieferung von Heizanlagen, Klimaanlagen, Waschanlagen, Küchen, Fenster und Türen, Böden usw., geht man grundsätzlich von einer Lieferung mit Montage bzw. Einbau aus, soweit diese vom Hersteller oder vom Händler durchgeführt werden, soweit die Vertragsparteien nicht vereinbart haben, etwas Neues „quid novi“ im Verhältnis zur üblichen Produktion zu schaffen. In letzterem Fall steht dann die Leistung im Vordergrund, da wesentliche Elemente eines Werkvertrages, wie die persönliche Leistung „intuitus personae“ und das unternehmerische Risiko, vorhanden sind.
Erwähnenswert sind weiters die Entscheide Nr. 148/E/2007 und Nr. 220/E/2007 der Agentur der Einnahmen. Im ersten Entscheid werden die erwähnten allgemeinen Grundsätze dargelegt; im Zweiten geht es um eine Handelsfirma, die üblicherweise Gipstrennwände und -decken verkauft und in einem Vertrag für ein Bauunternehmen die Errichtung von Innenwänden übernommen hat. In der Antwort der Agentur kommt sie zum Schluss, dass es sich dann um einen Unternehmerwerkvertrag handelt (und folglich der Übergang der Steuerschuldnerschaft gilt): Gegenstand des Vertrages ist nämlich nicht die Lieferung einer bestimmten Menge an Gipsplatten und –decken, sondern das Schaffen von etwas Neuem, nämlich einer fertigen Innenraumteilung von Räumen und Decken5.
Ähnliche Überlegungen (mit umgekehrtem Ergebnis) findet man auch in einem EuGH-Urteil über die Verlegung eines Unterwasser-Kabels, in welchem es um die Frage ging, ob es sich um Lieferung mit Montage oder Dienstleistung handelt (C-111/05 vom 29. März 2007). Man kommt in diesem Fall zum Ergebnis, dass es sich um eine Lieferung mit Montage handelt, auch wenn die Verlegungsarbeiten überwiegen. Durch die Verlegung entsteht nämlich nicht ein neuer Gegenstand.
Ein weiterer Versuch einer Klärung findet sich auch im Rundschreiben 37/E/2015 Punkt 3, in dem zudem auf die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes6 verwiesen wird. In dieser wird festgehalten, dass man zwar den Wert der Arbeiten im Verhältnis zum Wert der gelieferten Gegenstände beachten muss, der objektiv erscheint, dass dies jedoch nicht von entscheidender Bedeutung für die richtige Klassifizierung ist.
Die Unterscheidung ist nicht immer leicht. In Zweifelsfällen empfiehlt es sich, eine genaue Vertragsgestaltung mit entsprechenden eindeutigen Klauseln zu wählen, wobei immer die Substanz zu bevorzugen ist.
3.4 Sachlicher Anwendungsbereich
Von der Regelung betroffen sind grundsätzlich bestimmte Arbeiten an einem Gebäude, wie im folgenden Absatz definiert. Ausgeschlossen sind Arbeiten an anderen Bauwerken, wie z.B. Brücken, Straßen, Parkplätzen, Kanälen usw. Von der Regelung ebenfalls nicht betroffen sind Arbeiten an Grundstücken, Schwimmbädern oder Gärten, außer diese bilden Bestandteil eines Gebäudes.
Beispiel: Arbeiten an auf dem Dach oder im Gebäude befindlichen Schwimmbäder, Gärten oder Photovoltaikanlagen sind von der Regelung betroffen7.
Nicht betroffen davon sind Arbeiten an Maschinen und Anlagen, die fest mit dem Gebäude verbunden sind, wie Beispielsweise Turbinen von Wasserkraftwerken, Kühlanlagen, im Boden verankerte Maschinen oder ähnliches8, die nicht im Dienste des Gebäudes stehen. In der Anfrage Nr. 954-784/2015 an die Regionale Steuerverwaltung DRE Emilia Romagna fragt ein Hersteller von Industriekühlanlagen für Lebensmittel, ob seine Leistungen in Bestimmungen zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft fallen.
Die Finanzverwaltung hält diesbezüglich fest, dass die Leistungen des Unternehmens im Regelfall unter die Gewerbekennzahl 28.25.00 fallen. Die Kühlanlagen betreffen die gewerbliche Tätigkeit des Unternehmens und sind nicht funktional für das Gebäude, selbst dann nicht, wenn sie fest mit dem Gebäude verankert sind. Dies gilt folglich auch für die Montage, auch wenn von Dritten ausgeführt (Gewerbekennzahl 33.20.09) oder die Wartung und Instandhaltung dieser Anlagen (Gewerbekennzahl 33.12.40).
In Bezug auf Photovoltaikanlagen hat die Agentur der Einnahmen detaillierte Aussagen getroffen, die im Fallbespiel 9.10 wiedergegeben sind. Bezüglich Feuerschutzanlagen9 gilt der Grundsatz, dass die Umkehr der Steuerschuldnerschaft nur für Arbeiten an einem einen Komplex aus Installationen, Geräten, Anlagen, Meldern, usw. im Sinne von D.M. 20.12.2012 anzuwenden sind und soweit sie Gebäude betreffen. Ausgenommen davon sind folglich die Wartung von Feuerlöschern, da diese als bewegliche Güter zu sehen sind, sowie Arbeiten an Feuerschutzanlagen auf Ölplattformen, Schiffen und Industrieanlagen10, da es sich dabei nicht um Gebäude handelt.
Umgekehrt werden Feuerschutztüren und Notausgänge laut vorher angeführtem Ministerialdekret als „Anlagen“ gesehen und fallen demnach unter die Umkehr der Steuerschuldnerschaft.
Nicht betroffen von dieser Regelung sind grundsätzlich Leistungen an beweglichen Gütern.
3.5 Betroffene Bauleistungen
Die Umkehr der Steuerschuldnerschaft betrifft nur jene Leistungen im Baubereich, die im technischen Begleitbericht zum Gesetz festgelegt sind. Es sind die Leistungen der Gruppe 81.2 (Reinigungsleistungen) und 43 für die Leistungen im Baugewerbe der Gewerbekennzahlen nach der Kodifizierung ATECO 2007. Der Gesetzgeber verwendet die Beschreibungen der offiziellen Kodifizierung, was die Identifizierung vereinfacht.
Nicht betroffen von der Bestimmung ist die Miete von Baumaschinen, Gerüsten usw., da diese eigene Gewerbekennzahlen aufweisen11.
Die Leistungen des Abschnittes 43 nach ATECO 2007 sind bereits im übergeordneten Abschnitt F nach ATECO 2007 enthalten. Somit waren diese Leistungen bereits von den Bestimmungen laut Artikel 17 Absatz 6 Buchstabe a) betroffen, womit sich auch die Frage nach der Koordinierung der beiden Bestimmungen stellt. Wenn man den Artikel 17 Absatz 6 Buchstabe a) in der neuen Fassung liest, wird klar, dass die Bestimmung laut Buchstabe a-ter) vorwiegt. Sollte die Umkehr der Steuerschuldnerschaft laut Buchstabe a-ter) nicht notwendig sein, dann muss die Prüfung im Sinne von Buchstabe a) durchgeführt werden.
Es ist zu bemerken, dass im Gegensatz zum Buchstabe a) die Bestimmung laut Buchstabe a-ter) bei Vorliegen aller anderen Voraussetzungen auch gegenüber dem Hauptauftraggeber angewandt werden muss, nicht nur bei Unterwerkverträgen12.
Die im Buchstabe a-ter) genannten Leistungen Abbruch, Installationen und Fertigstellung von Gebäuden werden in folgenden Gruppen des Abschnitts F laut ATECO 2007 aufgelistet:
43.1 Abbrucharbeiten (und Einrichtung von Baustellen)
13
Gegenstand sind Abbrucharbeiten von/an Gebäuden, nicht aber der Abbruch von anderen Bauwerken (z.B. Straßen, Brücken, usw.).
43.2 Elektroinstallationen, sanitäre Installationen und sonstige Bau- und Installationsarbeiten
14
Zu berücksichtigen sind im Wesentlichen die Elektro-, Gas- und Wasserinstallationen sowie die Installation von Klima- und Belüftungsanlagen, immer soweit diese Gebäude betreffen. Es betrifft sowohl Neuinstallationen, als auch Instandhaltung und Reparaturarbeiten.
43.3 Fertigstellung und Abschlussarbeiten an Gebäuden
15
Zu berücksichtigen sind unter anderem Verputz- und Stuckarbeiten, Einbau von Fenstern, Türen, Trennwänden, Malerarbeiten und sonstige Maurerarbeiten16.
In Folge der verwendeten Wortwahl des Gesetzgebers ist man der Auffassung, dass diese Bestimmung ausschließlich für die angeführten Gruppen von Leistungen anzuwenden ist.
Wertvoll in diesem Zusammenhang sind die vom italienischen Statistikamt ISTAT veröffentlichten Erklärungen und Beschreibungen, welche im Internet auf Seite http://www.istat.it/it/archivio/17888 zu finden sind.
Ausgeschlossen sind dagegen grundsätzlich die Lieferungen mit Montage. Es ergeben sich wieder die im Bauwesen üblichen praktischen Anwendungsfragen über die Unterscheidung zwischen einer Lieferung und einer Dienstleistung, wobei es für Dienstleistungen nicht relevant ist, ob es sich um einen Unternehmerwerkvertrag („contratto d’appalto“) oder um einen Werkvertrag („contratto d’opera“) handelt1718.
3.5.1 Abbruch von Gebäuden
Unter dem Begriff „Abbrucharbeiten” werden in der Liste der Gewerbetätigkeiten folgende Leistungen angeführt:
Folgende Leistungen sind von der Umkehr der Steuerschuldnerschaft nicht betroffen:
43.12.00: Vorbereitung der Baustelle und des Grundes (
Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno);
43.13.00: Bohrungen (
Trivellazioni e perforazioni)
Dieser Ausschluss erscheint folgerichtig, da diese Arbeiten in aller Regel nicht ein Gebäude sondern in Vorbereitung eines solchen durchgeführt werden.
Wird ein Abbruch in einem Auftrag mit dem Neubau eines Gebäudes getätigt, dann unterliegt dieser nicht der Umkehr der Steuerschuldnerschaft, da er als vorbereitende Tätigkeit zu sehen ist und der Neubau eines Gebäudes mit MwSt in Rechnung zu stellen ist.
3.5.2 Installationsgewerbe (Elektriker, Installateure usw.)
Ab 2015 müssen auch Unternehmen des Installationsgewerbes gegenüber passiven Steuersubjekten (im gewerblichen Bereich bei Einzelunternehmern und Freiberuflern) die Umkehr der Steuerschuldnerschaft anwenden. Dies immer soweit die Arbeiten an Gebäuden ausgeführt werden, unabhängig von der Stufe des Vertragsverhältnisses (Hauptauftragnehmer, Unterwerkvertrag, usw.) und immer soweit die Leistung nicht als Lieferung mit Montage zu sehen ist19.
Da wesentliche Voraussetzung Arbeiten an einem Gebäude sind, sind folgende Leistungen nicht von der Umkehr der Steuerschuldnerschaft betroffen:
43.21.03: Installation von Straßenbeleuchtungen und Signalanlagen für Flughäfen;
Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione di piste degli aeroporti
43.22.04: Installation von Wasseraufbereitungsanlagen für Schwimmbäder (einschließlich Instandhaltung und Reparatur)
Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05: Installation von Gartenbewässerungsanlagen (einschließlich Instandhaltung und Reparatur)
Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
3.5.3 Fertigstellung von Gebäuden
In diesen Bereich fallen eine ganze Reihe von verschiedenen Tätigkeiten, die zur Fertigstellung eines Gebäudes notwendig sind. Betroffen sind unter anderem Verputz- und Stuckarbeiten, Einbau von Fenstern, Türen, usw., Böden, Fliesen usw., Malerarbeiten, Einbau von Glas und die sonstige Maurerarbeiten.
Von der Umkehr der Steuerschuldnerschaft sind folgende Tätigkeiten auszuschließen:
43.91: Bau von Dächern (Dachdecker, Zimmerer) -
Realizzazione di coperture;
43.12: Vorbereitung der Baustelle -
Preparazione del cantiere;
43.99: Vermietung von Baumaschinen (mit Maschinenführer) -
Noleggio a caldo (con operatore)
43.99.09: Sonstige spezialisierte Bauleistungen a.n.g. - Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a. Darunter fallen die folgenden Tätigkeiten:
Isolierarbeiten (
lavori di isolamento e impermeabilizzazione
);
Entfeuchtung von Gebäuden (
deumdificazione di edifici
);
Montage von Metallelementen hergestellt von Dritten (
posa in opera di elementi d’acciaio non fabbricati in proprio
).
Ganz unterschiedliche Fällen können sich bei den Maurerarbeiten (43.39.01) ergeben: Baut ein Maurer ein neues Gebäude, dann fällt diese Leistung nicht unter die Umkehr der Steuerschuldnerschaft. Führt er Reparaturarbeiten an einem Gebäude aus, dann ist die Umkehr der Steuerschuldnerschaft anzuwenden20.
3.5.4 Wartung und Instandhaltung
Die nationalen Bestimmungen erwähnen nicht ausdrücklich die Wartung und die Instandhaltung von Anlagen und Gebäuden. Dies hat unter den Betroffenen erhebliche Unsicherheit hervorgerufen. Mit dem Rundschreiben Nr. 37/E/2015 wurden diese Zweifel aber definitiv ausgeräumt. Die Agentur der Einnahmen hat, unter Berufung auf das nationale Statistikinstitut ISTAT, geklärt, dass in alle Tätigkeiten der Gruppe 43 auch die Wartung und Instandhaltung hineinfallen und somit von der Umkehr der Steuerschuldnerschaft betroffen sind. Darunter fallen, wie in Kapitel 9 an einem Beispiel gezeigt, somit auch die Wartungsverträge, Kosten für den Bereitschaftsdienst sowie der Austausch von Teilen im Rahmen von Reparaturen für diese Anlagen.
3.5.5 Koordination mit Art. 17 Buchstabe a) MwStG
Es ist festzuhalten, dass im Sinne der neuen Definition die Umkehr der Steuerschuldnerschaft im Sinne von Buchstabe a)21 nur mehr im Falle eines Unterwerkvertrages gegenüber einem Bauunternehmer und für Bauleistungen für folgende Leistungen anzuwenden ist:
Bau von Gebäuden -
attività di costruzione degli edifici
(Gruppe 41.2, Abschnitt F),
Bau von Straßen und Gleisen -
costruzioni di strade e ferrovie
(Gruppe 42.1, Abschnitt F),
Bau von öffentlichen Einrichtungen -
costruzione di opere di pubblica utilità
(Gruppe 42.2, Abschnitt F)
Sonstige Zivilbauten -
costruzioni di altre opere di ingegneria civile
(Gruppe 42.9, Abschnitt F)
Sonstige spezialisierte Bauleistungen -
altri lavori specializzati di costruzione
(Gruppe 43.9, Abschnitt F)
Es handelt sich hierbei um die Leistungen 43.91.00, 43.99.01, 43.99.02. 43.99.09 der Gewerbekennzahlen nach ATECO 2007, wie zum Beispiel Bau von Dächern, Abdeckungen, Einbau von Dachrinnen u.ä., Abdichtungsarbeiten, Bau von Fundamenten, Isolierungsarbeiten, Auf- und Abbau von Gerüsten usw.
Aus diesem Grund kann es in der Praxis bei demselben Unternehmen zu unterschiedlichen Lösungen gegenüber demselben Auftraggeber kommen. Es könnte beispielsweise notwendig sein, für die Leistungen der Elektroinstallationen eine Rechnung mit Übergang der Steuerschuldnerschaft auszustellen, für die Dachdeckerarbeiten hingegen ist eine Rechnung mit MwSt auszustellen.
3.6 Subjektiver (Persönlicher) Anwendungsbereich
Die Pflicht zur Anwendung der umgekehrten Steuerschuld gilt grundsätzlich für alle passiven Steuersubjekte (Freiberufler, Einzelunternehmen, Personengesellschaften, Kapitalgesellschaften, Vereine mit gewerblicher Tätigkeit, usw.), immer soweit die Leistungen gegenüber einem anderen passiven Steuersubjekt ausgeführt werden.
Ausgenommen sind demnach Rechnungen an Private, da sie keine MwSt abrechnen können, aber auch Rechnungen gegenüber nicht gewerblichen Körperschaften, für Vereinen mit Anwendung des Gesetzes 398/199122.
Im Gegensatz zu den Bestimmungen laut Buchstabe a), wie nachfolgend detailliert beschrieben, gibt es in Bezug auf die Umkehr der Steuerschuldnerschaft laut Buchstabe a-ter) keine Sonderregelung gegenüber Generalunternehmern oder öffentlichen Körperschaften. Für letztere gelten jedoch besondere Bestimmungen im Zusammenspiel mit der Spaltung der MwSt („Split Payment“) wie in Abschnitt „Neuerungen 2016“ beschrieben.
Voraussetzung ist, dass der „Bauunternehmer“ (Auftragnehmer) die MwSt normal abrechnet und kein Sondersystem, wie beispielsweise die Regelung für Kleinstunternehmer „Minimi“ oder das Pauschalsystem laut Haushaltsgesetz 2015 anwendet, da diese grundsätzlich von der Anlastung der MwSt befreit sind.
Ist die Leistung hingegen aus einem bestimmten Grund nicht steuerpflichtig23, so unterliegt sie grundsätzlich nicht der Umkehr der Steuerschuldnerschaft, da diesbezüglich kein Missbrauch möglich ist24.
3.7 Zusammenspiel mit besonderen Steuersystemen
3.7.1 MwSt nach Zu- und Abfluss - Artikel 32-bis D.L. Nr. 83/2012
Das Steuersystem nach Zu- und Abfluss25 sieht vor, dass die Vorsteuer erst im Moment der Zahlung abgezogen werden kann und die MwSt erst im Moment des Zahlungseinganges geschuldet ist.
Im Rundschreiben der Agentur der Einnahmen Nr. 44/E/2012, Absatz 5, wird diesbezüglich präzisiert, dass diese Regelung bei Vorliegen von Sonderbestimmungen nicht angewandt werden darf. Darunter fallen auch die Bestimmungen zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft.
Sollte somit ein Unternehmen, das diese Bestimmung anwendet, eine Leistung erbringen, welche unter die Reverse Charge Regelung fällt, so verfällt dieses Steuersystem und der Unternehmer muss somit die gesamte fällige MwSt bei der nächsten Abrechnung berücksichtigen.
3.7.2 Neues Pauschalsystem und Kleinstunternehmerregelung
Das Haushaltsgesetz für 2015 hat mit Artikel 1, Ziffern 54 bis 89 ab dem 1. Januar 2015 ein neues Pauschalsystem für Kleinstunternehmer und –freiberufler eingeführt. Innerhalb bestimmter Umsatzgrenzen können diese Subjekte Rechnungen ohne MwSt ausstellen und sind von allen MwSt-Pflichten befreit.
In Rundschreiben Nr. 14/E/201526 wurde festgelegt, dass diese Unternehmer und Freiberufler weiterhin Rechnungen ohne MwSt ausstellen, soweit sie der Leistungserbringer sind.
Im Falle des Erhalts einer Rechnung müssen sie wie alle anderen passiven Steuersubjekte auch die Rechnung mit MwSt ergänzen und die MwSt abführen, da sie vom Abzug der Vorsteuer ausgeschlossen sind.
Gleiche Regelung gilt auch für das begünstigte Steuersystem für Jungunternehmer (Absätze 1 und 2 Art. 27 DL 98/2011), umgangssprachlich als „Minimi“ bezeichnet.
3.7.3 Sonstige Ausnahmen
Das Rundschreiben Nr. 14/E/2015 sieht eine Reihe von weiteren Subjekten vor, bei denen der Leistende die MwSt anlasten und nicht die Bestimmungen zur Umkehr der Steuerschuldnerschaft anwenden muss:
Kleinlandwirte mit Umsatz bis 7.000 Euro;
Vereine nach Gesetz 398/1991;
Unternehmer mit Sonderregelung laut Artikel 74 MwStG (Schausteller u.ä.).
3.7.4 Umkehr der Steuerschuldnerschaft und Plafond
Im Falle eines Kunden mit Plafond (gewohnheitsmäßiger Exporteur) ist die Sonderbestimmung laut Artikel 17 Absatz 6 Buchstabe a-ter) vorherrschend. Die Umsätze sind also nicht dem Plafond anzurechnen. Die Finanzverwaltung begründet das damit, dass diese Regelung zum Schutze vor Missbrauch erlassen wurde und somit vorrangig ist27.
3.8 Konsortien und Bietergemeinschaften
3.8.1 Konsortien mit externer Tätigkeit
Im Sinne des Ministerialentscheids 19/E/2007, des Rundschreibens 172/E/2007 und des Ministerialentscheides 242/E/2007 wird bestätigt, dass die teilnehmenden Unternehmen ihre Leistungen dem Konsortium unter Anwendung derselben Bestimmung in Rechnung stellen müssen, wie die Leistungen des Konsortiums an den Auftraggeber fakturiert werden. Ausgenommen sind die Neuerungen laut Kapitel „Neuerungen 2016“.