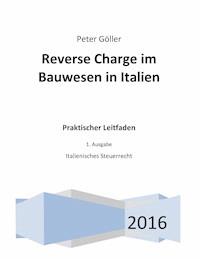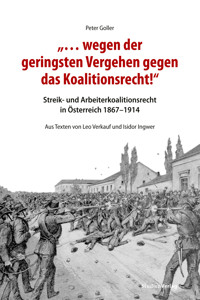
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: StudienVerlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
1870 hat die österreichische Arbeiterklasse das Koalitionsrecht errungen. Sozialdemokratische Arbeitsrechtler wie Isidor Ingwer oder der SP-Reichsratsabgeordnete Leo Verkauf haben in den Jahren vor 1914 vor dem Hintergrund radikaler, oft mit militärischer Gewalt unterdrückter Arbeitskämpfe (z. B. die toten böhmisch-mährischen Bergarbeiter 1894, Wiener Ziegelarbeiterstreik 1895, Bergarbeiterstreik 1900, die Toten des Generalstreiks von Triest 1902 oder die Toten des Lemberger Maurer- und Zimmererausstandes 1902) beschrieben, wie das Streikrecht vom habsburgischen Behördenapparat bis zur offenen Repression eingeschränkt wurde. Viele Arbeiter und Arbeiterinnen wurden wegen kleiner Verstöße gegen das Koalitionsgesetz belangt. Die Erpressungsnormen des Strafrechts wurden gegen Ausständische mobilisiert. Nach dem Vereins- und Versammlungsrecht wurden Arbeitervereine verboten, Streikversammlungen aufgelöst. Mit dem "Prügelpatent" von 1854 wurde gegen Streikposten vorgegangen. Unzählige Arbeiter wurden nach der "Kontraktbruchregelung" der Gewerbeordnung sanktioniert. Mit Hilfe der "Vagabundengesetzgebung" wurden Streikende abgeschoben und "abgeschafft". Es soll an Isidor Ingwer erinnert werden, der – wie Forschungen der Wiener Rechtshistorikerin Ilse Reiter-Zatloukal ergeben haben – schon 1893 wegen des Ausrufs "Es lebe die rothe revolutionäre Socialdemokratie!" – abgeurteilt und als "äußerst gefährlicher Agitator" aus Mähren "abgeschafft" wurde, und der am 19. August 1942 knapp nach seiner Deportation im KZ Theresienstadt verstorben ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Peter Goller
„… wegen der geringsten Vergehengegen das Koalitionsrecht!“
Streik- und Arbeiterkoalitionsrechtin Österreich 1867–1914
STUDIEN ZU GESCHICHTE UND POLITIK
Band 28herausgegeben von Horst SchreiberMichael-Gaismair-Gesellschaftwww.gaismair-gesellschaft.at
Inhaltsverzeichnis
Vorwort des Reihenherausgebers
Vorbemerkung
1. Leo Verkauf und Isidor Ingwer über das Koalitions- und Arbeitskampfrecht
Vereins- und Versammlungsrecht gegen Streikende
Ausnahmezustand, „Prügelpatent“, Abschiebungen
„Kontraktbruch“, Arbeitsbuch
„Erpressung“: Streik und Strafrecht
2. Aus der Geschichte der Streikdisziplinierung und Gewerkschaftsrepression seit 1867
Streikfrequenz – Streikmilitanz 1889–1900
Repression gegen die 1. Mai-Bewegung ab 1890
„Schub“, „Abschaffung“ von Streikaktivisten
Streikstatistik als „Strafregister“ (ab 1894)
Anwendung des „Prügelpatents“ 1854
Tote in böhmisch-mährischen Bergarbeiterkämpfen 1894
Abstrafungen nach § 3 Koalitionsgesetz 1870
„Nichtneutralität“ des Staatsapparats
Wiener Ziegelarbeiterstreik 1895
Bergarbeiterkämpfe 1896
Eisenbahner ab 1896/97: Streik, passive Resistenz?
Arbeitskämpfe für die Anerkennung der Organisation
Weber-, Spinnerstreiks im Trautenauer Textilindustriebezirk 1897
Brünner Textilarbeiterstreik 1899
Großer Bergarbeiterstreik 1900
Sinkende Streikfrequenz in der Krise 1901–1904. Militäreinsatz in Triest und Lemberg (1902)
Ahndung des „Kontraktbruchs“
Aussperrungen: „Klein-Crimmitschau“ in Österreich? (1903/04)
Streikrepression und regionale Arbeitskämpfe am Beispiel Tirols
Repressiveres „Neues Streikrecht“. Forderungen des Kapitals seit 1907. Ende des Streikrechts 1914
3. Aus Texten von Leo Verkauf und Isidor Ingwer 1894–1909
L. Verkauf: Die bürgerlichen Klassen und das Strafrecht (1894)
L. Verkauf: Zur Geschichte des Arbeiterrechtes in Österreich (1905)
I. Ingwer – I. Rosner: Volkstümliches Handbuch des österreichischen Rechtes (1907/08)
I. Ingwer: Das Koalitionsrecht der Arbeiter (1909)
Anhang
V. Adler: Das Koalitionsrecht in Österreich (1888)
Das Koalitionsrecht in Gesetz und Anwendung (Arbeiter-Zeitung 1890)
Zur Streikbewegung (Arbeiter-Zeitung 1890)
Nutzen und Gefahren des Streiks (Arbeiter-Zeitung 1890)
Industriellenbünde für eine „moderne Streikgesetzgebung“ (Die Gewerkschaft 1907)
Die Staatsgewalt im Dienste der Unternehmer (Die Gewerkschaft 1908)
Anmerkungen
Vorwort des Reihenherausgebers
Knappe zwei Jahrzehnte nach der Befreiung Österreichs setzte in den 1960er Jahren die Beschäftigung mit der Geschichte der sozialistischen Arbeiterbewegung „in der Provinz“ ein: Manfred Scheuch schrieb zur Geschichte der Vorarlberger Arbeiterschaft vor 1918 (Wiener Dissertation 1960), Notburga Mair zur Geschichte der Tiroler Arbeiterbewegung (Wiener Dissertation 1966), Josef Kaut über den „steinigen Weg“ der sozialistischen Arbeiterbewegung in Salzburg (1961), Gerhart Baron zu den „Anfängen der Arbeiterbildungsvereine in Oberösterreich“ (1971) oder Karl Dinklage zur Geschichte der Kärntner Arbeiterschaft (1976/82).
Für Tirol hat Gerhard Oberkofler 1974 die von der Tiroler SPÖ herausgegebene Studie „Februar 1934. Die historische Entwicklung am Beispiel Tirols“ veröffentlicht. Er wurde unterstützt von Herbert Steiner (1923–2001), dem Leiter des Dokumentationsarchivs des Österreichischen Widerstandes, und von Edwin Tangl (1912–1990), der nach seiner Widerstandstätigkeit in der französischen Resistance zuerst im KZ Flossenbürg und dann bis Ende April 1945 im KZ Dachau interniert war.
Nach dem Erscheinen des Abschnitts über die Tiroler Arbeiterbewegung vom Vormärz bis 1917 reagierte die „Tiroler Tageszeitung“ am 6. Juli 1977 empört. Sie wähnte die „Tiroler SPÖ auf dem Weg zum Marxismus-Leninismus“ und beschuldigte den SPÖ-Landesparteivorsitzenden Herbert Salcher, Klassenkämpfer zu fördern, gemeint war der „marxistische proletarische ‚Historiker‘ Gerhard Oberkofler“.
1979 konnte Oberkofler mit „Die Tiroler Arbeiterbewegung. Von den Anfängen bis zum Ende des 2. Weltkriegs“ eine Gesamtdarstellung präsentieren. Für das italienischsprachige Tirol war 1971 Renato Monteleones „Il movimento socialista nel Trentino 1894–1914“ erschienen.
In den 1980er Jahren entstanden einige universitäre Abschlussarbeiten zur Geschichte der Tiroler und Vorarlberger Arbeiterbewegung, so 1983 die Dissertation von Werner Hanni zu den Streikkämpfen in Tirol von 1870–1918, die Arbeiten von Robert Sutterlütti zur Lage und zum sozialen Widerstand der italienischen Arbeiter in Vorarlberg oder 1989 von Hubert J. Auer zur Lage der Arbeiter in Wattens.
In jüngerer Zeit folgten Diplomarbeiten und Dissertationen von Joachim Gatterer, 2010 über „rote milben im Gefieder“ zur sozialdemokratischen und kommunistischen Parteipolitik in Südtirol und daran anschließend 2017 eine zweibändige Dissertation, 2010 von Angelika Mayr „Arbeit im Krieg. Die sozioökonomische Lage der Arbeiterschaft in Tirol im Ersten Weltkrieg“ und 2014 von Matthias Scantamburlo über die Anfänge der sozialdemokratischen Tiroler „Volks-Zeitung“ 1892–1896.
Christoph von Hartungen und Günther Pallaver veranstalteten 1983 im Rahmen der „Gaismair-Tage“ mit Blick auf das südliche Tirol das Symposium „Arbeiterbewegung und Sozialismus“, dem sich eine Publikation anschloss.
Die 1982 gegründete Johann-August-Malin-Gesellschaft hat in ihrer Schriftenreihe zahlreiche Publikationen zur Geschichte der Vorarlberger Arbeiterbewegung und zum regionalen antifaschistischen Widerstand herausgegeben. Der 1984 veröffentlichte Sammelband „Im Prinzip Hoffnung“ entstand in Begleitung zur Bregenzer Ausstellung „Arbeiterbewegung in Vorarlberg 1870– 1946“. 1985 folgte der Band „Von Herren und Menschen. Verfolgung und Widerstand in Vorarlberg 1933–1945“. 1994 konnte die Malin-Gesellschaft mit Reinhard Mittersteiners „‚Fremdhäßige‘, Handwerker & Genossen. Die Entstehung der sozialdemokratischen Arbeiterbewegung in Vorarlberg“ eine Gesamtdarstellung vorlegen.
Die Tiroler Michael-Gaismair-Gesellschaft hat 2003 den biographisch ausgerichteten Sammelband „Sozialdemokratie in Tirol. Die Anfänge“ (herausgegeben von Rainer Hofmann und Horst Schreiber) publiziert. 2012 folgte in der Schriftenreihe „Studien zu Geschichte und Politik“ Gisela Hormayrs Band „‚Ich sterbe stolz und aufrecht‘. Tiroler SozialistInnen und KommunistInnen im Widerstand gegen Hitler“. 2022 hat Gisela Hormayr für diese Reihe „Aufbruch in die ‚Heimat des Proletariats‘. Tiroler in der Sowjetunion 1922–1938“ verfasst.
Mit dem vorliegenden Band zur Geschichte des österreichischen Streikrechts und österreichischer Arbeitskämpfe setzt die Michael-Gaismair-Gesellschaft, begleitet von _erinnern.at_, diesen Themenschwerpunkt fort.
Innsbruck, Frühjahr 2023Horst Schreiber
Vorbemerkung
1870 hat die österreichische Arbeiterklasse das Koalitionsrecht errungen. Sozialdemokratische Arbeitsrechtler wie Isidor Ingwer oder Leo Verkauf haben in den Jahren vor 1914 vor dem Hintergrund großer und radikaler, oft mit militärischer Gewalt unterdrückter Arbeitskämpfe (z. B. Wiener Ziegelarbeiterstreik 1895, Bergarbeiterstreik 1900) beschrieben, wie das Koalitionsund Streikrecht vom habsburgischen Behörden- und Justizapparat zu Lasten der Arbeiter bis hin zur offenen Repression eingeschränkt wurde.
Viele Arbeiter und Arbeiterinnen wurden selbst wegen angeblich geringfügiger Verstöße gegen das Koalitionsgesetz vom 7. April 1870 belangt, deshalb das Titelmotto „wegen der geringsten Vergehen gegen das Koalitionsrecht!“, entnommen aus dem Bericht des Vorarlberger Gewerkschaftssekretariats für das Jahr 1910, erschienen in „Die Gewerkschaft. Organ der Gewerkschaftskommission Österreichs“ vom 14. April 1911.
Innsbruck, Frühjahr 2023Peter Goller
1. Leo Verkauf und Isidor Ingwer über das Koalitionsund Arbeitskampfrecht
Leo Verkauf (1858–1933), zwischen 1897 und 1901 sozialdemokratischer Reichsratsabgeordneter, war in den 1890er Jahren als gewerkschaftlicher Rechtsberater in (böhmischen) Arbeitskämpfen tätig. Seit den 1880er Jahren hat Verkauf zu Fragen des Arbeitsrechts, der Arbeiterschutzgesetzgebung publiziert. Als Rechtskonsulent der Wiener Genossenschaftskrankenkassa entwickelte sich Verkauf zum Experten für das Sozialversicherungsrecht.1
Auch Isidor Ingwer (1866–1942, in das KZ Theresienstadt deportiert, dort umgekommen) war bereits Mitte der 1890er Jahre als junger Wiener Anwalt in der Rechtsberatung der in großen Lohnkämpfen bedrängten Bergarbeiter eingesetzt.2
In Verkaufs Kritik des Strafgesetzentwurfes werden 1894 Anklänge an Karl Marx’ Rede vom Recht als bürgerlichem Klassenrecht sichtbar.
In seiner „Geschichte des Arbeiterrechtes in Österreich“ – ursprünglich in drei Beiträgen im von Ernst Mischler und Josef Ulbrich herausgegebenen „Österreichischen Staatswörterbuch“ veröffentlicht – bot Leo Verkauf 1905 nicht nur eine Darstellung des geltenden Koalitionsrechtes und seiner Geschichte, nicht nur einen Überblick über die rechtlich-administrativen Beschneidungen des Arbeitskampfrechts, sondern auch eine knappe Geschichte der österreichischen Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung: von den Arbeiterbildungsvereinen des konstitutionellen Jahres 1867 über die erste Unterdrückung der Bewegung im „Hochverratsprozess“ 1870, vom ersten Fraktionskampf zwischen sozialliberalen „Gemäßigten“ und Arbeitersozialisten im Vorfeld des Neudörfler Parteitages 1874, über den organisatorischen Einbruch infolge der kapitalistischen Depression nach Ende des „Gründerfiebers“ 1873 bis hin zum zweiten Flügelkampf zwischen Arbeiterradikalen und (reformistischen) Sozialdemokraten im Vorfeld des „Einigungsparteitages“ von Hainfeld 1888/89 reichend. Verkauf deutet auch die vereinsrechtlichen Hürden für die gewerkschaftlichen Fachvereine an, etwa das Verbot, überlokal zentrale Verbände zu bilden, ferner die Schwierigkeiten, die sich aus der richtungsmäßigen Spaltung zwischen den freien sozialdemokratischen und den christlichsozialen Gewerkschaften, insbesondere aber auch aus der nationalen Spaltung zwischen der deutschsprachigen Wiener Gewerkschaftskommission und der Prager tschechischen Kommission ab 1896/97 ergaben. Das gewerkschaftliche Unterstützungswesen (für Arbeitslose, Kranke usw.) wurde nicht zuletzt durch den Versuch, die entsprechenden Vereine der „bürgerlichen Versicherungstechnik“ und damit der direkten staatlichen Aufsicht nach dem Vereinspatent von 1852 zu unterstellen, behindert, wie Verkauf in einem eigenen Abschnitt beschreibt.
Verkauf, der 1892/93 an der Errichtung der zentralen österreichischen Gewerkschaftskommission in Wien beteiligt war, beschreibt neben einigen streikstatistischen Angaben und einigen Hinweisen zur Aussperrungspolitik des Kapitals auch die Stellung der Gewerkschaften zum Arbeitskampf, so das „Streikreglement“ von 1894.
So wie Isidor Ingwer mit seinem „sogenannten Arbeitsvertrag“ (1895) und mit seinem „Arbeitsverhältnis nach österreichischem Recht“ (1905) legt Leo Verkauf 1905 auch einen Abschnitt zum Individualarbeitsrecht vor, zu den Arten des Arbeitsvertrages, zu den Lohnformen, den Formen des Abschlusses und der Auflösung der Verträge. Ebenfalls gleich Isidor Rosners und Isidor Ingwers „Kollektivvertrag“ (1903 bzw. 1905) fügt Leo Verkauf ein Kapitel über die seit den 1890er Jahren vermehrt einsetzende Kollektiv-/Tarifvertragsbewegung ein.
Wie Isidor Ingwer zeigt sich auch Leo Verkauf an Anton Mengers sozialer Jurisprudenz, an Mengers „bürgerlichem Recht und die besitzlosen Volksklassen“, einer Kritik des Entwurfs für ein bürgerliches Gesetzbuch für Deutschland, orientiert. Hatte Anton Menger 1890 die „Dürftigkeit der Bestimmungen“ des BGB-Entwurfs zum Dienst- und Lohnvertrag kritisiert, so sieht Verkauf das Koalitionsrecht der österreichischen Arbeiterklasse durch eine Strafgesetznovelle gefährdet.
Der „Juristensozialist“ Anton Menger, der 1886 in seinem „Recht auf den vollen Arbeitsertrag“ Karl Marx’ Mehrwerttheorie, den Historischen Materialismus, abgelehnt hatte, galt Isidor Ingwer und seinem langjährigen Kanzleipartner Isidor Rosner 1903 trotzdem als Vordenker eines sozialistischen Rechtsystems. In einer Besprechung von Mengers „Neuer Staatslehre“ halten sie fest, dass dieser 1890 gezeigt hat, „wie die deutschen Gesetzgeber die Interessen der besitzlosen Volksklassen, auch wenn man die grundlegenden Prinzipien unseres heutigen Privatrechts als Ausgangspunkt anerkennt, in dem Entwurfe verletzten“. Auch wenn manches bei Menger – etwa im Familienrecht – kleinbürgerliche Züge, manches unbestimmt utopisch sei, auch wenn sich Menger nicht konsequent zur Republiklosung durchringen konnte, gilt für Ingwer und Rosner: „Was Savigny für das historische, war Menger für die soziale Rechtswissenschaft. Während aber Savigny zur neuerlichen Unterwerfung der Völker unter das Joch des römischen Herrenrechtes beigetragen hat, hat Menger für das Recht der Unterdrückten gestritten.“3
Isidor Ingwer bezog sich in vielen Arbeiten auch auf das sozialpolitische Werk des linksliberalen böhmischen Arztes und Reichsratsabgeordneten Franz Moritz Roser, der 1869 mehrere parlamentarische Anträge zur Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit auf zehn Stunden, zum Verbot der Kinderarbeit, zur Einführung von Fabrikinspektoren und zur Aufhebung der in den Paragraphen 479 bis 481 des Strafgesetzbuches 1852 festgeschriebenen Koalitionsverbote eingebracht hatte.4
Wiederholt hat Isidor Ingwer auf die arbeiterfreundliche soziale Rechtswissenschaft des „fortschrittsliberalen“ Wiener Rechtsanwalts Julius Ofner verwiesen. 1910 hat Ofner als Reichsratsabgeordneter die Beseitigung des § 85 der Gewerbeordnung, wonach der Kontraktbruch der Arbeiter (etwa bei Austritt aus Anlass eines Streiks ohne Einhaltung der Kündigungsfrist) nicht nur strafbar ist, sondern auch zivile Schadenersatzansprüche nach sich ziehen kann, beantragt. Ofners „soziales Recht“ und sein schon 1885 formuliertes „Recht auf Arbeit“, seine Kritik einer romanistischen Begriffsjurisprudenz und sein Beitrag zur Reform der „Dienst- und Werkvertrag“-Bestimmungen im Zug der ABGB-Teilnovellierung fanden Ingwers Zustimmung.
So wie Ingwer und Rosner sich für ihre Arbeiten zum Staats- und Verfassungsrecht auf Karl Marx’ und Friedrich Engels’ Analysen zur Revolutionsbewegung von 1848 („Klassenkämpfe in Frankreich“ oder „Revolution und Konterrevolution in Deutschland“) stützten, so wie Ingwer sich in seiner Ablehnung der bürgerlich-rechtlichen Kategorie des „sogenannten freien Arbeitsvertrages“ auf die Abschnitte zur „Ware Arbeitskraft“ und zur Mehrwerttheorie in Marx’ „Kapital I“ berufen hat,5 so benützte er für seine Arbeiten zum gewerkschaftlichen Koalitionsrecht Karl Marx’ „Anti-Proudhon“ (1847).
Karl Marx hat in seiner unter dem Titel „Das Elend der Philosophie“ veröffentlichten Kritik am französischen Sozialisten Pierre-Joseph Proudhon den Wert der „Strikes und Arbeiterkoalitionen“ verteidigt. Proudhon hatte gewerkschaftliche Organisationen und Lohnkämpfe als nutzlos qualifiziert. Marx hielt dem entgegen: „So hat die Koalition stets einen doppelten Zweck, den, die Konkurrenz der Arbeiter unter sich aufzuheben, um dem Kapitalisten eine allgemeine Konkurrenz machen zu können. Wenn der erste Zweck des Widerstandes nur die Aufrechterhaltung der Löhne war, so formieren sich die anfangs isolierten Koalitionen in dem Maße, wie die Kapitalisten ihrerseits sich behufs der Repression vereinigen zu Gruppen und gegenüber dem stets vereinigten Kapital wird die Aufrechterhaltung der Assoziationen notwendiger für sie als die des Lohnes.“6
Isidor Ingwer hat die Geschichte des englischen Koalitions- und Streikrechts, die sukzessive, allerdings von sonderrechtlichen Strafbestimmungen begleitete, in den 1820er Jahren erfolgte Aufhebung der Organisationsverbote von 1799 nach der von den „Sozialfabianern“ Beatrice und Sidney Webb verfassten „Geschichte des englischen Trade-Unionismus“ beschrieben.7
Nach einem Einschub über die französische Verbotsgeschichte seit den Tagen der bürgerlichen Revolution von 1789 und über die Sanktionsnormen des Code Pénal (1810) führte Ingwer noch die Bestimmungen des belgischen Koalitionsgesetzes von 1867 an, „weil es – wie der Justizminister Dr. Herbst wiederholt hervorhob – dem österreichischen Gesetze [1870] zum Vorbild gedient hat“.
Für die Länder des Deutschen Bundes referierte Ingwer nach den 1898/99 in der sozialistischen Theoriezeitschrift „Neue Zeit“ erschienenen „Beiträgen zur Geschichte des Koalitionsrechts in Deutschland“, verfasst von Max Schippel, einem Vertreter des revisionistischen Parteiflügels der Sozialdemokratie. 1869 wurde im norddeutschen Reichstag im Weg der Gewerbeordnung das Koalitionsrecht zugestanden und zugleich „verstümmelt“, wie Schippel formuliert: „Neben der Freiheit des Koalitionsrechts in § 152 bringt jedoch die Gewerbeordnung bekanntlich sofort in § 153 eine arge Verstümmelung derselben Freiheit.“ Diese strafrechtliche Begrenzung galt als „unentbehrliches Korrelat“ des Koalitionsrechts: „Der § 153 der Reichsgewerbeordnung droht außergewöhnliche Strafen an für den Fall, dass bestimmte Thaten – körperlicher Zwang Drohungen, Ehrverletzungen oder Verrufserklärungen – in Verbindung stehen mit Koalitionen. Es wird für diese Thaten ein Sonderstrafrecht geschaffen, falls sie darauf hinwirken oder hinwirken sollen, dass Andere an Koalitionsverabredungen ‚theilnehmen oder ihnen Folge leisten‘ oder ‚von solchen Verabredungen zurücktreten‘. Körperlicher Zwang, Drohung, Ehrverletzung, Verrufserklärung werden schärfer wie sonst oder unter Umständen überhaupt erst strafbar, wenn sie von der verbrecherischen Absicht, einen Koalitionsverband aufrecht zu erhalten, begleitet sind. Dem allgemeinen Strafgesetzbuch, das natürlich für den Theilnehmer an einer Koalition genau so gilt wie für jeden Staatsbürger, hat man noch ein kleines Ausnahmegesetz an die Seite gegeben, das seine Zuchtrute nur gegen Koalitionstheilnehmer ausstreckt.“8
Der „Kathedersozialist“ Lujo Brentano verteidigte die Arbeitskampfmittel der Gewerkschaften (Streikversammlungen, Streiksicherung, Streikposten, Sammeln von Solidaritätsgeldern) gegen die von Kaiser Wilhelm II. initiierte „Zuchthausvorlage“, so 1899 in dem von Ingwer viel benützten Vortrag „Der Schutz der Arbeitswilligen“. Brentano verweist in einem eindrucksvollen Bild auf das brüchige Recht der Arbeiterorganisationen: „Die Arbeiter haben das Koalitionsrecht, aber wenn sie davon Gebrauch machen, werden sie bestraft.“9
Die Sanktionierung des Aufrufs zum Streik, die Bestrafung von Streikposten – in Deutschland nach dem § 153 der Gewerbeordnung, analog dem § 3 des österreichischen Koalitionsgesetzes 1870 – erklärt Brentano für Koalitionsfreiheit widrig, ja dies würde das den Arbeitern gewährte „Koalitionsrecht illusorisch machen“: „Unter die sogen. Aufreizung zum Streik fällt jedwede Aufforderung, sich an einer Arbeitseinstellung zur Erzielung besserer Arbeitsbedingungen zu betheiligen; unter das Postenstehen jedwede Mittheilung, dass irgendwo die Arbeiter sich im Ausstand befinden. Beides sind an sich absolut rechtmäßige Mittel zur Verwirklichung eines gesetzlich erlaubten Zweckes. Ohne Anwendung dieser Mittel kann dieser Zweck in sehr vielen, ja z. Z. wohl in den meisten Fällen gar nicht erreicht werden.“
Ingwer übernimmt Brentanos Klage, wonach durch repressive Auslegung des Versammlungsrechts ein Großteil der Koalitionsaktivitäten, der Streikorganisation unterlaufen wird. Zum häufigen generellen Verbot von Streikversammlungen kommt etwa der von vornherein feststehende Ausschluss bestimmter Gruppen (Frauen, Jugendliche): „Wo solche Verbote bestehen, haben die Arbeiter zwar theoretisch das Koalitionsrecht, aber wer davon Gebrauch macht, kann wegen Verfehlung gegen das Vereins- und Versammlungsrecht bestraft werden.“
Bei Brentano fand Ingwer auch beschrieben, dass die zivilrechtliche Beschränkung des Koalitionsrechts durch die Normierung, dass Verabredungen zur Erzielung höherer Löhne, so wie Arbeitgeberabsprachen, kein Klagerecht nach sich ziehen, keine rechtliche Wirkung haben, in Österreich § 2 Koalitionsgesetz, nur die Arbeiterschaft trifft: „Diese Bestimmung, wodurch die Nichtklagbarkeit der Koalitionsverabredungen ausgesprochen wird, richtet sich thatsächlich lediglich gegen die Arbeiter. Die Arbeitgeber wussten ihn schon zur Zeit A. Smiths’s, wie dieser berichtet, zu umgehen, indem sie trockene Wechsel bei der Vereinsleitung hinterlegten, welche von dieser im Fall des Abfalls von der Vereinbarung zur Zahlung präsentirt wurden. So ist es noch heute.“
Ingwer begrüßt es, wenn Brentano in spöttischer Manier die bürgerlichen Unternehmermotive zum Schutz der „arbeitswilligen“ Streikbrecher als heuchlerisch karikiert. Hinter dem vorgetäuschten „Schutz der Arbeitswilligen“ verbirgt sich der Schutz von Kapitalinteressen, der Schutz der „Profitwut der Unternehmer“: „Aber nicht im eigenen Interesse [der Kapitalisten] ist es, dass sie erhöhten Schutz der Arbeit verlangen; nein, sie thun dies lediglich im Interesse der einzelnen Arbeiter, die nur durch den Druck, der durch ihre Genossen auf sie geübt werde, genöthigt würden, nicht zu arbeiten, und namentlich im Interesse der Arbeiterfrauen, die ihnen oft unter Thränen hierüber geklagt hätten.“
Die Statistik der Streikstrafen würde – so Brentano 1899 in seinem vor dem Hintergrund der „Zuchthausvorlage“ gehaltenen Vortrag – eher für Milderung und Herabsetzung der Sanktionen sprechen als für die geforderte drastische Anhebung.10
1900 hat Philipp Lotmar, der 1888 als sozialdemokratischer Intellektueller dem deutschen „Sozialistenverbot“ ausweichend von München an die Universität Bern übergetreten war, im Rahmen einer Studie über „Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern“ eine rechtliche Absicherung der alltäglich beschränkten Koalitionsfreiheit verlangt. Ingwer zitiert 1909 Lotmars an Lujo Brentano erinnernde drastische Aussage: „Die gänzliche Koalitionsfreiheit ist nur Unverbotenheit und Straflosigkeit: Die Koalition ist frei, nämlich vogelfrei und ein Koalitionsrecht ist noch zu schaffen. (Brauns Archiv [für soziale Gesetzgebung und Statistik], XV. Band, Seite 58ff.)“.11
Carl Legien, seit den 1890er Jahren Vorsitzender der Generalkommission der deutschen Gewerkschaften, 1914 Befürworter eines Streikverzichts im Rahmen der „Burgfriedenspolitik“, 1918 Gegner einer räterepublikanischen Revolution, hat 1899 im Auftrag der deutschen Gewerkschaften die Denkschrift „Koalitionsrecht der deutschen Arbeiter in Theorie und Praxis“ verfasst. Legien belegte, wie die „Auslegungskünste der Juristen“ die 1869 gewährte Koalitionsfreiheit durchlöchern. Anhand vieler Beispiele aus Legiens Dokumentation konnte Isidor Ingwer 1909 das analoge Vorgehen der österreichischen Gerichtsinstanzen und Behörden nachverfolgen.12
Hugo Haase, Arbeiteranwalt, 1907 Verteidiger von Karl Liebknecht in einem politischen Prozess wegen dessen Antimilitarismus, SPD-Reichstagsabgeordneter, von 1911 bis zum Bruch mit der „Burgfriedenspolitik“ der Sozialdemokratie Parteivorsitzender, dann 1916 Rückkehr zum proletarischen Internationalismus, hat mit seinem 1902 veröffentlichten Aufsatz „Koalitionsrecht und Erpressung“ einem Isidor Ingwer besonders viele Leitmotive vorgegeben.
So wie der § 153 der ab 1871 gesamtdeutschen Gewerbeordnung die Anwendung von körperlichem Zwang, von Drohungen, Ehrverletzungen oder Verrufserklärungen im Zusammenhang mit dem Beitritt zu einer Koalition „mit Gefängnis bis zu drei Monaten bestraft, sofern nach dem allgemeinen Strafgesetz nicht eine härtere Strafe eintritt“, so war dies unter der Vorgabe „Mittel der Einschüchterung oder Gewalt“ auch im österreichischen Koalitionsgesetz vorgesehen. Hugo Haase schließt daraus, dass der § 153 eine Ausnahmerechtsnorm, ein gegen die Arbeiterklasse gerichtetes Sonderrecht darstellt, das etwa nach dem Strafgesetzbuch mit gar keiner Strafe oder nur mit geringer Geldstrafe sanktionierte Handlungen mit Gefängnis ahndet: „In demselben Augenblick, in welchem der Gesetzgeber durch den § 152 ein Ausnahmerecht beseitigt, erzeugte die Furcht vor den Arbeiterkoalitionen das neue strafrechtliche Ausnahmegesetz des § 153, damit – wie es hieß – das Koalitionsrecht nicht in Koalitionszwang ausarte. Das im § 152 gewährleistete Prinzip der Koalitionsfreiheit verblasste vor den Augen der Arbeiterfeinde sehr bald, der daneben aufgerichtete Galgen des § 153 erstrahlte dagegen in um so hellerem Lichte. Die Auffassung, welche in den Worten des Herren von Puttkamer Ausdruck fand: ‚Hinter jedem Strike lauert die Hydra der Revolution‘, spiegelt sich auch in der Rechtsprechung wider. Viele Juristen können sich noch immer nicht an den Gedanken gewöhnen, dass das Recht zu striken, gesetzlich garantirt ist, pflegen sie doch vor dem bloßen Worte ‚Strike‘ allemal drei Kreuze zu schlagen.
Während der § 152 im Wege der Auslegung immer mehr eingeschränkt wird, erfährt die Strafvorschrift des § 153 eine ungeahnte Ausweitung. Weniger Bewegungsfreiheit für die Koalitionen und mehr Straffälle – das ist das Ergebnis der Rechtsprechung. Reicht der § 153 der Gewerbeordnung nicht aus, so wird die ‚Lücke‘ durch den § 253 des Strafgesetzbuchs, den Erpressungsparagraphen, ausgefüllt; versagt dieser Paragraph, so steht der Paragraph 153 der Gewerbeordnung wieder in Hilfsbereitschaft, und neuerdings kommen sie beide in ‚idealer Konkurrenz‘ zur Anwendung. Nach der Rechtsprechung des Reichsgerichtes droht die Bestrafung wegen Erpressung den koalirten Arbeitern sowohl bei den Unterhandlungen mit den Unternehmern über Lohn- und Arbeitsbedingungen, als auch bei der Werbung von Mitgliedern für die Organisationen.“
Selbst die einfachste Beschimpfung des Streikbrechers, die vorsichtigste Warnung und Beratschlagung („Na, du wirst ja sehen!“, besonders verpönt der bloße Ruf „Streikbrecher!“) werden – so Hugo Haase – vom Reichsgericht mit der Begründung „auf die Form der Drohung kommt nichts an“ unter Erpressung subsumiert, obwohl die Streikenden in keinerlei Bereicherungsabsicht gehandelt haben. So wird das Streikrecht ein „papierenes“, ein Recht „von Polizeignaden“, wenn die Mittel zum Arbeitskampf über jedes Maß durch Gerichtsentscheid eingeschränkt werden: „Ist die Arbeitseinstellung zur Erlangung günstiger Lohn- und Arbeitsbedingungen gestattet, so muss auch ihre Ankündigung zu diesem Zwecke erlaubt sein.“
Isidor Ingwer variiert auch folgendes Haase-Zitat 1909 für die österreichischen Verhältnisse: „So werden die Arbeiter in allen solchen Fällen entweder mit der Rute des § 153 der Gewerbeordnung [entspricht § 3 öst. Koalitionsgesetz] gepeitscht oder mit den Skorpionen des § 253 des Strafgesetzbuches [entspricht § 98 des öst. StGB 1852] oder in ‚idealer Konkurrenz‘ mit beiden traktiert. (…) Manche ehrenwerte Arbeiter, die im Lohnkampf mit dem Unternehmer verhandeln, mancher ehrliche Arbeiter, der durch Paktieren mit den streitenden Teilen einen drohenden Lohnkampf verhindern will, manche für ihre Organisation werbenden Arbeiter werden auf die Anklagebank gebracht und – wenigstens in den Straflisten – von Rechtswegen als Erpresser gebrandmarkt werden. Aber in den Augen ihrer Klassengenossen und darüber hinaus bis in weite bürgerliche Kreise, soweit sie nicht durch die Scharfmacherpolitik vergiftet sind, wird ihnen dieses Brandmal der Erpressung nichts von ihrer Achtung und Ehre rauben.“13
Vereins- und Versammlungsrecht gegen Streikende
Leo Verkauf und Isidor Ingwer beschreiben, wie das Vereins- und Versammlungsrecht repressiv gegen Streikende angewendet wird. Nach § 6 Vereinsgesetz 1867 werden gewerkschaftliche Fachvereine laufend aufgelöst: „Wenn der Verein nach seinem Zwecke oder nach seiner Einrichtung gesetz- oder rechtswidrig oder staatsgefährlich ist, kann die Landesstelle dessen Bildung untersagen.“
Streikversammlungen können sowohl nach Vereins- als auch Versammlungsrecht verboten bzw. aufgelöst werden. Nach § 21 Vereinsgesetz sind Vereinsversammlungen vom anwesenden Regierungskommissar zu schließen, „wenn sich in der Versammlung gesetzwidrige Vorgänge ereignen, wenn Gegenstände in Verhandlung genommen werden, welche außerhalb des statutenmäßigen Wirkungskreises des Vereines liegen, oder wenn die Versammlung einen, die öffentliche Ordnung bedrohenden Charakter annimmt“.
Die Geschichte der Arbeitervereine und Fachvereine ist geprägt von Auflösungen wegen Überschreitung des statutarischen Wirkungskreises nach § 24. Gewerkschaftliche Vereine werden liquidiert, weil sie (angeblich) statutenwidrig Streikunterstützungen ausgezahlt haben: Jeder Verein kann aufgelöst werden, „wenn er seinen statutenmäßigen Wirkungskreis überschreitet oder überhaupt den Bedingungen seines rechtlichen Bestandes nicht mehr entspricht“.
Soweit die Arbeiterorganisationen als „politische Vereine“ eingestuft waren, unterlagen sie noch schärferer behördlicher Kontrolle. Sie mussten nicht nur ihre Mitglieder melden, es war ihnen auch untersagt, „Zweigvereine (Filialen) zu gründen, Verbände unter sich zu bilden, oder sonst mit anderen Vereinen, sei es durch schriftlichen Verkehr, sei es durch Abgeordnete, in Verbindung zu treten“.
Laufend kam in Arbeitskämpfen auch der § 6 des Versammlungsgesetzes zum Tragen: „Versammlungen, deren Zweck den Strafgesetzen zuwiderläuft oder deren Abhaltung die öffentliche Sicherheit oder das öffentliche Wohl gefährdet, sind von der Behörde zu untersagen.“14
Ausnahmezustand, „Prügelpatent“, Abschiebungen
Bei schwer eskalierenden Arbeitskämpfen – so bei einem böhmischen Bergarbeiterstreik 1882 – wurde zusätzlich zu starkem Militäreinsatz auch die förmliche Verhängung des Ausnahmezustandes in den Raum gestellt. Auf Grundlage des Gesetzes vom 5. Mai 1869, „womit auf Grund des Artikel 20 des Staatsgrundgesetzes vom 21. December 1867, RGBl. Nr. 142, die Befugnisse der verantwortlichen Regierungsgewalt zur Verfügung zeitweiliger und örtlicher Ausnahmen von den bestehenden Gesetzen bestimmt werden“, konnten Grundrechte, wie jenes der „Freiheit der Person“, des Hausrechts, des Briefgeheimnisses, des Vereins- und Versammlungsrechts oder der Pressefreiheit suspendiert werden. Faktisch war gerade über die mährisch-böhmischen Streikregionen in den 1890er Jahren häufig eine Art Ausnahmezustandsregime verhängt.
Gegen streikende Arbeiter sehen Leo Verkauf und Isidor Ingwer das ganze Arsenal willkürlich administrativer und polizeilicher Maßnahmen in Stellung gebracht, so neben einem Erlass zur streikbrechenden Militärassistenz, also dem Einsatz von fachkundigen Soldaten, vor allem das so genannte „Prügelpatent“, die kaiserliche Verordnung vom 20. April 1854, „wodurch eine Vorschrift für die Vollstreckung der Verfügungen und Erkenntnisse der landesfürstlichen politischen und polizeilichen Behörden erlassen wird“ (RGBl. Nr. 96/1854).
Auf dieser Grundlage wurden Streikposten etwa wegen „Passagenverstellens“ von Wachorganen im kurzen Weg arretiert. Ingwer vergleicht diese Vorgangsweise mit dem „Groben-Unfug-Paragraphen“ im deutschen Strafrecht.
Ganz abgesehen davon, dass – so Ingwer – ein Streik ohne Streikposten wie ein Krieg ohne Wachtposten ist, gehen sowohl Verkauf als auch Ingwer davon aus, dass ein derartig freihändiges, täglich geübtes polizeiliches Verbotsrecht nicht einmal durch das „Prügelpatent“ gedeckt ist.
Sowohl Leo Verkauf als auch Isidor Ingwer stützen sich dabei auf eine Studie des Wiener Verwaltungsrechtsdozenten Carl Brockhausen, der 1896 in „Grünhuts Zeitschrift für das Privat- und Öffentliche Recht der Gegenwart“ dargelegt hatte, dass selbst nach dem „Prügelpatent“ den Polizeibehörden kein Verbotsrecht an sich zusteht, dass jeder polizeiliche Maßnahmenakt vielmehr eine spezifische gesetzliche Regelung voraussetzt.
Brockhausen hat überzeugend dargetan, dass auf Grund des § 7 des „Prügelpatents“ den politischen und polizeilichen Behörden ein Verbotsrecht überhaupt nicht zukommt. Brockhausen zitiert den § 7: „Ist im Wirkungskreise der politischen oder polizeilichen Behörden ein Verbot erlassen worden, solches mag sich auf eine einzelne Handlung oder auf eine bestimmte Gattung von Handlungen beziehen, so haben die betreffenden politischen oder polizeilichen Behörden zur Durchsetzung dieser Vorschrift unmittelbar gegen diejenigen, welche das Verbot zu übertreten suchen oder in dessen Nichtbeachtung verharren, die zum Zwecke führenden Vollzugs- und Executionsmittel in Anwendung zu bringen, und die für den Fall der Übertretung oder Widersetzlichkeit bestimmte oder in Ermanglung einer ausdrücklichen besonderen Strafsanction die im § 11 festgesetzte Strafe zu verhängen.“
Auch wenn viele Juristen annehmen, dass das „Prügelpatent“ durch die Staatsgrundgesetze aufgehoben sei, prägte es weiter bis 1918 eine „vormärzliche“ Polizeipraxis, die glaubte, ohne diese Maßnahmenermächtigung gar nicht auskommen zu können. Nach Brockhausen hat dieses polizeiliche Verbotsrecht aber gar „niemals zu Recht“ bestanden: „Es ist nicht gerechtfertigt, wenn aus der kaiserlichen Verordnung vom 20. April 1854 das Recht für die politischen und polizeilichen Behörden abgeleitet wird, Verbote zu erlassen, zu welchem sie nicht bereits durch anderweitige gesetzliche Basis legitimirt sind.“15
Isidor Ingwer vertrat viele politisch missliebige Gesellen, die als Streikaktivisten kurzerhand als „ausweis- und bestimmungslose Individuen“ abgeschoben wurden. Bis zur Aufhebung durch das Koalitionsgesetz 1870 konnten „Streikrädelsführer“ nach § 481 StGB entfernt werden. Ab 1871 wurden viele Arbeitskämpfe eingedämmt, indem die Behörden die besten Vertrauensleute der Streikenden nach den Bestimmungen von „Vagabundengesetzen“ abschoben oder dauernd auswiesen („abschafften“), so nach dem Gesetz vom 27. Juli 1871, RGBl. 88, „in Betreff Regelung der polizeilichen Abschaffung und des Schubwesens“ gegen „Landstreicher und sonstige arbeitsscheue Personen“. Mit dem „Vagabundengesetz“ vom 24. Mai 1885, RGBl. Nr. 89, „womit strafrechtliche Bestimmungen in Betreff der Zulässigkeit der Anhaltung in Zwangsoder Besserungsanstalten getroffen werden“, erhielten die Verwaltungsbehörden eine weitere Waffe im Kampf gegen die Arbeiterbewegung.
„Kontraktbruch“, Arbeitsbuch
Ein Blick in die jährliche amtliche Streikstatistik konnte verdeutlichen, dass Abstrafungen nach der Kontraktbruchregelung des § 85 der 1885 novellierten Gewerbeordnung neben Verurteilungen nach § 3 Koalitionsgesetz zu den häufigsten Maßregelungen zählten. So heißt es in der die Verurteilungen kaum vollständig erfassenden Zusammenstellung über „die Arbeitseinstellungen und Aussperrungen in Österreich während des Jahres 1911“: „Als kontraktbrüchig im Sinne des § 85 Gewerbeordnung wurden 79 Streikende verurteilt.“
Mit Recht zählte Isidor Ingwer 1912 die gewerbebehördliche Strafbarkeit des Kontraktbruchs, also vor allem jene des Austritts aus dem Arbeitsverhältnis aus Anlass eines Streiks ohne Einhaltung der Kündigungsfrist, neben dem Arbeitsbuch zu einer der zentralen „Fesseln des Koalitionsrechtes“. Ingwer unterstützte den von den sozialdemokratischen Reichsratsabgeordneten und Gewerkschaftlern Johann Smitka und Anton Schrammel 1909/10 eingebrachten sowie von Julius Ofner unterstützten Antrag auf Abschaffung dieser „asymmetrisch“ auf die Arbeiterschaft begrenzten Strafbarkeit. Nach rechtsstaatlichen Kriterien soll es keinen Weg vom allein zivilrechtlich relevanten Vertragsbruch zum Strafrecht geben.
Smitka, Schrammel und Genossen beantragten, dass an die Stelle des derzeitigen § 85 Gewerbeordnung 1885, RGBl. 22, folgende Bestimmung tritt: „§ 85 Vorzeitiger Austritt. Wenn ein Hilfsarbeiter den Gewerbeinhaber ohne gesetzlich zulässigen Grund (§ 82 a und 101) vorzeitig verlässt, so ist der Gewerbeinhaber berechtigt, den Hilfsarbeiter zur Rückkehr in die Arbeit für die fehlende Zeit zu verhalten und Ersatz des erlittenen Schadens zu begehren. Der Betrag des vom Gewerbeinhaber anzusprechenden Schadens darf nie höher sein als der Lohn und die sonst vereinbarten Genüsse, der dem Arbeiter für die ganze Kündigungsfrist, beziehungsweise für den noch übrigen Teil der Kündigungsfrist auszuzahlen gewesen wäre.“
Den Antragstellern zufolge war es eine Anomalie an sich, dass der vertragsbrüchige Arbeiter einer Übertretung der Gewerbeordnung schuldig sein kann, weil damit „die Einhaltung eines privatrechtlichen Kontraktes unter öffentlichrechtliche Strafsanktion“ gestellt ist, und vor allem auch, „weil eine analoge Bestimmung für den Kontraktbruch des Arbeitgebers fehlt“. Die weitere zivilrechtliche Bestimmung, „die Schadenersatzforderungen des Unternehmers auf den Betrag des 14tägigen Lohnes des Arbeiters zu beschränken, ist eine Forderung der Billigkeit, da auch der Arbeiter im Falle des Kontraktbruches des Unternehmers nicht mehr fordern kann“.
Die Schadenersatzansprüche gegen Streikende und deren Verbände waren nämlich durchaus nicht harmlos, wie Ingwer 1912 beobachtet: „Viele von Ihnen werden sich denken: Schließlich und endlich kann es uns gleichgültig sein, wenn Arbeiter zur Zahlung von ein paar tausend Kronen verurteilt werden, sie haben nichts und man wird bei ihnen auch nichts finden. Das ist nicht wahr. Es sind mir gerade in meiner Praxis Fälle vorgekommen, die sich besonders schwierig gestaltet haben. Während eines Streiks der Brauereiarbeiter hat sich folgender Fall ereignet: Es hat sich da um Brauer gehandelt, die außerhalb Wiens arbeiten. Nun ist Ihnen bekannt, dass auf dem Lande kleine Grundbesitzer, kleine Häusler, die als Landwirte oder als Hausbesitzer nicht so viel verdienen, als sie zu ihrem Unterhalt brauchen, genötigt sind, in Fabriken zu arbeiten. Gerade bei diesem Streik der Brauereiarbeiter ist es vorgekommen, dass unter diesen Arbeitern viele kleine Besitzer waren, darunter Leute, die ursprünglich gar nicht der Organisation angehört haben und die nur durch die mächtige Streikbewegung mitgerissen wurden, sich freiwillig dem Streik angeschlossen und so während des Streiks der Organisation große Dienste geleistet haben. Diese Leute wurden nun auf Schadenersatz geklagt, weil die Maische dadurch, dass die Arbeiter die Arbeit eingestellt haben, verdorben wurde, und so ein Schade von Tausenden von Kronen erwachsen ist. Diese Leute wurden auch verurteilt. Nun waren sie der Gefahr ausgesetzt, dass sie ihr kleines Besitztum verlieren. (…)
Das ist aber nicht nur bei dem Streik der Brauereiarbeiter vorgekommen. Erst im vergangenen Jahre war in Böhmen ein Streik der Textilarbeiter, bei dem die Unternehmer ebenfalls auf Ersatz eines Schadens, den sie mit vielen Tausenden von Kronen bezifferten, geklagt haben. Es wurde eine Unmasse von Arbeitern geklagt und es wurde nach dem berühmten Muster der Versuch gemacht, die Organisation zu packen; es wurde daher auch die Union der Textilarbeiter als Mitschuldige belangt, weil sie den Kontraktbruch angeblich veranlasst haben soll.“ In diesem Fall vergeblich!16
Unter einem verlangte Ingwer die Abschaffung der Arbeitsbücher, der „Steckbriefe“ gegen die Sklaven des Kapitalismus, der „Fußkette der polizeilicher Legitimation“. Das Arbeitsbuch degradiert den Proleten gerade auch im Streikzusammenhang „zu einem Paria“, da er in den Arbeitsbüchern nicht nur mit geheimen Zeichen als Sozialist markiert wird, sondern auch als Streikteilnehmer. Arbeiter, die seit 1890 für die Bewegung des 1. Mai agitiert haben, werden nicht nur über „schwarze Listen“, sondern auch dadurch gebrandmarkt, dass das Entlassungsdatum in Buchstabenform „erster Mai“ in das Arbeitsbuch eingetragen wird. Johann Smitka, Anton Schrammel und Genossen beantragten deshalb 1909 im Reichsrat auch die Beseitigung der in der Gewerbeordnung vorgesehenen Arbeitsbücher: „Der vorliegende Antrag bezweckt die Beseitigung eines jahrhundertealten Schandflecks des österreichischen Arbeiterrechts, die Beseitigung des Legitimationszwanges für alle Kategorien von gewerblichen Arbeitern, die Beseitigung des Arbeitsbuches in allen seinen Formen. (…) Für den Arbeiter aber ist das Arbeitsbuch eine wahre Kette, die er in seinem ohnehin so dornenvollen Leben mit sich fortschleppen muss. (…) Das Arbeitsbuch ist daher das Merkmal der Sklaverei, der Hörigkeit, der gelbe Fleck, der all denen angeheftet wird, die als Ausgestoßene, als Minderwertige, als Kontrollbedürftige angesehen werden. (…) Das Arbeitsbuch belastet aber auch die Gerichte mit einer Unzahl von Prozessen der unleidlichsten Art. Kein Gebiet des Arbeitsrechtes ist so kontrovers wie gerade dieses. Da muss entschieden werden, ob der Arbeitgeber berechtigt ist, das Arbeitsbuch zurückzubehalten, wenn das Arbeitsverhältnis nicht ordnungsmäßig gelöst wurde, wie lange er es zurückbehalten darf, ob er es bei sich behalten oder ob er es bei der Gemeinde, bei der Polizei oder bei Gericht deponieren darf. Es muss entschieden werden, ob eine gemachte Eintragung zulässig, aber überflüssig, ob sie unzulässig, ob sie schlechtweg zulässig ist. (…) Ein Gewerbegericht erklärt die Eintragung ‚Wegen Streik entlassen‘ für unzulässig, das andere für zulässig.“ Arbeitsbuch und Kontraktbruchregelung wurden erst im Jänner 1919 in den ersten Tagen der Republik beseitigt.17
„Erpressung“: Streik und Strafrecht
Sowohl Isidor Ingwer als auch Leo Verkauf sahen den § 2 des Koalitions-gesetzes, der Streikvereinbarungen jede rechtliche Wirkung absprach, als ausdehnend angewendeten zivilrechtlichen Schutz des Streikbrechers an. Auch das mit der Vereinsauflösungsdrohung bewehrte, dem Arbeitskampf hinderliche Verbot, wonach Gewerkschaften keine Streikgelder sammeln durften, wurde bürgerlich rechtlich begründet. Da solche Solidaritätsunterstützungen auch rechtswidrig aus dem Arbeitsvertrag ausgetretenen Arbeitern zukommen konnten, wurden solche Ansprüche nach den §§ 878 und 879 ABGB als unmöglich oder unerlaubt qualifiziert, zumal sie gegen gesetzliche Verbote und gegen die guten Sitten verstoßen könnten, wie dies Leo Verkauf anhand von Gerichtsentscheidungen dokumentiert. Im „Volkstümlichen Handbuch des Österreichischen Rechtes“ druckten Isidor Ingwer und Isidor Rosner 1908 eine Musterklage an das Reichsgericht wegen Auflösung eines Fachvereins der Schneider ab, weil dieser angeblich statutenwidrig Streikende unterstützt hat.
Ein verschärfter strafrechtlicher Schutz der „Arbeitswilligen“ stand in den letzten Jahren vor dem Weltkrieg auf der Daueragenda der Industriellenbünde. Ab 1907 verlangen Unternehmerverbände ein „neues“ Koalitions- und Streikrecht, wie dies zwei Jahrzehnte später in vorfaschistischen Jahren 1930 mit dem „Bundesgesetz zum Schutz der Arbeits- und Versammlungsfreiheit (‚Antiterrorgesetz‘)“, also mit dem Schutz der so genannten „negativen Koalitionsfreiheit“ gelingen sollte.18 (Vgl. Anhang 5 und 6)
Die schon 1889 von Justizminister Friedrich Graf Schönborn geplante Strafgesetznovelle zur Verschlechterung und Kriminalisierung des Koalitions- und Streikrechts hat Leo Verkauf 1894 zeitaktuell kommentiert. Vor dem Hintergrund verschärfter Streikkämpfe (im Bergbau) verlangte der streng konservative Ackerbauminister Julius Graf Falkenhayn im Mai 1890 eine Verschärfung des Koalitionsgesetzes von 1870, um den „Umtrieben fremder und einheimischer Agitatoren“ entgegentreten zu können: „Diese Agitatoren üben selbst auf die friedlich gesinnten Arbeiter eine solche Vergewaltigung aus, dass letztere selbst bei Vorhandensein militärischen Schutzes oft nicht den Muth haben, die Arbeit wieder aufzunehmen.“
Die jüngeren Entwürfe einer Strafrechtsreform von 1906 aufwärts hat Isidor Ingwer gemeinsam mit Isidor Rosner in der Linie der wilhelminischen „Zuchthausvorlage“ von 1898/99 und in der Linie des rigiden Streikerlasses des preußischen Innenministers Robert Puttkamer aus dem Jahr 1886 gesehen, weshalb Ingwer mit Blick auf die Strafrechtsreformer Heinrich Lammasch und Hugo Hoegel auch von „unseren Puttkamers“ spricht: Diese Entwürfe würden Solidaritätskämpfe für entlassene Vertrauensleute, Abwehrstreiks, Streiks um die Aufrechterhaltung der Organisation bei gleichzeitiger Erleichterung von Aussperrungen erschweren.