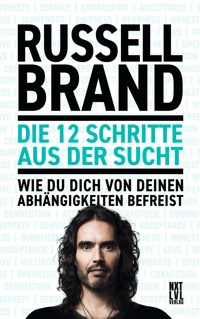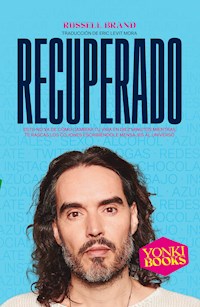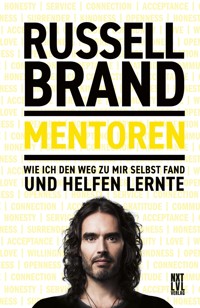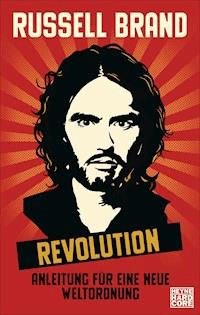
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Letzte Chance auf Weltrettung!
Unser gegenwärtiges System dient dazu, den Reichtum einer kleinen Elite aufzublähen, während der Rest der Menschheit kleingehalten und unser Planet zerstört wird. Jeder weiß das, aber keiner tut etwas dagegen. Der ganze Kyoto-Kram – reduzieren wir den CO 2-Ausstoß um den Wert x bis zum Jahr y – ist jedenfalls nichts weiter als gequirlte Scheiße, meint Russell Brand. Eine bloße Geste, eine Alibiveranstaltung. In etwa so wie der Salat, den sie bei McDonald’s anbieten. Um die Erde wirklich zu retten, muss das System grundlegend verändert werden. Wir müssen radikal umdenken, ja, wir brauchen eine Revolution. Und zwar jetzt gleich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 563
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Russell Brand
Revolution
Anleitung für eine neue Weltordnung
Aus dem Englischen von
Kristof Hahn und Anke Kreutzer
Wilhelm Heyne Verlag
München
Das Buch
Unser gegenwärtiges System dient dazu, den Reichtum einer kleinen Elite aufzublähen, während der Rest der Menschheit klein gehalten und unser Planet zerstört wird. Jeder weiß das, aber keiner tut etwas dagegen. Der ganze Kyoto-Kram – reduzieren wir den CO2-Ausstoß um den Wert x bis zum Jahr y – ist jedenfalls nichts weiter als gequirlte Scheiße, meint Russell Brand. Eine bloße Geste, eine Alibiveranstaltung. In etwa so wie der Salat, den sie bei McDonald’s anbieten. Um die Erde wirklich zu retten, muss das System grundlegend verändert werden. Wir müssen radikal umdenken, ja, wir brauchen eine Revolution. Und zwar jetzt!
Der Autor
Russell Brand ist Schauspieler, Radiomoderator, Autor, Sänger, Kolumnist, Ex-Junkie, Veganer, überzeugter Nichtwähler und einer der erfolgreichsten Stand-up Comedians Großbritanniens. Seine Autobiografie My Booky Wook stand auf Platz 1 der Sunday Times-Bestsellerliste und wurde mit dem British Book Award ausgezeichnet. Zuletzt tourte er mit seiner Show Messiah Complex durch die Welt.
Die Originalausgabe Revolutionerschien 2014 bei Century, London
Der Autor dankt für Zitate aus:
George Orwell, Mein Katalonien
aus dem Englischen von Wolfgang Rieger
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 1975, 2003
Diogenes Verlag AG, Zürich
Tomgram: Noam Chomsky, America’s Real Foreign Policy
Copyright © 2014 by Noam Chomsky
Subterranean Homesick Blues by Bob Dylan Copyright © 1965 by Warner Bros. Inc.; renewed 1993 by Special Rider Music
Joseph Campbell and the Power of Myth with Bill Moyers; courtesy of Apostrophe S Productions, Inc.
Copyright © 2014 by Russell Brand
Copyright © 2015 der deutschsprachigen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Redaktion: Stephanie Schlatt, Eberhard Kreutzer
Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, München,
unter Verwendung eines Fotos von © Dean Chalkley
Satz: EDV-Fotosatz Huber/Verlagsservice G. Pfeifer, Germering
ISBN 978-3-641-16275-7V002
www.heyne-hardcore.de
Für den göttlichen,
boshaften Funken in euch.
Inhalt
Prolog: You say you want a Revolution
1. Die Heldenfahrt
2. Gelassenheit jetzt
3. Klatschen mit einer Hand
4. Oben rechts in die Ecke
5. Alle Mann an Bord?
6. Kleine Probleme im unendlichen Raum
7. Ein paar faule Äpfel
8. Ich bin Anarchist, Baby
9. Ärger in der Partyzone
10. Ich bin ein Monarch
11. Ein Paar Glocken und ein Doppelspalt
12. Wie innen so außen
13. Spiderman auf Leitung eins
14. Geld regiert die Welt
15. Spektakulär
16. Wie im Himmel, also auch auf Erden
17. War! What is it good for? Für den Kapitalismus, na ist doch klar.
18. Ukip – Pennt weiter, wenn ihr wollt, wir sind wach
19. Piketty, Schnicketty, Schnacketty, Schnuck
20. Unter Marines
21. Check dein Handy
22. »Multizid«
23. Co-Op!
24. Klinkt mich ein
25. Das Rasiermesser der Nation
26. Bekehrung
27. Es mejor morir de pie … Besser aufrecht sterben
28. Stick Your Blue Flag
29. Granma, wir lieben dich
30. Manifest Destiny
31. Be the Change
32. Hilf mir, dir zu helfen
33. Lohnt es sich, dafür zur Wahl zu gehen?
Epilog: For the Benefit of the Tape
Danksagung
Register
Überall, wo eine Anmerkung am Kapitelende erscheint, bin ich verpflichtet, Dinge klarzustellen, damit das Buch veröffentlicht werden kann. Lektor Ben gibt Hinweise, die ich anzweifle, dann macht Anwalt Roger, der das Ganze absegnen muss, Vorschläge, um das Buch veröffentlichbar zu machen.
Prolog
You say you want a revolution
Bei politischen Interviews ist Jeremy Paxman in England die Nummer eins. Er ist bissig, aber nicht wie ein kampflustig sabbernder Pitbull, sondern eher wie ein träges Krokodil, von dem nur die Augen aus dem Wasser ragen, während es in aller Ruhe darauf wartet, dass man einen Fehler macht, nur um dann blitzschnell zuzuschnappen und einen zu erledigen. Er verspeist Innenminister zum Frühstück, scheißt Finanzminister aus und wischt sich den Arsch mit Premierministern ab. In fünf Minuten wird er mich für Newsnight interviewen, das bekannteste Politmagazin im britischen Fernsehen.
Und genau deswegen knie ich jetzt auf dem Boden der Toilette in der Lobby des Landmark Hotel. Ich bete.
»Herr, mach mich zu einem Werkzeug Deines Friedens.« Es ist die erste Zeile des Friedensgebets des heiligen Franziskus, bekannt geworden durch Mutter Teresa, in den Dreck gezogen von Margaret Thatcher und geschätzt von all jenen, die wie ich durchs Raster gefallen sind und sich irgendwann mit Crack im Gepäck wieder hochgearbeitet haben.
Ich will nichts weiter sein als ein Werkzeug des Friedens. Der Frieden existiert bereits. Ich muss ihn, Gott sei Dank, nicht erst schaffen. Ich muss mich nur öffnen, und der Frieden wird kommen. Der Frieden ist schon da. Mutter Teresa, so könnte man argumentieren, verkörperte die Prinzipien, die in diesem Gebet behandelt werden – durch ihr Dienen hat sie die niederen egoistischen Triebe überwunden, die für unser Überleben ebenso notwendig sind wie für unser Ego, und wurde so zum Werkzeug eines höheren Zweckes beziehungsweise unseres Gottes. Bei Margaret Thatcher ist der Fall weniger klar. Welchem Gott sie diente, als sie im Windschatten von Ronnie Reagans Schmalztolle die systematische Zerstörung der Werte unseres Landes betrieb, ist bis heute ein Rätsel. Doch als sie nach ihrem Wahlsieg vor Downing Street 10 stand und der Regen wie ein düsteres Vorzeichen auf sie herunterprasselte, sagte Maggie ausgerechnet das Gebet des heiligen Franziskus auf.
Herr, mach mich zu einem Werkzeug Deines Friedens,
auf dass ich Liebe bringe, wo man hasst,
dass ich verzeihe, wo man beleidigt,
dass ich, wo Streit herrscht, Harmonie bringe,
dass ich, wo Irrtum herrscht, die Wahrheit bringe,
dass ich, wo Zweifel droht, den Glauben bringe,
dass ich, wo Verzweiflung quält, Hoffnung wecke,
dass ich ein Licht entzünde, wo Finsternis regiert.
und Freude bringe, wo der Kummer wohnt.
Herr, bitt lass mich danach trachten,
nicht dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste,
nicht dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe,
nicht dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe.
Denn nur wer sich hingibt, der empfängt,
wer sich selbst vergisst, der findet,
wer verzeiht, dem wird verziehen,
und wer stirbt, erwacht zum ewigen Leben.
Amen
Soweit ich weiß, hat sie das Ding nicht in voller Länge heruntergebetet, aber man braucht nicht Jeremy Paxman zu sein, um festzustellen, dass Margaret Thatcher es mit dem Inhalt dieses Gebets nicht allzu genau genommen hat.
Weder ist sie den Bergarbeitern in Nordengland mit allzu viel Liebe begegnet, noch hat sie den argentinischen Matrosen auf der Belgrano ein Übermaß an Vergebung angedeihen lassen. Und bei den Unruhen um die Einführung der Kopfsteuer herrschte zwischen Demonstranten und Polizei herzlich wenig Harmonie. Sie verstehen ungefähr, was ich meine. Anscheinend ist das Gebet also nicht unfehlbar. Aus dem falschen Mund kann es zu einem Mantra des egoistischen Nihilismus verkommen. Daran trägt das Gebet selbst aber keine Schuld. Für mich ist es eine Formel, mit der ich meinen Geist in seinen natürlichen Zustand der Einheit und Verbundenheit mit allem versetze. Genau wie die kreolischen Beschwörungen, die vedischen Gesänge, das yogische Gemurmel und sogar die Eminem-Textfragmente, die ich bei meinen Toilettenbesuchen vor Beginn des Interviews vor mich hinfasle, dient auch dieses Gebet nur dazu, eine Verbindung herzustellen, Transzendenz zu erreichen und mich von meinem Selbst zu lösen. Und genau das habe ich mein ganzes Leben versucht: mein Selbst abzustreifen, meinen Verstand auszuschalten, Grays, die Stadt, in der ich aufgewachsen bin, hinter mir zu lassen, das Gefühl loszuwerden, dass ich nicht gut genug bin, dass ich allein bin, dass ich niemals glücklich sein oder Liebe erfahren werde. Ich habe es auf vielerlei Arten probiert, und das Resultat war immer das gleiche.
Wie ein Wilder aus dem Bilderbuch, der sich vor dem Großen Weißen Herrn in den Staub wirft, habe ich ganze Heerscharen schimmernder Götzen angebetet. Als ich ein kleiner Junge war, waren Fernsehen und Schokolade meine Gottheiten. Ehrfürchtig und gebannt kauerte ich auf Knien vor der Flimmerkiste, und meine heilige Kommunion war ein Penguin-Schokoriegel, den ich begierig, doch einem strengen Ritual folgend (zuerst die äußere Schokoladenschicht abknabbern, dann die Schokoladencremefüllung in der Mitte mit den Zähnen abschaben und zum Schluss der Keks) verschlang. Als Teenager waren es dann Pornos, und das Badezimmer wurde zu meiner Zelle und ich zu einem stummen Trappistenmönch, der sich dort einschloss und unter erstickten Klagelauten geißelte. Im Namen von Drogen und Alkohol unternahm ich Pilgerreisen zu einer endlosen Zahl von Brücken und dunklen Ecken und gab mein letztes Scherflein – ganz wie mein Gott es verlangte. Dann kam irgendwann der Ruhm, und ich studierte wie Augustinus und reiste in der Welt umher wie ein Jesuit. Ich war ein fanatischer Gefolgsmann so gut wie jedes Propheten unter der Sonne, und durch keinen habe ich je etwas anderes erfahren als Schmerz und Enttäuschung. Skepsis und Misstrauen hegte ich aber immer nur in Bezug auf mögliche Lösungen und Auswege aus meinem Dilemma.
Zu den Zeiten, als ich mir billigen Wodka flaschenweise hinter die Binde kippte, schaute ich niemals auf das Etikett. Mit den Tütchen und Rocks, die ich bei irgendwelchen streunenden Gestalten im öden Niemandsland von Hackney kaufte, veranstaltete ich keine Lackmustests. Als ich Zuflucht suchte auf Ruhestätten im Halbdunkel, versunken in der Umarmung eines fremden Menschen wie in einem Grab, da habe ich nicht nach Namen gefragt.
Aber als es dann wirklich dämmerte, als das Licht sich Bahn brach, als ich spürte, wie alles zu verschmelzen begann, da hatte ich keinen Glauben mehr, sondern nur noch Fragen. Woher weiß ich, dass das hier wirklich real ist? Was ist, wenn es nicht hinhaut? Wie kann ich nach all dem, was passiert ist, Vertrauen entwickeln und einfach loslassen? Ich habe immer noch Fragen, aber Fragen hat auch Jeremy Paxman, der mir jetzt auf dem Stuhl des Großinquisitors in dieser zum Fernsehstudio umfunktionierten Suite des Landmark Hotel gegenübersitzt.
»Nun denn …«, sagt er mit einer Stimme, die vor Sarkasmus nur so trieft, »wie sollen wir, angesichts der Tatsache, dass die Leute Ihrer Meinung nach nicht zur Wahl gehen sollten, die Veränderung der Welt bewerkstelligen?«
»Durch eine Revolution«, sage ich.
»Sie wollen eine Revolution?«
»Jawoll.«
»Und Sie glauben, dass es eine Revolution geben wird?« Die Frage kommt angeschossen wie eine Billardkugel.
»Jeremy, daran habe ich nicht den geringsten Zweifel«, antworte ich.
Jeremy ist nicht von gestern. Seine Show läuft seit zwanzig Jahren, und er hat schon so gut wie jedem halbseidenen Schlaumeier gegenübergesessen, der irgendeine Mission hatte und die Dreistigkeit, sich zu ihm ins Studio zu wagen. Er mustert mich von oben bis unten – die Frisur, den Bart und das lächerliche Halstuch.
»Und wie, wenn ich fragen darf, wird diese Revolution zustande kommen?«
Nun, das ist eine sehr gute Frage. Eine Frage, die auch ein wesentlich weniger gewiefter Journalist als Jeremy Paxman einem an den Kopf knallen würde. Aber es ist nun mal Paxman, und er stellt diese Frage stellvertretend für all die anderen: meinen Schuldirektor, den Polizeibeamten, der mich verhaftet hat, die Arbeitskollegen, Freunde, Verwandten, Sympathisanten und Zuschauer. Sie alle stellen mir die Frage: »Wie soll diese Revolution funktionieren? Wie können wir die Welt verändern? Wie können wir uns selbst verändern? Können wir es wirklich schaffen, das Machtgefüge zu durchbrechen und die Verkommenheit zu überwinden, nicht nur innerhalb der Gesellschaft, sondern auch in uns selbst?«
Nun, für mich steht die Antwort fest. Sie lautet Ja. Und was die komplizierteren Aspekte der Frage betrifft, kann ich nur sagen: Ich bin vielleicht nicht Margaret Thatcher, und Mutter Teresa schon gar nicht (wenn man davon absieht, dass wir in Sachen Kondome einer Meinung sind), aber ich habe mir einige Gedanken zum Thema gemacht, und deswegen setzen Sie sich jetzt bitte hin und schnallen Sie sich an. Es geht los.
Kapitel 1
Die Heldenfahrt
Schon der Name ist ein einziger Schwindel – »Lakeside«. Die Engländer nennen es Shopping Centre, die Amerikaner Mall. Was sich, wenn man das »ô« ein bisschen dehnt, wie das englische Wort »maul« anhört: Holzhammer. Und genau das sind diese Hochburgen globaler Marken – keine Stätten der zärtlichen Liebe und gegenseitigen Liebkosung, sondern Orte, an denen mit dem Holzhammer auf einen eingeprügelt wird.
Nachdem die schon im Verenden begriffenen Lokalzeitungen ordentlich die Werbetrommel gerührt und einen Propagandafeldzug veranstaltet hatten, um den Leuten den Mund wässrig zu machen, war Lakeside irgendwann endlich in den stillgelegten Kalksteinbrüchen von Grays gelandet wie ein UFO.
Eine prachtvolle Kathedrale aus Stahl und Glas, die, wie der Name schon sagt, am Ufer eines Sees gelegen war. Bloß dass der See bis dahin gar nicht existiert hatte. Er musste erst angelegt werden. Der Name Lakeside, dieser stumpfsinnige Versuch der Verquickung des Alltäglichen mit der Natur, machte die Anlage eines Sees zwingend notwendig, weil er sonst keinen Sinn ergeben hätte.
Doch für mich als Teenager war Lakeside kein Anlass für semantische Pedanterie, sondern ein Quell unaussprechlicher Vorfreude und Begeisterung. Ich konnte es gar nicht erwarten, bis Lakeside endlich landen und mein Leben mit Inhalt gefüllt werden würde, so wie das Baggerloch mit Wasser. Lakeside machte sich in meinem Denken breit, genauso wie das Gebäude sich in der öden Landschaft breitgemacht hatte. Ich konnte nicht erwarten, dass es endlich aufmachte. Die Tatsache, dass ich kein Geld hatte, tat meiner Begeisterung über den bevorstehenden Konsumrausch keinen Abbruch. Lakeside war die Antwort, so viel stand fest. Doch was war noch mal die Frage gewesen?
Welche Leere muss im Leben eines dreizehnjährigen Jungen herrschen, dass es ein Einkaufszentrum braucht, um sie zu füllen? Wie kam es, dass ein junger Typ in den Achtzigern in Essex so geil aufs Shoppen war wie die Mädels aus Sex and the City?
Der Kulturanthropologe Joseph Campbell, auf den ich mich in diesem Buch noch öfter beziehen werde, sagte einmal: »Wenn man herausfinden will, worauf eine Gesellschaft den meisten Wert legt, muss man sich nicht lange mit Kunst oder Literatur beschäftigen, sondern einfach nur einen Blick auf die größten Gebäude werfen.« In den Gesellschaften des Mittelalters waren dies Kirchen und Paläste, und nach Campbells Methode erschließt sich daraus, dass es sich um feudale Kulturen handelte, die ihre Anführer verehrten und Gott anbeteten. In den modernen Städten des Westens sind Banken die höchsten Gebäude – elende Riesentürme, die die Docklands beherrschen – und Shoppingcenter, die in architektonischer Hinsicht ein Abklatsch der Kathedralen sind, die von ihnen abgelöst wurden. Kuppeln und Türme, eine unheimliche, himmlische Stille, Springbrunnen anstelle von Taufbecken und Food Courts statt Kirchenbänken. Würde man die Planer von Lakeside oder irgendeinem beliebigen anderen Shoppingcenter fragen, was sie den Konsumenten, früher auch »Menschen« genannt, denn zu bieten haben, so würden sie antworten, dass »alles unter einem Dach« zu haben ist – wunderbar, sie haben also eine Decke eingezogen und, was noch wichtiger ist, man hat »Auswahl«. Auswahl – das ist das Schlüsselwort. Denn ganz offensichtlich war für den bulimischen Smiths-Fan und Onanisten, der ich damals war, die Aussicht auf eine große Auswahl der Hauptanreiz. Und damit die Vorstellung von Auswahl so reizvoll erscheint, muss eine Situation herrschen, in der man herzlich wenig Wahlmöglichkeiten hat. Was gleichbedeutend ist mit einem Mangel an Selbstbestimmung oder Freiheit.
Ich will daraus nicht ableiten, dass wir zu den Gepflogenheiten des Mittelalters zurückkehren und von Pestbeulen überzogen, die Hände in Lumpen gehüllt, mit fauligen Zähnen auf Rüben herumkauen und vor irgendeinem Baron niederknien sollten, der zu Pferde vorbeifegt. Seit Blackadder im Fernsehen lief, wissen wir schließlich, dass die Geschichte eine einzige Kloake ist.
Woran ich glaube, ist, dass wir gerade erst anfangen zu verstehen, welche ungeahnten Fähigkeiten der Mensch hat. Dass wir wirkliche Freiheit erlangen können, anstatt uns nach einem verlockenden Trugbild auszustrecken, das ewig unerreichbar bleibt. Mehr als nur einen lahmen Kompromiss und nagende Angst.
Es gab Zeiten, da habe ich an das System geglaubt, in das ich hineingeboren wurde: haben wollen, kaufen, konsumieren, Reichtum und Ruhm, Macht und Geld und Sex. All das, was mir von Hochglanzmagazinen oder auf dem Bildschirm präsentiert wurde, stand auf meinem Wunschzettel. Ich wollte eine breite Auswahl, Freiheit, Macht, Sex und Drogen, und ich habe mir alles reingezogen und mich davon mitreißen lassen.
»Ruhm und Reichtum, Sex und Drogen – das ist doch alles Käse. Nur Deppen geben sich damit zufrieden«, erklärte mir einmal ein Leidensgenosse in New Orleans. Er war trockener Alkoholiker wie ich selbst und braun gebrannt, im wahrsten Sinne des Wortes. Seine Haut war ledrig und zerfurcht, und sein Gesicht steckte im Klammergriff eines pelzigen Bartes.
Sein Hemd war mit blassen kreisförmigen Flecken übersät, die wirkten wie die Abdrücke einer Kaffeetasse auf einer alten Landkarte. Er sah aus wie ein Mann, der sein Leben gelebt, lange Nächte durchgefeiert und Schlägereien zuhauf mitgemacht hatte, doch seine Augen waren so klar wie seine Worte. »Geld, Ruhm und so weiter, das sind doch bloß Krümel«, sagte er und machte eine wegwischende Bewegung mit seinem dicken Unterarm. »Ich will den ganzen Kuchen.« Bei diesen Worten blickte er mich an und lächelte. Dann erhob er sich und schritt majestätisch davon, um sich als freiwilliger Helfer um die Obdachlosen zu kümmern, an denen in New Orleans kein Mangel herrscht. Rückblickend betrachtet war sein Abgang ein bisschen melodramatisch, etwa so wie in einem Kriminalfilm, wo der Spitzel sich nach einem mitternächtlichen Geheimtreffen mit seinem Verbindungsmann bei der Polizei aus dem Staub macht und vielleicht noch eine Zigarette mit dem Absatz ausdrückt. Warum sagen die Typen in diesen Filmen nie, »ich geh dann mal, tschüss«, wie normale Menschen?
Das Angenehmste daran, ein Drogensüchtiger zu sein, ist die Tatsache, dass sich unsere desillusionierte Wahrnehmung vernebelt. Ein anderer Alkoholiker – irgendwie habe ich den Eindruck, dass ich zu viel Zeit mit Säufern verbringe – sagte einmal zu mir: »Unser Problem sind nicht Drogen und Alkohol. Unser Problem ist die Realität, und Drogen und Alkohol sind unsere Lösung für dieses Problem.« Das, fand ich, war eine sehr kluge Bemerkung.
Die gleichen Anwandlungen, die dafür sorgten, dass ich Lakeside für die Lösung meiner Probleme hielt, ließen auch Heroin für mich als Lösung erscheinen. Das mag radikal klingen, ist es aber nicht. Als Jugendlicher in Grays empfand ich eine gewisse Leere, eine Traurigkeit, ein nicht näher bestimmbares Gefühl der Fremdheit und Unzugehörigkeit. Und als dann die Lokalzeitung oder irgendein Politiker oder der Bürgermeister oder egal wer verkündete, dass Lakeside die Lösung für alle Probleme sei, da dachte auch ich: »Ja, Lakeside ist die Lösung.« Angesichts der Tatsache, dass ich mir später so gut wie alles reingezogen habe, was man schnupfen, aufkochen, spritzen und schlucken kann, scheint es, dass die pharmazeutische Wirkung von Lakeside allenfalls begrenzt war und dass ich möglicherweise ein extremer Fall bin, aber ist es nicht genau das, was eine Sucht darstellt? Einen »extremen Fall«?
Versuchen wir nicht alle auf die ein oder andere Art eine Lösung zu finden für das Problem der Realität? Wenn ich diesen Job an Land ziehe, diese Braut, diesen Typen, diese Schuhe abgreife? Wenn ich diese Prüfung bestehe, diese Pizza esse, diesen Schnaps trinke, dorthin in Urlaub fahre? Wenn ich Karate lerne oder Yoga? Wenn West Ham nicht absteigt, wenn mein Schwanz mich nicht im Stich lässt, wenn ich mehr Likes auf Facebook bekomme, mir noch mehr abgefahrene Kochbücher anschaffe, eine noch bessere Küche, wenn es mich nicht mehr ständig juckt und sie endlich aufhört zu nörgeln.
Ist Zufriedenheit nicht immer an irgendeine Bedingung geknüpft? Liegt sie nicht immer in der Zukunft und ist untrennbar verbunden mit irgendeinem Objekt, sei es physischer oder ideologischer Natur? Ich weiß, dass es sich in meinem Fall so verhält, und als Süchtiger werde ich dadurch immer zu Exzessen verleitet und handle mir unweigerlich jede Menge Ärger ein.
Geht es Ihnen ähnlich? Sind auch Sie auf der Suche nach irgendwas? Ich bin nicht der Einzige, dem es so geht, oder? Fühlen Sie sich manchmal verängstigt, einsam, minderwertig, nicht gut genug? Ich meine, Sie lesen dieses Buch, irgendwie müssen Sie ja wohl das Bedürfnis haben, etwas zu ändern.
Lassen Sie mich jetzt, wo ich die Hosen heruntergelassen habe, nicht hängen. Sitzen Sie vielleicht gerade auf einer Jacht, eine Ray-Ban auf der Nase, zwei ölglänzende russische Schwestern zu Ihren Füßen, und der Hummersaft tropft Ihnen aus dem Maul, während die Sonne auf Ihren Bauch herunterscheint und die Mädels zu Ihnen hinauflächeln? Selbst wenn das der Fall sein sollte, beziehungsweise dann erst recht: Ist das alles so richtig superklasse? Funktioniert es? Die feine salzige Note, die schmerzhaften Dauerständer – ist das die Erfüllung? Ist es das, worauf es ankommt? Ist es wirklich so ein Gefühl, als würde Gott einem die Hand halten?
Verstehen Sie mich nicht falsch. Dekadenz ist mir nicht fremd. Ich habe es selbst ausprobiert. Ich hatte eine Villa in Hollywood, ich war bei der Oscarverleihung, ich habe riesige Partys geschmissen.
Im Jahr 2002 lag ich am Weihnachtsabend – ich war gerade zwei Wochen clean – gemeinsam mit meiner Mutter auf dem schmalen Bett einer kleinen Pension und wir schauten fern. Zwischen uns herrschte eine düstere Verbundenheit wie in der Notaufnahme eines Krankenhauses, ein eingefrorenes Lächeln auf den Lippen und eine tiefe Hoffnungslosigkeit im Herzen. Wäre damals eine glitzernde Fee ins Zimmer geflattert und hätte gesagt, »mach dir keine Sorgen, in ein paar Jahren wirst du mit deiner Mutter zur Oscarverleihung gehen«, wäre ich natürlich überrascht gewesen – ich meine, eine Fee und so –, aber was definitiv meine Vorstellungskraft überstiegen hätte, wäre ihre korrekte Voraussage gewesen: »Ach ja – ihr beide werdet den Oscar-Zirkus kotzlangweilig finden.«
Lakeside ist eine kleine lokale Gemeinde. Hollywood ist der Vatikan. Als ich kürzlich nach Grays zurückkehrte, fragte ich mich, wie es den übrigen Gemeindemitgliedern in der Zwischenzeit ergangen war. Ich fragte mich, ob Lakeside die Versprechen eingelöst hatte. Ob die Leute, die ich zurückgelassen hatte oder vor denen ich davongerannt war, wirklich in den Genuss von Auswahl, Freiheit und neuen Möglichkeiten gekommen waren.
Um aus Grays rauszukommen, fuhr ich damals schwarz mit dem Fenchurch Street Train, einem Pendlerzug für die Leute aus Essex, die in London arbeiten. Ich stieg am Bahnhof Chafford Hundred ein, einem neuen Gebäude an der Straße, in der ich aufgewachsen bin, versteckte mich mit einem selbst gebastelten Schild »Toilette defekt« auf ebendieser und rauchte Gras, während ich die Stationen zählte: Purfleet, Lakeside, Rainham, Dagenham Dock, Barking und Limehouse. Mit meiner gegelten Tolle sah ich aus wie eine Mischung aus der Serienfigur Del-Boy und Matt Goss, dem Sänger der Boyband Bros.
Heute nehme ich Platz auf dem Rücksitz von Micks Mercedes. Mick ist »mein Fahrer«, oder besser gesagt er wäre es, wenn ich Possessivpronomen in Verbindung mit Leuten benutzen und er wenigstens ein Mindestmaß an Professionaliät an den Tag legen würde. Also ist er halt mein Kumpel, der mich durch die Gegend fährt. Was aber immer noch weit mehr ist, als man in meinem Fall hätte erwarten können: Kind einer alleinerziehenden Mutter, Sozialhilfeempfänger, später dann drogensüchtig. Wir brettern die A 13 entlang, vorbei an den stillgelegten Ford-Werken, wo Bert, der Ehemann meiner Oma arbeitete, und an den Marshes, wo sie angeblich mal das Euro-Disneyland hinstellen wollten. Ich war damals völlig fertig, als sie sich dann doch für Paris entschieden haben. Ich meine, was soll das? Scheiß Paris?! Walt hat garantiert in seinem Grab rotiert, oder in der Stickstoffkühlkammer oder wo immer sie sonst seinen brillanten Nazikadaver eingebunkert haben.
Diesen Ausflug in die Vergangenheit, oder die Rückkehr ins Tal der Tränen, wie ich es nenne, weil meine Vergangenheit von Elend und Zurückweisung durchtränkt ist – damals war ich es, der zurückgewiesen wurde, dann habe ich den Spieß umgedreht und meiner Vergangenheit den Rücken gekehrt –, habe ich unternommen, weil mein Schulfreund Sam mich gebeten hat, einen Mind Shop zu eröffnen. Mind ist eine Hilfsorganisation für psychisch Kranke, und da ich zum einen über reichhaltige Erfahrung mit psychischen Krankheiten verfüge und zum anderen Sam ein alter Kumpel ist, der mir das Ganze mit dem unwiderstehlichen Spruch »open your Mind (shop), man« schmackhaft gemacht hat, denke ich, dass sich ein Besuch am Ort des Verbrechens vielleicht lohnen könnte. Das Verbrechen, geboren worden zu sein – zumindest empfand ich es als solches in den wirren und wilden Zeiten meiner Jugend.
Grays war nicht besonders toll, als ich noch jung war, aber das mag zum Großteil daran liegen, dass ich es durch meine Augen gesehen habe. Ich nehme an, wäre ich in der Toskana aufgewachsen, hätte ich genauso ein Drama draus gemacht, weil mein Hirn halt so tickte. Ich hatte einen Hang zum Jammern. Im Grunde genommen ist und war Grays – wie der Name schon sagt, meine selbstherrliche Melancholie mal außer Acht gelassen – nichts anderes als eine ganz normale Kleinstadt. Man könnte auch sagen eine normale Kleinstadt in Essex, oder eine durchschnittliche Vorstadt in England, oder im nördlichen Teil Europas, oder auch eine ganz normale Kleinstadt in einer säkularen westlichen Demokratie.
Als ich ein Kind war, gab es im Stadtzentrum – wo ich nun den Mind Shop eröffnen sollte – einen Markt, Warenhäuser und kleine lokale Geschäfte. Die Leute erledigten dort ihre Einkäufe, hingen herum, was man halt so macht. Als ich aus meiner abgedunkelten Bonzenkapsel stieg, war ich schockiert, wie sehr Grays sich verändert hatte. Gut, es war nicht wie Rom nach dem Einfall der Vandalen, kein Vergleich mit der Schändung der heiligen Schätze eines glorreichen Stadtstaats. Grays war schon immer ein bisschen schmuddelig gewesen. Aber jetzt waren die Warenhäuser ebenso verschwunden wie die kleinen Geschäfte, und der Markt fand nicht mehr statt.
Dafür gab es Ramschläden, Wettbüros, Kleiderkammern und Schnapsläden. Und auch die Leute hatten sich in den zwanzig Jahren meiner Abwesenheit verändert: Es gab mehr Besoffene, mehr Leute, die sichtbar unterernährt waren, doch was mich am meisten schockierte, war das deutlich spürbare Gefühl der Niedergeschlagenheit und Resignation unter den etwa fünfzig Leuten, die sich mit mäßigem Enthusiasmus an der Absperrung um den Mind Shop versammelt hatten.
Die Fieslinge unter euch werden jetzt sagen, dass mein drohender Besuch die Menschen so runtergezogen hat, doch das war es nicht, ihr Schweine. Jemand hatte diesen Leuten etwas weggenommen, und man konnte förmlich spüren, dass da etwas fehlte. Doch noch schockierender als dieser traurige Verfall ist die Tatsache, dass dieses neue, verelendete Grays mit seinen Tafeln, Wonga-Kreditbüros und der zunehmenden Zahl von Alkohol- und Drogensüchtigen nach wie vor eine ganz normale Stadt ist.
Denn es ist überall das Gleiche. Das reichste Prozent der britischen Bevölkerung besitzt so viel wie die ärmsten 55 Prozent zusammen. Ein paar Leute haben es geschafft, von den 55 zu dem einen Prozent aufzusteigen, doch größtenteils werden die durchschnittlichen Leute ärmer. Global ist die Situation noch schlimmer. Oxfam zufolge wäre in einem Bus mit den 85 reichsten Leuten der Welt mehr Wohlstand versammelt, als die halbe Menschheit zusammen aufbringen kann. Und das sind dreieinhalb Milliarden Erdenbürger.
Wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass diese Typen sich in einen Bus setzen würden, bei all dem Zaster. Oder dass sie überhaupt zusammen abhängen würden, da gibt es doch garantiert dauernd Spannungen, Neid und idiotische Reibereien:
»Mein Konzern ist größer als deiner.«
»Ach ja? Ich habe aber ein eigenes Medienimperium.«
»ACH JA? Und ich habe eine Eliteorganisation, die hinter den Kulissen die Weltpolitik lenkt.«
»Sofort anhalten! Ich will raus aus diesem Bus und zurück in meinen Palast am Meeresgrund, zu meinen Meerjungfrauen, um einen Song auf die Vorzüge des Unterwasserlebens anzustimmen.«
Die letzte Bemerkung könnte aus dem Film Arielle, die Meerjungfrau stammen, denn Walts tiefgefrorene Birne ist garantiert auch an Bord dieses Busses.
In Amerika – einem Land, das den Kapitalismus regelrecht gefressen hat, wenn wir mal ehrlich sind – besitzen die sechs Erben des Walmart-Konzerns mehr als die dreißig Prozent der Bevölkerung, die das untere Ende der Einkommensskala bilden. Gerade mal sechs Leute! Die könnten noch nicht mal eine Fußballmannschaft zusammenbringen, wie sollen sie da eine Revolution aufhalten, wenn wir alle endlich gegen diese statistischen Missstände angehen? Außer das gesamte System ist so angelegt, dass der Wohlstand immer nur in Richtung einer kleinen Elite fließt und dort auch verbleibt.
Was Sie gerade gelesen haben ist verrückt. Geisteskrank. Unglaublich, aber wahr und wirklich. So wirklich wie Ihre Hände, die gerade dieses Buch (Kindle, Tablet – intraneurales Hirn-Hologramm, je nachdem, in wie vielen Jahren Sie das hier lesen) halten. Und so wahr und wirklich wie die Luft, die Sie gerade einatmen.
Sechs Leute, deren Papa »ein Händchen für Supermärkte« hatte, besitzen mehr Geld als Millionen Amerikaner, die Tag für Tag ums Überleben kämpfen. Ein Bus voller Plutokraten, gekrönter Häupter und Oligarchen versammelt mehr Geld, als sämtliche Flüchtlinge, Kriegskinder und all die Leute mit aufgeblähten Bäuchen, die vor Hunger keinen Schlaf finden, zusammen haben.
Es drängt sich einem auf, dass das Wahnsinn ist, dass da etwas falsch läuft, und zwar so grundlegend falsch, dass es mit Kopfschütteln schon nicht mehr getan ist. Man erklärt uns, dass wir dagegen nichts tun können, dass »die Dinge nun mal so sind, wie sie sind«. Pikanterweise kommt diese Einschätzung von genau den elitären Institutionen, Organisationen und Individuen, die aus der derzeitigen Lage der Dinge Profit schlagen.
Doch so bitter einem diese Ungerechtigkeit auch aufstoßen mag, noch wichtiger ist die Tatsache, dass uns nur begrenzte Zeit bleibt, um daran etwas zu ändern. Die gleichen Interessengruppen, die von diesem – der Kürze halber nenne ich es mal »System« – profitieren, sind zu dessen Erhalt darauf angewiesen, die Ressourcen unseres Planeten so rasant, rücksichtslos und verantwortungslos auszubeuten, dass die Fähigkeit der Erde, die Menschheit zu ernähren, zunehmend gefährdet erscheint. Eine reichlich beschissene Situation.
Ich meine, wenn uns irgendwelche Leute von ihrem sozioökonomischen System erzählten, das auf Kosten der großen Mehrheit der Bevölkerung eine unglaublich wohlhabende Elite hervorbringt, unter ökologischen Aspekten aber total vernünftig sei, würden wir ihnen vermutlich erwidern, dass sie sich dieses System in den Arsch schieben sollen. In Wirklichkeit haben wir ein System, das den Reichtum einer kleinen Elite ins Unermessliche steigen lässt, während es gleichzeitig dem Rest der Bevölkerung zusehends die Luft abschnürt und den Planeten zerstört, auf dem wir alle leben. Ich weiß, dass Sie alle das alles bereits wissen. Ist mir bekannt. Wir alle wissen Bescheid. Doch es ist so absurd – oder genauer gesagt wahnsinnig –, dass man es uns offenbar immer wieder sagen muss.
Die besagten Eliten, die Spinner in ihrem brillantbesetzten Spaßbus, bewohnen denselben Planeten wie wir. Im Grunde genommen sitzen wir alle im gleichen Boot. Das heißt, dass sie genauso wie wir in der Klemme sitzen – außer der Bus ist ausgestattet für Weltraumreisen und sie haben vor, sich zu einer Mondbasis abzusetzen, sobald hier alles den Bach runtergeht und nur noch verbrannte Erde zurückbleibt.
Über all diesen Kram muss ich nachdenken, während ich in einem Secondhandladen in meiner heruntergewirtschafteten Heimatstadt die gebrauchten Gegenstände in den brandneuen Regalen in Augenschein nehme. Das Jungfernband, das ich durchschneiden werde, hängt unversehrt am Eingang. Die freiwilligen Mitarbeiter stehen mit halb leeren Gläsern Sekt vom Supermarkt herum, beseelt von kollektiver Feierlaune.
Leider stehen zwei unbequeme Wahrheiten im Raum und treten auf die Spaßbremse: 1) Sich um psychisch Kranke zu kümmern ist nicht die Aufgabe von Wohlfahrtsorganisationen, sondern die des Staates. 2) Dieser beschissene Secondhandladen wird sowieso den Bach runtergehen. Es gibt davon schon jede Menge. Wenn es eines gibt, woran kein Mangel herrscht, dann sind es Secondhandläden. Sie schießen überall wie Pilze aus dem Boden beziehungsweise wie Zombies aus den Gräbern verendeter richtiger Geschäfte.
Doch wir lassen uns nichts anmerken und spulen das übliche Ritual ab: Scheren werden gezückt, Applaus ertönt, die Leute strömen herein, schauen sich um, mustern hier einen grauenhaften Pullover, wiegen da eine Porzellanprinzessin in der Hand. Ein Stadtrat sagt etwas, ein psychisch Kranker auf dem langen Weg zur geistigen Gesundheit sagt etwas, ich sage etwas – ich bin auch nur ein paar Schritte weiter.
Eine Dame wie vom Kirchenbasar wirft mir ein Paar Damenjeans zu. »Die würden Ihnen gut stehen, Russell.« Ich kaufe sie, und wir lachen beide. Dabei würde ich in Wirklichkeit nichts lieber tun, als die Platte anzuhalten, mit der Nadel über die Tonrillen zu kratzen und zu rufen: »Was zum Teufel veranstalten wir hier eigentlich?« Was ist das für eine Kraft, die uns alle am Boden festhält? Wer hat diesen niedrigen, erdrückenden Himmel über uns eingezogen? Solche Gefühle überkommen mich öfter – das Verlangen, hinter die Kulissen der Realität zu schauen, die Platte anzuhalten und laut zu verkünden, es gibt noch was anderes als das hier, ich weiß es ganz genau.
Ich weiß, dass wir eigentlich mit unserer Zeit Besseres anstellen könnten. »There is a crack in everything, that’s how the light gets in«, singt Leonard Cohen in einem Song. Man kann es sehen. Nur ein kleines Stück hinter der Wirklichkeit scheint ein Licht, du kannst es spüren. Jenseits deiner Gedanken existiert tatsächlich Stille. Er wusste, dass es eine Antwort geben muss, deswegen wurde er Buddhist und hat sich in die Berge verpisst, um dort zu leben. Entweder deswegen oder weil sein Management ihn um seine gesamte Kohle beschissen hatte.
Ein Grund, warum ich solchen Gedanken nachhing, während ich mich nonchalant im Kreise verarmter Mitbürger bewegte, lag darin, dass ich zu diesem Zeitpunkt ein Gastspiel als Chefredakteur der politischen Wochenzeitung New Statesman gab. Als sie mich nach dem Thema der Ausgabe fragten, die ich herausgeben sollte, antwortete ich: »Revolution«. Daraufhin wurde eine Reihe von Journalisten, Philosophen und Aktivisten zusammengetrommelt, die zu verschiedenen Aspekten des Themas Beiträge liefern sollten. Naomi Klein schilderte in ihrem Artikel eine Umweltkonferenz, auf der die Notwendigkeit radikaler Schritte klipp und klar formuliert wurde.
Brad Werner erforscht komplexe Systeme (was sich anhört, als wäre die Arbeit schwer zu überwachen – »Hey, Werner, analysieren Sie gerade irgendein komplexes System, oder spielen Sie nur mit Ihrem Telefon herum?«) und stellte letztes Jahr in einem Referat vor der American Geophysical Union (der Geophysikalischen Gesellschaft Amerikas, die ihre Einladungen vermutlich mit pornografischem Material anreichern muss, um überhaupt irgendjemand zu ihren Veranstaltungen zu locken) die These auf, dass unser Planet am Arsch ist. Er hatte unser komplexes System, die Erde, untersucht und herausgefunden, dass wir, die Leute, die darauf leben, am Arsch sind. Ich mache keine Witze, sein Vortrag trug den Titel »Ist die Erde am Arsch?« – was darauf hindeutet, dass die Geophysikalische Gesellschaft Amerikas kein so steifer Haufen ist, wie der Name vermuten lässt. Die benutzen sogar Wörter wie Arsch und so.
Brad Werner erklärte in seinem Vortrag, dass das kapitalistische System in seinem Ressourcenverbrauch so unersättlich, und jede bisher ergriffene Gegenmaßnahme so ineffektiv ist, dass für den Planeten nur noch Hoffnung auf Rettung besteht, wenn Kräfte außerhalb des Systems aktiv werden.
Die Kräfte innerhalb des Systems werden die ökologische Kernschmelze nicht verhindern, das würde ihrer Ideologie widersprechen. Die Veränderung muss von außen erzwungen werden.
Das heißt von uns. Der ganze Kyoto-Kram – die Reduktion der Kohlenstoffemissionen um »x« Prozent bis zum Jahr »y« – ist nichts weiter als gequirlte Scheiße. Eine bloße Geste, eine Alibiveranstaltung – in etwa so wie der Salat bei McDonald’s. Zu wenig, zu spät.
Das Ganze ist in etwa so effektiv, als würde man einen Serienkiller wie Fred West zum Nachsitzen in der Schule verdonnern.
Wir alle wissen, dass man diesen Arschgeigen nicht trauen kann. Sie werden sich nie im Leben verantwortungsbewusst verhalten. Man braucht sich nur die Tabakindustrie anzusehen: Jahrzehntelang haben die ihre Kunden umgebracht, bevor sie endlich mit der Wahrheit über die Krebsgefahr rausgerückt sind. Sie würden uns heute noch verarschen, wenn sie den Eindruck hätten, dass sie damit durchkommen.
Und Sie können Gift drauf nehmen, dass bei Mobiltelefonen die Reise in eine ähnliche Richtung gehen wird. Dieses heiße Kribbeln in Ihrem Ohr ist nicht unbedingt ein Zeichen, dass alles super in Ordnung ist an der Lauscherfront.
James Lovelock, der Typ, der die Gaia-Theorie ausgebrütet hat, wonach die Erde einen symbiotischen, komplexen Organismus darstellt, in dem verschiedene Lebensformen im Einklang miteinander koexistieren und sich gegenseitig fördern und regulieren, kommt zu dem Schluss, dass wir uns nicht großartig mit Recycling, Windrädern und Hybridautos aufhalten sollen. Ihm zufolge ist das alles nur ein Haufen Scheiß (wobei er es nicht wortwörtlich so formuliert, doch wer weiß, vielleicht hätte er das getan, wenn er sich eine Weile bei der fluchenden Spaßtruppe der Geophysikalischen Gesellschaft Amerikas herumgetrieben hätte).
Ich glaube nicht, dass Lovelock sagen will, wir sollten uns einfach zurücklehnen und die Apokalypse in vollen Zügen genießen, sondern vielmehr, dass wir schnell radikale Maßnahmen ergreifen müssen und dass diese nicht von denjenigen in die Wege geleitet werden, die für die derzeitigen Zustände verantwortlich sind und davon profitieren. Und auf wen wir in diesem Zusammenhang in keinem Fall zählen sollten, sind die Passagiere des brillantbesetzten Luxusbusses. Diese Leute sind das Problem, wir sind die Lösung, folglich müssen wir uns auf uns selbst besinnen.
* * *
Meine Abreise aus Grays war dieses Mal um einiges luxuriöser als das letzte Mal. Ich verkroch mich auf die bequeme Rückbank von Micks Wagen. Ein Mercedes. Das Betäubungsmittel der Privilegierten. Das Luxusgefängnis auf Rädern. Die Leute wollen Autogramme und Fotos von meiner Abfahrt – ein paar Überreste und Brosamen von der Tafel der Reichen. Ein Typ in meinem Alter, der ein Riesenglas extrastarken Cider in der Hand hält, legt mir den Arm um die Schultern. White Lightning habe ich früher auch getrunken. Wir blicken uns kurz in die Augen, und sein Mundgeruch raubt mir fast den Atem. Ich ziehe die Tür zu. Meine Vergangenheit und meine Gegenwart müssen draußen bleiben.
Was ich zu sehen bekommen habe, macht mich schon irgendwie fertig. Dahin zurückzukehren, wo man herkommt, ist immer eine zweischneidige Angelegenheit, befrachtet mit Erinnerungen, die wie Glasscherben auf den Gehwegen verstreut sind, sodass man bei jedem Schritt aufpassen muss, wo man hintritt. Ich setzte mich hin und meditierte, wobei mich leichte Gewissensbisse überkamen, dass ich überhaupt den Platz dazu hatte.
Ein solcher Ort des Friedens sollte eigentlich jedermann zustehen.
»Schon in Ordnung, dass du dich in Hitlers Auto durch die Gegend kutschieren lässt«, stellte ich mir die Stimme des besoffenen Typen vor. Wobei ich auf die Feststellung Wert lege, dass es nicht wirklich Hitlers Wagen ist – das wäre mir zu gruselig –, aber ansonsten habe ich mich damit arrangiert. Ich bin in der glücklichen Lage, ein Leben zu führen, das es mir erlaubt, zu meditieren, mich gesund zu ernähren, Yoga zu machen, Sport zu treiben, nachzudenken und mich zu entspannen. Dafür ist Geld gut. Man kann es sich erlauben. Doch ist es möglich, dass jeder ein solches Leben führen kann? Und kann irgendjemand glücklich werden, solange derlei grundlegende Dinge nur für eine kleine Gruppe von Leuten verfügbar sind?
Man erzählt uns, dass wir fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag essen sollen. Dann sind es plötzlich sieben Portionen. Irgendwo habe ich gelesen, dass zehn noch besser wären, und am besten wäre es, wenn wir den ganzen Tag über den Kopf in einen Trog stecken und Kohl knabbern.
Wissenschaftler kommen zu solchen Schlüssen, indem sie eine Unmenge von Daten auswerten und dann irgendwann feststellen, dass ein Zusammenhang besteht zwischen der Lebensdauer und dem Konsum von Obst und Gemüse.
Daraus ziehen sie den Schluss, dass wir alle mehr Obst und Gemüse essen sollen. Die Verantwortung wird uns zugeschoben, schließlich bestimmen wir selbst, was wir essen.
Natürlich könnte man aus den vorliegenden Daten auch ganz andere Schlüsse ziehen. Die gleichen Leute, die sich einer hohen Lebenserwartung erfreuen und den ganzen Tag Obst und Gemüse essen, sind darüber hinaus auch noch größtenteils recht gut situiert, haben gute Jobs, machen regelmäßig Urlaub, treiben Sport und müssen sich nicht mit armutsbedingtem Stress herumschlagen. Die ebenso auf der Hand liegende wie beängstigende Schlussfolgerung aus diesen Tatsachen wäre, dass wir eine Gesellschaft anstreben sollten, in der alle in den Genuss der Privilegien und Ressourcen kommen, die bisher nur der Obst verspeisenden Elite vorbehalten sind – Obst und Gemüse eingeschlossen.
Daraus folgt, dass es nicht die Verpflichtung des Einzelnen ist, zum Supermarkt zu rennen und sich mit Sellerie einzudecken, sondern dass es die Aufgabe jedes Einzelnen als Mitglied der Gesellschaft ist, sich für ein gerechteres System einzusetzen, in dem mehr Menschen Zugang zu den entsprechenden Ressourcen haben.
Ich erhalte einen Anruf von einer Newsnight-Produzentin. »Ich finde es interessant, dass Sie nie an einer Wahl teilgenommen haben«, sagt sie. »Darüber sollten Sie morgen unbedingt mit Paxman reden.« Amüsiert, dass so etwas als abnorm betrachtet wird, stimme ich zu.
Die Einsicht, dass Wahlen eine sinn- und nutzlose Veranstaltung sind, Demokratie nichts weiter ist als eine hohle Fassade, und dass niemand die Interessen der ganz gewöhnlichen Leute vertritt, macht sich immer stärker in mir breit, während ich die ganz gewöhnliche Stadt hinter mir lasse, in der ich aufgewachsen bin. Und sosehr ich auf dem Rücksitz des Führermobils auch von Zorn und Schuldgefühlen geplagt werde, spüre ich dennoch einen Rest Hoffnung. Je klarer mir wird, dass radikale Veränderungen auf individueller, gesellschaftlicher und globaler Ebene unabdingbar sind, desto stärker werde ich von einem allumfassenden Optimismus gepackt. Ich weiß, dass Veränderung möglich ist. Ich weiß, dass es eine Alternative gibt, denn ich habe ein komplett anderes Leben, als bei meiner Geburt zu erwarten gewesen wäre. Ich weiß aber auch, dass die Lösung nicht darin besteht, Geld und Ruhm anzuhäufen oder irgendwelchen vergänglichen Firlefanz. Eine Revolution, mit der es wirklich gelingen soll, die Welt zu verändern, muss in unseren Köpfen anfangen. Und in meinem Kopf geht es gerade los.
Kapitel 2
Gelassenheit jetzt
Die Situation, in der wir uns befinden, lässt sich nur als geisteskrank bezeichnen. Wie kommt es, dass dieses ungerechte, ausbeuterische System weiterhin am Laufen gehalten wird? Quentin Crisp, der scharfzüngige britische Dandy, dem Sting mit seinem Song An Englishman in New York ein Denkmal gesetzt hat, sagte einmal: »Charisma ist die Fähigkeit, Menschen unter Verzicht von Logik zu beeinflussen.« Wenn dem so ist, dann müssen David Cameron, Donald Rumsfeld und Rupert Murdoch trotz ihrer einschläfernden Hackfressen von uns allen unbemerkt über einen Sex-Appeal wie Elvis verfügen, um diesen ungleichen Reigen weiterzutanzen.
Es gibt keinen logischen Grund, ein derlei ungerechtes und destruktives System aufrechtzuerhalten, insofern müssen diese unerkannten Sexbomben dahinterstecken. Das effektivste Werkzeug für die Aufrechterhaltung des Status quo ist unser Glauben, dass es nicht möglich sei, daran etwas zu ändern. »Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen – wenn man von all den anderen absieht, die man von Zeit zu Zeit immer mal wieder ausprobiert hat.« Diesen Satz sprach Winston Churchill, als er erfuhr, dass die Briten ihn nach dem Sieg Englands im Zweiten Weltkrieg abgewählt hatten.
Angeblich fiel ihm der Spruch in der Badewanne ein, was nicht unbedingt der beste Ort ist, um Epigramme abzusondern, vor allem, wenn man gleichzeitig seine Zigarre trocken halten muss. Auf jeden Fall ist es für die Eliten an der Spitze ganz praktisch, dass es keine Alternative zu diesem System gibt, in dem sie selbst einen mit unermesslichem Luxus ausgestatteten Elfenbeinturm bewohnen. Wie schön, dass keine Aussicht auf Veränderung besteht. Wie passend, dass jede Alternative, die infrage käme, entweder konsequent ignoriert oder vehement diskreditiert wird.
Die Einsicht, dass es möglich ist, mein Leben zu ändern und meinen klaren Verstand wiederzuerlangen, war ein integraler Bestandteil der Überwindung meiner Alkohol- und Drogensucht. Und ich bin der festen Ansicht, dass diese Einsicht auch auf gesellschaftlicher Ebene unabdingbar ist.
Sie haben vermutlich schon bemerkt, dass ich immer mal wieder Gott erwähne. Zumindest falls Sie nicht ausgerechnet der Typ sind, der auf seiner Jacht rumlungert und nur oberflächlich in diesem Buch herumblättert, während die russischen Schwestern herumnörgeln und der Schampus schal wird. Doch ehrlich gesagt sind Oligarchen ohnehin nicht die Zielgruppe dieses Buchs. Falls Sie trotzdem einer sind, möchte ich Sie bitten, das Buch für die Nachwelt an Deck abzulegen und sich ins salzige Nass zu stürzen.
Der Grund, warum ich Gott immer wieder erwähne, ist, dass ich an Gott glaube. Das mag für eine Menge Leute überraschend klingen – immerhin haben wir 2015, und wir leben in einer technologisch fortgeschrittenen, säkularen Kultur.
Gott wird heutzutage in erster Linie in Verbindung gebracht mit beschränkten Weißen und zornigen Dunkelhäutigen. Der (verstorbene) Friedrich Nietzsche hat Gott zwar für tot erklärt, doch seitdem beobachten wir eine Entwicklung, die der britische Autor G. K. Chesterton so beschrieben hat: »Dass Gott tot ist, bedeutet nicht, dass die Menschen nunmehr an gar nichts mehr glauben, sondern im Gegenteil, dass sie bereit sind, an so gut wie alles zu glauben.«
Ich bin dafür ein gutes Beispiel. Als Dreizehnjähriger glaubte ich an Lakeside, als Achtjähriger an Kekse, mit siebzehn war ich fanatischer Wichser und mit neunzehn begeisterter Drogenkonsument, bevor ich schließlich im Kloster des Prominentendaseins landete.
Im Anschluss an meinen ebenso aufschlussreichen wie verwirrenden Besuch bei der Eröffnung des Mind Shop, stattete ich meiner alten Schule einen Besuch ab, einerseits um zu sehen, ob sie tatsächlich so schlimm war, wie ich sie in Erinnerung hatte, andererseits um festzustellen, ob es damit vielleicht noch weiter abwärts gegangen war. Jedes Mal wenn ich vor jungen Leuten stehe, habe ich das Gefühl, die anwesenden Respektspersonen erwarten von mir, dass ich Weisheiten absondere im Stil von »Macht ’n Bogen um die Drogen«, »Wenn ich es geschafft habe, schafft ihr es auch« oder »Ihr müsst lernen, euch an den eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen«, um damit klarzustellen, dass man als Individuum widrige Umstände überwinden kann.
Das verursacht mir Unbehagen, denn genau darum geht es mir nicht. Ich kann das Establishment nicht ausstehen, und mir steht nicht der Sinn danach, in seinem Auftrag irgendwelche ausgelutschten Predigten zu halten. Im Gegenteil, ich muss mich bei solchen Gelegenheiten jedes Mal ziemlich zusammenreißen, um die Jugendlichen nicht dazu aufzurufen, zu randalieren, ihre Zeugnisse zu verbrennen oder ihre Schule in Brand zu setzen.
Dieser extremistische Hang zum Destruktiven scheint irgendwie in mir zu stecken. Wenn ich in der Schulaula stehe, in der ich Jahrzehnte zuvor nach der Liane geangelt habe, an der ich mich wie ein pummeliger Tarzan aus der Provinz geschwungen habe, und mich jene Teenager – erfüllt von Castingshow-Ambitionen und Spielkonsolen-Eskapismus – mit großen Augen anstarren und mir erklären, dass sie »auch mal berühmt werden« wollen, zucke ich zusammen und würde ihnen am liebsten erzählen, dass sie total verarscht werden. Dass sie in tragischer Weise von der vorherrschenden Kulturproduktion in die Irre geführt wurden.
Trotz all der Qualen, die ich infolge meiner Alkohol- und Drogensucht durchlebt habe, würde ich nicht auf die Lehren und Erfahrungen verzichten wollen, die ich daraus gewonnen habe, und schon gar nicht so weit gehen, anderen Leuten – und erst recht nicht jungen Leuten – zu erklären, sie sollen die Finger von dem Zeug lassen.
Der Kampf gegen Drogen ist in Wirklichkeit ein Kampf gegen die Drogenabhängigen (wozu Bill Hicks einmal die schöne Bemerkung gemacht hat: »Wenn es einen Krieg gegen die Drogen gibt und wir ihn verlieren, sind die Drogensüchtigen die Gewinner«) und insofern ein gutes Beispiel für die Perfidie des Systems auf individueller, juristischer und globaler Ebene.
Drogenabhängigkeit ist eine Krankheit. Menschen zu kriminalisieren, die krank sind, ist sowohl grausam als auch hinterlistig. Und darüber hinaus nutzlos wie nur irgendwas – kein Drogensüchtiger, der etwas auf sich hält, wird sich auch nur im Geringsten um den rechtlichen Status der Droge seiner Wahl scheren. Das Einzige, was durch die Kriminalisierung erreicht wird, ist ein unsicherer und unkontrollierter Drogenkonsum, die Dämonisierung der Konsumenten und die Schaffung einer internationalen kriminellen Ökonomie. Sie wissen das, ich weiß das, doch was wirklich beunruhigend ist, die Leute, die an dieser Praxis festhalten, wissen es ebenfalls. Daher stellt sich die Frage, warum wird an dieser Praxis festgehalten? Wer profitiert davon?
Nun, in dieser Frage kann ich eine gewisse Kompetenz für mich beanspruchen. Ich habe bisher zwar noch keine Regierung gestürzt oder eine neue, gerechtere Gesellschaftsordnung entworfen, in der das Leben mehr Freude macht, weshalb einiges in diesem Buch spekulativ bleiben mag, doch immerhin habe ich es – mit tatkräftiger Hilfe von vielen Seiten – geschafft, mich aus einer Situation herauszumanövrieren, in der Saufen und Drogen Konsumieren mir als einzige Lösung für meine Probleme erschienen, und stattdessen einen Zustand zu erreichen, in dem ich mittlerweile seit Jahren Tag für Tag weder Drogen noch Alkohol zu mir nehme. Wie ist das passiert?
Als desorientierter kleiner Junge in Essex, der darauf wartete, dass Lakeside endlich eröffnet, und der den doppelgesichtigen grinsenden Patriarchen Ronald McDonald verehrte, empfand ich eine diffuse Unzufriedenheit. Ich liebte meine Mutter, kam mit meinem Stiefvater nicht richtig klar und betete meinen abwesenden Vater an. Ich war einsam und frustriert. Meine Mutter war häufig krank, ich fühlte mich zu Hause nicht wirklich heimisch, sondern wurde stets von einer gewissen Unruhe und Unsicherheit geplagt. Dieses Gefühl der Entfremdung und Gereiztheit machte mich anfällig für Verlockungen von außen. Haben Sie jemals versucht, sich mit jemandem auseinanderzusetzen, der überhaupt nichts mit Ihnen zu tun haben will? Das ist nicht einfach. Haben Sie jemals mit jemandem gestritten, der aufgehört hat, Sie zu lieben, und dann festgestellt, dass Sie kein Ass mehr im Ärmel haben? Keinerlei Verhandlungsmasse. Wenn Sie einen x-beliebigen Fremden ansprechen und ihm sagen, dass er Sie nie wiedersehen wird, wenn er nicht auf Ihre Forderungen eingeht, dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, dass dieser Fremde sich vor Ihnen zu Boden werfen und Sie bitten wird zu bleiben. Im Gegenteil – man wird Ihnen den Rücken zukehren und sich aus dem Staub machen.
Zufriedene Leute sind schwer zu steuern. Wir sind permanent unzufrieden, und als Therapie bietet man uns irgendwelche Placebos an. Meine Intention beim Schreiben dieses Buches war, Ihnen zu helfen, sich besser zu fühlen. Ihnen einen Ausweg aus Ihrer Gefühlsmisere aufzuzeigen.
Und genau das ist es, worauf es meiner Überzeugung nach ankommt. Wann sind Sie zum letzten Mal jemandem begegnet, der glücklich war? Richtig glücklich? Die einzig wirklich glücklichen Leute sind Kinder, psychisch Kranke und Moderatoren im Frühstücksfernsehen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass es möglich ist, sich glücklicher zu fühlen, denn ich selbst fühle mich um Längen besser als früher. Ich beginne zu verstehen, wie die Lösung aussehen könnte, was in erster Linie daran liegt, dass ich auf meiner langen und beschwerlichen Suche danach oft genug auf dem Holzweg war. Was mich qualifiziert, ein Buch darüber zu schreiben, wie man sich selbst und die Welt verändern kann, ist nicht die Tatsache, dass ich besser oder klüger bin als Sie, sondern im Gegenteil, dass ich schlimmer und dümmer bin – und mich bereitwillig von vorn bis hinten habe verarschen lassen.
Meine einzige Qualität war ein unbewusstes Beharrungsvermögen, die Bereitschaft, mich dem ständigen Gefühl der Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit auszusetzen, das mir von dem Moment an eingetrichtert wurde, als ich zu sprechen lernte. Was ist, wenn dieses Gefühl der Isolation, der Untauglichkeit und Angst seinen Ursprung nicht nur in mir selbst hat, sondern vielmehr das Resultat einer konzertierten Aktion ist? Das Ergebnis einer ständigen Berieselung und Propaganda durch eine fremde Macht, die meinen Verstand kolonisiert hat?
Wer ist es, der da drinsteckt in unserem Kopf und diese Worte liest und diese Angst empfindet? Ist da ein Bewusstsein, eine losgelöste Instanz, die sich durch den Redeschwall erahnen lässt, der permanent jedes Ereignis kommentiert, jedes Objekt einer Schublade zuweist und jeden bewertet, mit dem man in Kontakt kommt? Und gibt es eine andere Art zu empfinden? Ist es möglich, in dieser Welt zu existieren und andere Empfindungen und Gefühle zu haben? Können Sie sich, wenn auch nur für einen Moment, eine Spezies vorstellen, die fast so ist wie wir, nur ein bisschen weiter entwickelt, und die sich von der Vorstellung gelöst hat, dass wir zur Änderung unserer Gefühlslage auf Hilfsmittel von außen zurückgreifen müssen? Wie wäre das? Was wäre das für ein Gefühl – befreit zu sein von diesem Kontrollapparat, der dauernd damit beschäftigt ist, unseren widerspenstigen Verstand unter der Fuchtel zu halten? Ist es möglich, dass unsere Gefühlslage das Resultat einer Verschwörung ist?
Wären wir Polizisten, würden wir nach einem Motiv suchen. Wenn unser Seelenfrieden dahingemeuchelt wurde, unser gottgegebenes Recht auf Harmonie und Eintracht mit unserer Umwelt und unseren Mitmenschen, wer sind dann die Hauptverdächtigen? Nun denn, wer hat ein Motiv?
Kapitel 3
Klatschen mit einer Hand
Als ich ein Junkie war, brauchte ich Drogen.
Lakeside hatte sich als Enttäuschung entpuppt. Sobald man die drei Stockwerke abgeklappert, die (meist desinteressierten) Mädels in Augenschein genommen, vielleicht einen Kugelschreiber oder eine CD geklaut oder von ein paar harten Burschen aus Tilbury Prügel angedroht bekommen hatte, was blieb dann noch? Klar konnte man die Sachen hinter den Schaufensterscheiben betrachten, aber leisten konnte man sie sich nicht. Das Ganze schien also ein ökonomisches Problem zu sein. Sobald ich all diese Sachen würde kaufen können, wäre alles in Ordnung. Jemand mit mehr Grips in der Birne hätte eventuell Zweifel an dieser Schlussfolgerung gehabt, doch ich war davon unberührt. Ich widmete mich voll und ganz der Aufgabe, die Mittel zur Lösung des soeben dargelegten Problems zu beschaffen.
Das hieß: Geld auftreiben. Und ich trieb Geld auf. Ich kaufte mir den Kram auf der anderen Seite des Schaufensters, doch es funktionierte nicht. Es gibt Momente, da kann ein neues Paar Schuhe oder was auch immer zum Fetisch erhoben werden, zu einem Kleinod, das einem Zufriedenheit verleiht. Man trippelt wie eine Geisha an gefährlichen Pfützen vorbei, behält die Reeboks auch vor dem Fernseher an und verbringt die Werbepausen damit, zu ihnen hinunterzuschauen. Doch es dauert nicht lange, bis die Zaubertreter ihre magischen Kräfte verlieren. »Ich brauche dringend ein neues Paar Schuhe, die Betäubungswirkung von diesen hier lässt nach.« Glücklicherweise kommt demnächst ein neues, noch besseres Modell von Reebok auf den Markt, das in einem Sportgeschäft ganz in deiner Nähe zu haben ist, und so dreht sich das Karussell immer weiter. Die Rolltreppe von Lakeside rauf und wieder runter, an den künstlichen Farnen vorbei, in den Brunnen rotzen, die Schule schwänzen und mich irgendwo in einem Hinterstübchen meines Hirns leise fragen, was dieser ganze Aufstand eigentlich soll – und mich doch nicht dazu durchringen, einfach mal haltzumachen und kurz nachzudenken. »Was will ich eigentlich hier in Lakeside? Das Ganze haut doch einfach nicht hin!« Genug Geld zu machen, um ein ernst zu nehmenderKonsument zu sein, erfordert Zeit, Engagement und Hingabe. Die Wartezeit ist eine Zeit des Elends. Und auf den Gedanken, dass das Objekt meiner Begierde vielleicht doch nicht so toll sein könnte und die Spielregeln von vornherein verkorkst sind, kam ich nicht.
Als 2011 überall im Land ganze Scharen junger Leute scheinbar spontan auf die Idee kamen, die Schaufensterscheiben zu zerschlagen und sich die Götzenbilder vom Altar zu schnappen, wurde dies allenthalben als asozial und nihilistisch verurteilt. Kann schon sein, doch wesentlich asozialer und nihilistischer ist es, diese zweifelhafte Götzenverehrung erst ins Rollen zu bringen.
Das permanente Bombardement mit Bildern von glücklichen Konsumenten, die dauernd wiederholte Botschaft, dass du nicht gut genug bist. Du bist zu fett, zu picklig und zu blass. Du bist nicht so fit wie David Beckham oder Beyoncé, also fliehe aus deinem Leben in diese Playstation-Existenz, übertünche deinen Versagergestank mit diesem Parfum und renn vor deinen Schulden in diesen glänzenden neuen Schuhen davon. Sei nicht du selbst. Sei nicht du selbst. Wenn ich es nur geschnallt hätte und mutig genug gewesen wäre, hätte ich diesen Tempel der Lüge eingerissen. Ich hätte den Schrein in Brand gesetzt und den Himmel mit Rauchfahnen überzogen.
Glücklicherweise habe ich es bleiben lassen. Meine Tante Janet arbeitete bei dem Kaufhaus John Lewis.
Adam Curtis hat in seiner revolutionären Dokumentarfilmreihe The Century of the Self minutiös nachgezeichnet, wie sich Sigmund Freuds Neffe Edward Bernays dessen Theorien zunutze machte, um den Berufszweig des PR-Beraters ins Leben zu rufen und den Massenkonsum der Fünfzigerjahre auszulösen. Zu den Zeiten, bevor psychologische Aspekte Einzug ins Vertriebswesen hielten, waren Produkte aufgrund ihrer Nützlichkeit an den Mann gebracht worden: »Haben Sie Füße? Probieren Sie es mal mit Schuhen.« So weit, so gut.