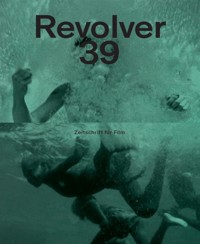
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Auge und Ohr werden gerne als ‚audiovisuell‘ zusammengefasst, aber wir alle wissen, dass das Hören aus reiner Höflichkeit zuerst genannt wird. Die meisten Filme jedenfalls privilegieren das Auge, zumindest wenn es um den Einsatz von Produktionsmitteln geht, aber eben auch intellektuell. Entsprechend wird die Geschichte des Films oft als visuelle Entwicklung erzählt und das Aufkommen des Tons als Störung und Rückfall in ein mediengeschichtlich älteres Register. Aber nicht nur war der Ton immer schon da (mit zum Teil erstaunlichen Soundeffekten und variantenreicher Musikbegleitung), auch der Übergang zum Synchronton hat das Kino durchaus nicht zu jenem ‚abgefilmten Theater‘ gemacht, das noch heute als Definition für das ‚Unfilmische‘ herhalten muss. In Lucrecia Martels Kino spielt der Ton eine zentrale Rolle; sie spricht vom Akustischen als dem einzigen Element, das den Körper des Zuschauers (und nicht nur das Ohr) im Wortsinne berührt und umfängt. Ihre Ausführungen, die dieses Heft eröffnen, werfen ein Schlaglicht auf eine vernachlässigte akustische Filmgeschichte, und zugleich auf das „Unerhörte“ und Bahnbrechende ihres Kinos: die Anwesenheit des Unsichtbaren. Und wer weiß, vielleicht lässt sich dieses scheinbare Kino-Paradoxon auch als Klammer gebrauchen, die Texte dieser Ausgabe zu lesen.
Die Redaktion
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Vorwort
Auge und Ohr werden gerne als „audiovisuell“ zusammengefasst, aber wir alle wissen, dass das Hören aus reiner Höflichkeit zuerst genannt wird. Die meisten Filme jedenfalls privilegieren das Auge, zumindest wenn es um den Einsatz von Produktionsmitteln geht, aber eben auch intellektuell. Entsprechend wird die Geschichte des Films oft als visuelle Entwicklung erzählt und das Aufkommen des Tons als Störung und Rückfall in ein mediengeschichtlich älteres Register. Aber nicht nur war der Ton immer schon da, mit zum Teil erstaunlichen Soundeffekten und variantenreicher Musik, auch der Übergang zum Synchronton hat das Kino durchaus nicht zu jenem „abgefilmten Theater“ gemacht, das noch heute als Definition für das „Unfilmische“ herhalten muss. In Lucrecia Martels Kino spielt der Ton eine zentrale Rolle; sie spricht vom Akustischen als dem einzigen Element, das den Körper des Zuschauers und nicht nur das Ohr im Wortsinne berührt und umfängt. Ihre Ausführungen, die dieses Heft eröffnen, werfen ein Schlaglicht auf eine vernachlässigte akustische Filmgeschichte, und zugleich auf das „Unerhörte“ und Bahnbrechende ihres Kinos: die Anwesenheit des Unsichtbaren. Und wer weiß, vielleicht lässt sich dieses scheinbare Kino-Paradoxon auch als Klammer gebrauchen, die Texte dieser Ausgabe zu lesen.
Die Redaktion
Nicolas Wackerbarth
Der Morast (La Ciénaga) pendelt immer hin und her zwischen dem Realen und dem Fiktiven. Einer der Protagonisten, der kleine Luciano, muss am Ende sogar sterben, weil er an das Fiktive glaubt. Er stürzt von einer Leiter, als er über eine Mauer schauen will, hinter der er eine afrikanische Riesenratte vermutet. Wie gelingt es dir beim Drehbuchschreiben das Reale und das Fiktive in der Balance zu halten?
Lucrecia Martel
Ich muss sagen, dass ich aufgrund der Wirtschaftskrise von 1989 keine wirkliche filmische Ausbildung hatte. Es war eine Art Wunder, dass ich La Ciénaga geschrieben habe. Das ist mir oft in meinem Leben passiert. Ich habe es gemacht, weil ich gesehen habe, dass andere auch Drehbücher schrieben. Ich hatte viele Notizen mit Fragmenten von Gesprächen in meiner Familie oder Dinge, die Freunde mir erzählt hatten. Und bei diesen Notizen hatte ich das Gefühl, dass es etwas gab, das sie alle verband. Also habe ich ein Drehbuch geschrieben, mit 150 Seiten. Dann kam eine bedeutende Produzentin zu mir, Lita Stantic. Lita war die Produzentin der ersten berühmten Regisseurin Argentiniens, María Luisa Bemberg. Die beiden hatten nach der Militärdiktatur in Argentinien den sehr erfolgreichen Film Camila – Das Mädchen und der Priester (Camila) gemacht und wurden berühmt. Von Salta aus gesehen – die Provinz, in der ich wohne – waren diese zwei Frauen überall zu sehen. In allen Zeitungen, sie wurden in allen Fernsehsendungen interviewt, sie waren überall. Aus Ignoranz dachte ich, dass Kino eine Frauensache sei. Viele Frauen aus meiner Generation saßen einem ähnlichen Trugschluss auf. Dabei haben diese Frauen sehr kämpfen müssen, um ihre Filme zu machen. Lita Stantic hatte meinen Kurzfilm Historias Breves I: Rey Muerto gesehen und fand ihn interessant. Als sie anrief und mich fragte, ob ich einen Langfilm hätte, gab ich ihr das Drehbuch von La Ciénaga, das ihr sehr gut gefallen hat. Bevor ich wusste, ob der Film überhaupt produziert werden würde, hatte ich schon ein Jahr lang in meiner Provinz gecastet. Vielleicht war das eins der wichtigsten Dinge für meinen Lernprozess. Bei uns um die Ecke gab es eine sehr kleine Garage und ich habe im Radio Werbung gemacht, dass ich dort für einen Film casten würde. Gecastet würden Menschen zwischen 5 und 80 Jahren, ab 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends [Gelächter]. So hatte ich das Gefühl, ich gehörte schon zur Filmszene. Ich stand jeden Morgen auf und ging zu der Garage, wo die Menschen bereits in einer langen Schlange anstanden. Dort habe ich die komischsten Situationen erlebt. Eines Tages kam dieser Mann zu mir und sagte: „Ich weiß, dass Sie Geld suchen, um diesen Film realisieren zu können. Meine Frau hat ein Grundstück und ich habe einen Kremationsofen entworfen.“ Sowas gab es in Salta damals nicht. „Das ist ein super Geschäft. Wie viel Geld haben Sie denn bisher?“ Ich habe ihm gesagt: „Ich habe noch gar kein Geld, ich mache dieses Casting, damit jemand auf mich aufmerksam wird.“ Er sagte: „Wenn Sie 40.000 Dollar haben, können wir den Kremationsofen zusammen bauen“ [Gelächter]. Ich antwortete: „Aber auf wie viele Leichen müssen wir warten, damit wir den Film drehen können?“ Das ist nur ein kleines Beispiel für viele komische Situationen. Etliche Leute kamen auch aus einem Krankenhaus in der Umgebung, weil sie ohnehin warten mussten. Es war eine sehr menschliche Erfahrung. Insgesamt kamen um die 4000 Menschen, ich habe alle auf VHS aufgenommen. In dieser Region im Norden Argentiniens reden die Leute sehr gerne und in langen Sätzen, und ich bin mit dieser Lust am Reden aufgewachsen. All dies erzähle ich euch, um auf zu zeigen, wie die narrativen Strukturen meiner Filme aus der mündlichen Erzählform entstehen.
Christoph Hochhäusler
In La Ciénaga gibt es eine Art dreidimensionale Erzählung. Man hat das Gefühl, dass in alle Richtungen erzählt wird, im Vordergrund, im Hintergrund, aber auch im Off geschieht etwas Wichtiges. Es passieren gleichzeitig ganz verschiedene Geschichten. Unser Interesse navigiert unberechenbar, ein wenig gelenkt vom Ton, immer wieder an eine andere Stelle von diesem komplexen Ganzen. Wie schreibt man das? Wie sehr ist das schon geschrieben? Wie sieht so ein Drehbuch aus?





























