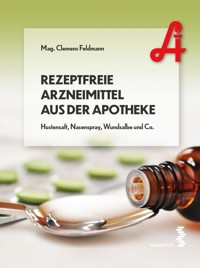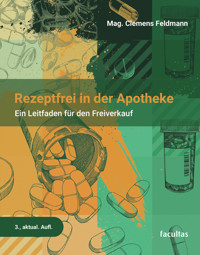
30,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Facultas
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Beratungstätigkeit in jeder Apotheke. Der Autor vermittelt übersichtlich strukturierte und auf den Punkt gebrachte Informationen über die in Österreich aktuell verfügbaren Produkte. Ein einfaches System hilft zu entscheiden, ob und wie eine Selbstmedikation der Patient:innen möglich ist. Es umfasst 56 Themengebiete aus der täglichen Apothekenpraxis die wichtigsten Fragestellungen an Patient:innen Red Flags, die eine Selbstmedikation ausschließen eine Übersicht über die verfügbaren Therapieoptionen Information zu den einzelnen Produktgruppen sowie wertvolle themenbezogene Tipps und Tricks aus der Praxis Das Werk hat sich bereits vielfach in PKA-Berufsschulen als ergänzendes Unterrichtsmaterial zu Ausbildungszwecken und in Aspirant:innenkursen zur Prüfungsvorbereitung im OTC-Bereich bewährt. Es eignet sich somit ideal für die tägliche Arbeit an der Tara, sei es für Auszubildende, Berufseinsteiger:innen oder erfahrene Mitarbeiter:innen in der Apotheke.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 243
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Clemens Feldmann
Rezeptfrei in der Apotheke
Die Empfehlungen in diesem Buch wurden nach bestem Wissen und Gewissen sorgfältig ausgearbeitet. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr.
Der Autor und der Verlag übernehmen keine Haftung für Schäden oder Beschwerden, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Arzneimittel entstehen. Bei Unverträglichkeiten bzw. Verdacht auf stärkere Beschwerden bitte einen Arzt konsultieren.
Wegen stilistischer Klarheit und leichterer Lesbarkeit wurde im Text auf die sprachliche Verwendung weiblicher Formen verzichtet. Die Verwendung der männlichen Form gilt inhaltlich für Frauen und Männer gleichermaßen.
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
3., aktual. Auflage 2025
Copyright © 2019
facultas Universitätsverlag, Facultas Verlags- und Buchhandels AG, Wien, Austria
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung
sowie der Übersetzung, sind vorbehalten.
Umschlagbild: © mecaleha – istockphoto.com
Umschlaggestaltung: Facultas Verlags- und Buchhandels AG
Typografie und Satz: Florian Spielauer, Wien
Druck: Finidr, Tschechien
ISBN 978-3-7089-2564-6 (Print)
ISBN 978-3-99111-958-6 (E-Pub)
Für Emely, Marie, Sophie und Theodor
Vorwort
Als ich vor inzwischen sechs Jahren im Jahr 2018 begann, an der ersten Auflage von Rezeptfrei in der Apotheke zu schreiben, hätte ich nie damit gerechnet, dass es weitere Auflagen von diesem Buch in der Zukunft geben würde. Umso mehr freut mich der große Erfolg meines Werkes in den letzten Jahren. Um die Informationen auf dem letzten Stand zu halten und Feinheiten in den Hinweisen zur richtigen Beratung zu verbessern, erscheint nun die 3., aktualisierte Auflage. Ich hoffe, damit vielen Auszubildenden, sei es im Bereich der PKAs oder Aspiranten, den Einstieg in die Praxis erleichtern zu können und Freude am Beruf zu vermitteln. Besonders dankbar bin ich für alle Art von Rückmeldungen, um weitere Verbesserungen vornehmen zu können. Dazu bitte ich darum, mich jederzeit über meine Internetauftritte auf Facebook, Instagram oder LinkedIn, oder einfach per Mail zu kontaktieren.
Ich wünsche allen Leserinnen und Lesern viel Freude beim Studieren der 3. Auflage!
Mag. Clemens [email protected]
Stand: 01. 12. 2024
Inhalt
Beratungsgespräch
Erläuterung zum Aufbau der Einzelkapitel
Krankheitsbilder
1 Akne
2 Aphten
3 Augen, gereizte
4 Blähungen
5 Bluterguss
6 Blutfette
7 Durchfall
8 Erkältung
9 Fieber
10 Fieberblasen
11 Fußpilz
12 Gelenkschmerzen
13 Haarausfall
14 Halsschmerzen
15 Hämorrhoiden
16 Handdesinfektion
17 Harnwegsinfekt
18 Haut, trockene
19 Heiserkeit
20 Heuschnupfen
21 Husten
22 Immunstärkung
23 Insektenstiche
24 Intoleranzen
25 Kopfschmerzen
26 Läuse
27 Müdigkeit
28 Muskelkrämpfe
29 Nagelpilz
30 Nägel, brüchige
31 Narben
32 Nase, trockene
33 Nervosität, Unruhe und Stress
34 Ohrenpflege
35 Ohrenschmerzen
36 Pille danach
37 Regelbeschwerden
38 Reisekrankheit
39 Rückenschmerzen
40 Schlafstörungen
41 Schnupfen
42 Schwindel
43 Schwitzen
44 Sodbrennen und Magenschmerzen
45 Sonnenbrand
46 Tattoo
47 Übelkeit und Erbrechen
48 Übergewicht
49 Vaginalpilz
50 Venenschwäche
51 Verstopfung
52 Warzen
53 Wechseljahrsbeschwerden
54 Zahnfleischentzündung
55 Zahnschmerzen
56 Zahnungsbeschwerden
Quellenangaben und weiterführende Literatur
Sachregister
Über den Autor
Danksagung
Beratungsgespräch
Die hier abgebildeten Organigramme haben sich grob am Leitfaden für Beratungsgespräche für die Selbstmedikation der deutschen Bundesapothekerkammer orientiert. Auch in Österreich besteht die Pflicht für in der Apotheke angestellte Personen, die zu betreuenden Patienten persönlich zu beraten. Ganz abgesehen von den gesetzlichen Verpflichtungen ist eine gute Beratung in der Apotheke deren Daseinsberechtigung in der Öffentlichkeit. Deswegen sollte besonderer Wert auf einerseits fachlich hochwertige und andererseits auf den Kunden menschlich eingehende Beratung gelegt werden. Gerade in Zeiten, in denen Versandapotheken im Internet die klassischen stationären Apotheken zu verdrängen versuchen, ist dies eines unserer wichtigsten Alleinstellungsmerkmale.
Wer ist der Patient? Ist das Medikament für Sie?
Diese Frage ist trotz ihrer Einfachheit eine der wichtigsten. Oft kommen Patienten mit einem konkreten Wunsch in die Apotheke oder schildern Symptome. Für sie ist es selbstverständlich, welche Person damit gemeint ist. Für die beratende Person ist dies jedoch nicht zu erkennen. Stellt man diese Frage nicht, so kann es zu schwerwiegenden Verwechslungen kommen. Beispielsweise könnten vollkommen ungeeignete Arzneimittel für Kinder, Schwangere oder ältere Personen empfohlen werden.
Welche Beschwerden haben Sie genau?
In diesem Abschnitt des Beratungsgespräches will man möglichst viel über die Beschwerden des Patienten erfahren. Es empfiehlt sich offene W-Fragen (wie lange, wie häufig, wie stark?) zu stellen, die nicht mit Ja oder Nein beantwortet werden können. Der Patient wird ermutigt, umfassender über seinen Gesundheitszustand zu berichten und erleichtert so die Auswahl des optimalen Arzneimittels. Bei länger andauernden und/oder starken und/oder nicht alltäglichen Beschwerden ist besondere Vorsicht geboten.
Haben Sie gegen die Beschwerden schon etwas unternommen?
Diese Frage ist wichtig, um die eigene Empfehlung auf etwaige Vortherapien abzustimmen. Man kann auch besser beurteilen, ob eine weitere Therapie noch sinnvoll ist oder ob Wechselwirkungen oder verstärkte Nebenwirkungen mit bereits angewendeten Arzneimitteln auftreten könnten.
Auswahl des Arzneimittels
Hier kann auf die individuellen Wünsche und Vorlieben des Patienten eingegangen werden. Wünscht er lieber Zubereitung in flüssiger oder fester Form? Wünscht er eine Behandlung mit klassischer Schulmedizin oder neigt er eher zu komplementären Heilungsverfahren? Ist der Patient zu Hause oder muss er einer Tätigkeit nachgehen, die uneingeschränktes Reaktionsvermögen erfordert? Diese oder auch viele andere Fragen helfen dem Patienten seine individuell maßgeschneiderte Therapie zusammenzustellen. Hier ist Wissen, Kreativität und Einfühlungsvermögen gefragt, um den Patienten vollends zufrieden zu stellen und einen optimalen Heilungsverlauf zu gewährleisten.
Informationen zum Arzneimittel
Der Patient muss genau über die Einnahme aufgeklärt werden. Welche Zeitpunkte müssen eingehalten werden? Welcher Abstand zum Essen ist einzuhalten? Welche Neben- und Wechselwirkungen sind zu erwarten? Nur bei optimalem Einnahmeverhalten (Compliance) ist auch eine optimale Wirkung zu erwarten. Auch eine Fristsetzung bezüglich eines möglichen Arztbesuches ist wichtig, falls sich die Beschwerden nicht bessern sollten.
Unterstützende Maßnahmen
Abschließend hat es sich bewährt, gute Ratschläge und Tipps mitzugeben. Kostenlose Möglichkeiten wie Hausmittel, Tees, die man oft zu Hause hat, oder Verhaltensänderungen werden gerne angenommen und vermitteln ein besonderes Interesse am Wohlergehen des Patienten.
Abgabe des Arzneimittels
Abschließend bietet man noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen, die vielleicht im Laufe des Gespräches vergessen wurden. Ist dies nicht der Fall, zeigt die Bitte um Mitteilung des Heilungserfolges, wie die im vorigen Punkt angesprochenen Ratschläge, ein besonderes Interesse am Kunden. Jemand, der sich gut umsorgt und aufgehoben fühlt, besucht Sie sicher wieder gerne in der Apotheke und hat das nötige Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. Ein abschließender freundlicher Genesungsgruß im Zuge der Verabschiedung rundet das gelungene Beratungsgespräch ab und vermittelt Hoffnung auf baldige Besserung.
Erläuterung zum Aufbau der Einzelkapitel
Farbcodierung zu Beginn der einzelnen Kapitel
Nahrungsergänzungsmittel, Medizinprodukte vorhanden
Arzneimittel vorhanden
Abkürzungen
AT
Augentropfen
ml
Milliliter
AuGel
Augengel
ML
Messlöffel
AuSlb
Augensalbe
NaSpray
Nasenspray
Blsm
Balsam
NaTr
Nasentropfen
Btl
Beutel
Past
Pastillen
Cr
Creme
Pfl
Pflaster
Drg
Dragees
Plv
Pulver
Emuls
Emulsion
Sft
Saft
Ftbl
Filmtabletten
Slb
Salbe
Gel
Gel
Sir
Sirup
Glb
Globuli
SchmTbl
Schmelztabletten
Gran
Granulat
Supp
Suppositorien
Kps
Kapseln
Susp
Suspension
Ktbl
Kautabletten
Tbl
Tabletten
Lsg
Lösung
Tr
Tropfen
Ltbl
Lutschtabletten
WKps
Weichkapseln
Krankheitsbilder
1 Akne
Akne ist die weltweit am häufigsten auftretende Hauterkrankung. Sie stellt eine Verhornungsstörung im Bereich der Talgdrüsen dar. In etwa 80 % der Jugendlichen sind in der Pubertät davon betroffen. Akne kann jedoch über das Jugendalter hinaus bestehen bleiben oder erst im Erwachsenenalter erstmalig auftreten. Der Verlauf ist insbesondere bei der jugendlichen Form mehrheitlich mild (ca. 60 % der Betroffenen) und eine ärztliche Behandlung nicht notwendig.
Akne entsteht durch Verstopfung der Talgdrüsen durch Hautpartikel und/oder Fett. Diese wird durch eine erhöhte Talgproduktion der Talgdrüsen selbst sowie durch eine Verhornungsstörung der Haut ausgelöst. Das Bakterium Cutibacterium acnes (C. acnes), früher auch als Propionibacterium acnes (P. acnes) bezeichnet, siedelt sich in den betroffenen Bereichen an und führt vor allem im fortgeschrittenen Stadium der Akne zur verstärkten Entzündung der Talgdrüsen. Die häufigsten Ursachen sind mit über 80 % genetische Faktoren sowie Störungen im Hormonhaushalt, insbesondere durch Androgene in der Pubertät oder während des Menstruationszyklus oder der Schwangerschaft. Diese können durch klimatische Gegebenheiten wie UV-Strahlung und Luftfeuchtigkeit verstärkt werden. Auch hoher Blutzuckerspiegel, bestimmte Fette oder das Rauchen wirken sich durch die entzündungsfördernde Wirkung negativ auf den Akneverlauf aus. Nicht zu vergessen sind zahlreiche aknefördernde Arzneimittel wie Glucocorticoide, Androgene oder hochdosierte B-Vitamine.
Tritt während der Pubertät eine gewöhnliche Akne (Acne vulgaris) auf, unterscheidet man, je nach klinischer Ausprägung und Schweregrad, drei Typen: Acne comedonica, Acne papulopustulosa und Acne conglobata. Dabei sind die Übergänge fließend. Bei der Acne comedonica handelt es sich meist um milde Formen der Akne, bei denen das Vorkommen von Komedonen im Vordergrund steht, die, wenn überhaupt, von nur wenigen Papeln begleitet sein können. Komedonen, zu Deutsch Mitesser, sind durch einen pfropfenartigen, oberflächlichen Verschluss der Talgdrüse gekennzeichnet. Eine Papel ist eine erbsengroße Verdickung der Haut mit meist darunterliegenden Eiterherden. Stehen Papeln und Pusteln im Vordergrund, handelt es sich meist um leichte bis mittelschwere Formen, sogenannte Acne papulopustulosa. Als Pustel wird ein mit Eiter gefüllter oberflächlicher kleiner Hohlraum bezeichnet. Schwere und schwerste Formen sind durch das Vorkommen von Knötchen, Knoten und Fisteln gekennzeichnet. In diesen Fällen liegt eine Acne papulopustulosa nodosa oder sogar eine Acne conglobata vor.
Ergänzungssortiment
Kosmetika Pelcure® Cr
Biretix® – Serie
Cisderm® Cr
La Roche Effaclar® – Serie
Vichy Normaderm® – Serie
Widmer Skin Appeal® – Serie
Mikronährstoffe
Steinmandl® Schöne Haut Kps, 1×1
Viva Skin® Akne Caps, 2×1
Arzneimittel
Natriumbituminosulfat + Salicylsäure
Aknichtol® Lotio, 2× täglich
Zink
Zinkorotat-Pos® Ftbl 40 mg, 3×1
WW: Eisen, Phosphor, Kupfer und Calcium reduzieren die Aufnahme von Zink. Achtung bezüglich Wirkungsverminderung bei der Einnahme von Tetrazyklinen, Chinolonen, Schilddrüsentherapeutika, Bisphosphonaten.
Phytinreiche Lebensmittel wie Vollkorngetreideprodukte und Mais vermindern die Aufnahme von Zink.
Kosmetische Anwendung
Eine effiziente Behandlung von Akne in der Selbstmedikation beruht auf einer gezielten 2-mal täglichen Reinigung und Pflege der betroffenen Areale und eventuell einer unterstützenden Einnahme von Mikronährstoffen. Die Reinigung der Haut sollte möglichst schonend und unter Verwendung von Syndets und Einmalwaschlappen erfolgen. Hier stehen Produkte verschiedener Kosmetikhersteller in Form von Lotionen, Gels oder Schäumen zur Verfügung. Das zur Nachreinigung und Entfernung des Talges benutzte Gesichtstonikum sollte einen Alkoholgehalt von maximal 5–10 % aufweisen, da es sonst zu stark entfettend wirkt. Anschließend sollte eine hautpflegende Creme verwendet werden. Diese besteht meist aus einer hydrophilen Salbengrundlage, der Silber, Benzoylperoxid, Salicylsäure, Teebaumöl oder andere antibakteriell wirksame Substanzen zugesetzt sind. Die Wirkung von Benzoylperoxid (BPO) beruht auf der Freisetzung freier Radikale und Kunden sollten darauf hingewiesen werden, dass es aufgrund seiner Oxidationskraft ein starkes Bleichmittel ist und somit auf Kleidung, Haaren, Bettwäsche etc. Flecken hinterlassen kann. Benzoylperoxid verstärkt die Lichtempfindlichkeit, weshalb es vorzugsweise abends verwendet wird. Salicylsäure löst als Schälmittel vorhandene Komedonen auf und bewirkt durch Lockerung der Hornsubstanz die Bildung neuer Hautzellen. Sie hat auch entzündungshemmende und antiseptische Eigenschaften. Teebaumöl wirkt antibakteriell. Zu beachten ist seine reizende und allergieauslösende Wirkung. Letztere wird besonders durch das in gealtertem Öl enthaltene p-Cymen ausgelöst. Der Alterungsprozess beginnt schon wenige Tage nach dem Öffnen durch Kontakt mit Sauerstoff, der in der Luft enthalten ist. Als Schälmittel wird zudem seit langem Schieferöl (Natriumbituminosulfonat) verwendet. Sein Wirkmechanismus ist jedoch nicht genau bekannt und es können Hautreizungen auftreten. Auch Produkte mit schwachen Säuren wie z. B. Fruchtsäuren, Glykolsäure, Milchsäure und Salicylsäure werden aufgrund ihres nachgewiesenen komedolytischen Effekts angewendet. Verschiedene Peelings zum Abtragen der obersten Hautschichten sollten maximal 1–2 mal pro Woche unterstützend angewendet werden.
Mikronährstoffe
Der entscheidende Mikronährstoff bei der unterstützenden Behandlung von Akne ist sicherlich Zink. Es weist antiandrogene Effekte und antibakterielle sowie talgreduzierende Eigenschaften auf. Die optimale Anwendungsdauer beträgt mindestens einen, besser jedoch drei Monate. Der optimale Einnahme-Zeitpunkt ist abends vor dem Schlafengehen, mit etwas Abstand zu anderen Mikronährstoffen. Betacarotin, Vitamin A und B-Vitamine unterstützen die Zellteilung der Haut und werden daher gerne in Mikronährstoffmischungen verwendet.
Tipps aus der Praxis
Frühzeitiger Behandlungsbeginn.
Einmalreinigungstücher bei der Hautpflege verwenden und keine aggressiven Hautreinigungsprodukte verwenden.
Mitesser nicht selbst öffnen.
Einzelne Mitesser können mit kosmetischen Abdeckstiften überdeckt werden.
Gesunder Lebensstil mit ausgewogener Ernährung, ausreichend Flüssigkeitszufuhr und viel Bewegung. Wenig Zucker und gesättigte Fettsäuren. Vorzugsweise Vollkornprodukte statt Weißmehl und Omega-3-Fettsäure-reichen Seefisch statt Fleisch verwenden.
UV-Strahlung wirkt aknefördernd. Daher immer hohen Sonnenschutz auf Wasserbasis in Gel- oder Fluidform verwenden und die Sonne so gut wie möglich meiden.
Sollte die Akneerkrankung zu belastend sein, eine Kosmetikerin oder bei schwereren Fällen ärztliche Hilfe suchen.
2 Aphten
Aphten sind kleine Geschwüre, die auf der Mundschleimhaut zu finden sind. Sie sind in etwa linsengroß und ihre Oberfläche ist weiß-gelblich gefärbt, meist von einem roten entzündeten Rand umgeben. Zunächst bemerkt man meist ein brennendes Gefühl im Mund, dann bilden sich schmerzende Bläschen, die dann in ein flaches Geschwür übergehen. Die Ursachen, warum sich Aphten bilden, sind unklar. Es gibt jedoch Umstände, die die Entstehung fördern. Mechanische Belastungen wie beispielsweise schlechtsitzende Prothesen, Zahnspangen, aber auch nicht optimal liegende Zähne oder falsche Zahnpflege sind mögliche Ursachen für Aphten. Lebensmittel wie Erdbeeren, Zitrusfrüchte, Paradeiser, Nüsse, Hartkäse und Schokolade können sich ebenfalls negativ auswirken. Besonders hervorzuheben sind hier histaminreiche Lebensmittel. Allgemeine Immunschwäche, bestimmte blutgerinnungshemmende Arzneimittel, Schmerzmittel und Mangelzustände an Folsäure, Vitamin B12, Zink und Eisen sowie hormonelle Schwankungen (Schwangerschaft, Menopause) sind weitere häufig beobachtete Faktoren, die die Aphtenbildung begünstigen.
Aphten können starke Schmerzen auslösen, die durch eine Infektion der betroffenen Stellen mit Bakterien hervorgerufen wurden. Daher ist besonderer Wert auf gute Mundhygiene zu legen. Der Schmerz ist nicht davon abhängig, wie groß die Aphte ist, sondern wo sie lokalisiert ist. Das Essen und der Schluckvorgang können durch Aphtenbildung stark eingeschränkt werden. Die Abheilung erfolgt überlicherweise nach 7–10 Tagen.
Ergänzungssortiment
Hyaluronsäure
Bloxaphte® Oral Care Mundgel, Gel, 2–3× täglich nach dem Essen
Gengigel® Gel, Gel, 3–5× täglich
Pflanzliche Tinkturen
Myrrhe
Ratanhia
Salbei
Arzneimittel
Pflanzliche Arzneimittel
Kamille
Kamillosan® Flüssigkeit, Mundspray, 3× täglich verdünnt, 3×2 Sprühstöße
Rharbarberwurzel
Pyralvex® pur Lsg, 3× täglich anwenden
Salbei + Dexpanthenol
Veralgin® Mund- und Zahnfleischspray, mehrmals
Thymian + Salbei
Bronchostop® direkt Hals- und Rachenspray, 2–4× 1–2 Sprühstöße
Antiseptika
Benzydamin
Tantum® Verde Lsg, Ltbl, MuSpray, 2–3× täglich spülen, 3–4× täglich lutschen
Povidon Iod
Betadona® Mund Antiseptikum Lsg, 1 : 8–16 verdünnt alle 1–4 Stunden
Chlorhexidin
Chlorhexamed® Forte alkoholfrei Lsg, 2× täglich nach dem Essen Chlorhexamed® 1 % Gel, Gel, 1–2× täglich 2,5 cm Gel einbürsten
Dequaliniumchlorid
Dequonal® Lsg, 2–4× 1 EL spülen und gurgeln
Hexetidin
Hexoral® Lsg, 2× täglich spülen und gurgeln
Ocetangin® antisept LTbl, –6×1
Wasserstoffperoxid 3%
Magistrale Zubereitung, 3–4× täglich 1 EL spülen
Lokalanästhetika
Cholinsalicylat
Mundisal® Gel, Gel, 3–4× täglich 1cm auftragen
Lidocain
Dynexan® Mundgel, 4× täglich erbsengroß auftragen
Easyangin® Spray, 6–10× 3–5 Sprühstöße
Polidocanol
Recessan® Slb, 3–5× täglich erbsengroß auftragen
Polidocanol + Kamille + Lidocain
Dentinox® Gel, 2–3× erbsengroß auftragen und einmassieren
Hyaluronsäure
Hyaluronssäure bildet einen Schutzfilm auf der gereizten und entzündeten Schleimhaut und hält so Bakterien von der betroffenen Stelle fern. Dies verhindert schmerzhafte Sekundärinfektionen und unterstützt den Heilungsprozess.
Pflanzliche Tinkturen
Pflanzliche Tinkturen fördern die Erneuerung der Mundschleimhaut durch ihren adstringierenden Effekt (Rathania, Myrrhe) beziehungsweise lindern zusätzlich vorhandene Entzündungen (Kamille) oder verfügen über beide Eigenschaften (Salbei, Rharbarber).
Antiseptika
Antiseptika senken die Keimbelastung im Mundraum und beugen so Sekundärinfektionen vor. Sie werden mehrmals täglich insbesondere nach den Mahlzeiten eingesetzt.
Lokalanästhetika
Lokalanästhetika wirken lokal schmerzstillend und ermöglichen so eine schmerzverminderte Nahrungsaufnahme. Eine interessante Variante bietet der Easyangin® Spray, der mit den Wirkstoffen Lidocain und Chlorhexidin antiseptische und lokalanästhetische Wirkungen vereint.
Tipps aus der Praxis
Bei gut zugänglichen Aphten werden oft Pinselungen oder Tinkturen zum Auftupfen empfohlen. Sind die Aphten schlechter zugänglich, sollte man eher zu Spülungen greifen.
Reizende Speisen (sauer, scharf, heiß, salzig, hart) vermeiden.
Säurehaltige Fruchtsäfte (Zitrusfrüchte) vermeiden.
Verzicht auf Alkohol und Nikotin.
Immunsystem stärken. Siehe Immunstärkung S. 128.
Mangelzustände durch Blutbild bestimmen und ausgleichen.
Das Lutschen von Lutschtabletten, die gegen Halsschmerzen eingesetzt werden, bringt Linderung und kann die Keimbelastung reduzieren.
3 Augen, gereizte
Der größtenteils in den Tränendrüsen erzeugte Tränenfilm bildet eine Flüssigkeitsschicht, die den vorderen Teil des Augapfels bedeckt und über die ableitenden Tränenwege in die Nasenhöhle abfließt. Er schützt das Auge und wirkt als Schmierstoff zwischen Augapfel und Lid. Weiters versorgt er die gefäßlose Hornhaut mit Sauerstoff. Ist dieser Tränenfilm im Aufbau oder in der Zusammensetzung gestört, sind Störungen der Benetzung die Folge, was wiederum zu einem trockenen Auge, auch als Sicca Syndrom bezeichnet, führt. Charakteristische Beschwerden sind Jucken, Brennen, Rötung und Fremdkörpergefühl. Das Auge produziert täglich bis zu zwei Milliliter Tränenflüssigkeit. Diese bildet den auf der Hornhaut liegenden Tränenfilm, der aus drei Schichten besteht. Die äußerste Schicht wird als Lipidschicht bezeichnet. Diese verhindert die Verdunstung und bildet eine glatte Oberfläche. Die mittlere Schicht ist wässrig und transportiert Fremdkörper ab. Die unterste Mucinschicht liegt direkt an der Hornhaut an und bildet den stabilen Untergrund für die beiden oberen Schichten. Durch das Schlagen der Lider alle 5 bis 10 Sekunden wird der Tränenfilm gleichmäßig über das Auge verteilt. So ist sichergestellt, dass das Auge nicht austrocknet, die Oberfläche des Augapfels gereinigt wird und so eine optimale Sehfunktion hergestellt wird. Beim trockenen Auge kann auch ein übermäßiges Tränen auftreten, weil das Auge einen Mangel oder eine falsche Zusammensetzung des Tränenfilms auszugleichen versucht.
Ein trockenes Auge kann viele Ursachen haben. Neben bestimmten Erkrankungen ist jedoch meistens eine Veränderung der Tränenfilmzusammensetzung ausschlaggebend. Meist ist die äußere Lipidschicht betroffen, seltener die wässrige mittlere Schicht. Der Tränenfilm reißt früher auf und führt so zu bekannten Beschwerden wie Brennen, Jucken, Rötung und Fremdkörpergefühl. Die Ursachen sind meist umweltbedingt, wie langer Aufenthalt in geheizten oder klimatisierten Räumen oder verminderter Lidschlag durch zu langes Arbeiten an Bildschirmen. Aber auch der Mangel an verschiedenen Nährstoffen wie Vitamin A oder ungesättigten Fettsäuren kann eine Rolle spielen. Wichtig ist es auch, nicht auf Arzneistoffe zu vergessen, die ein trockenes Auge begünstigen können. Dazu zählen beispielsweise hormonelle Kontrazeptiva, Betablocker oder trizyklische Antidepressiva (z. B. Trimipramin®, Saroten®).
Ergänzungssortiment – Haltbarkeiten ab Anbruch
Augentrost + Hyaluronat + Methocel®
Herba Vision® AT MD sine AT, bei Bedarf 2 Tr, Haltbarkeit 90 Tage
Blaubeertinktur + Hyaluronat + Methocel®
Herba Vision® AT, bei Bedarf, 2 Tr, Haltbarkeit 90 Tage
Carbomer
Artelac Nighttime® Gel, bei Bedarf, Haltbarkeit 12 Wochen
Carmellose + Glycerol
Optive® AT, ED, bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Carmellose + Glycerol + Hyaluronsäure
Optive Fusion® AT, ED, bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Carmellose + Glycerol + Rizinusöl
Optive plus® AT, ED, bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Carmellose + Glycerol + Erythritol + Levocarnitin
Optive Gel Drops® AT, ED, bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Dexpanthenol
Siccasan® AuGel, 3–5× täglich und vor dem Schlafen gehen 1 Tr Gel, Haltbarkeit 6 Wochen nach Anbruch
Hyaluronsäure
Artelac Splash® AT, ED, bei Bedarf, Haltbarkeit 12 Wochen
Genteal® HA AT, ED, 1–2 Tr bei Bedarf, Haltbarkeit 12 Wochen
Hyabak® AT, 3×1 Tr, Haltbarkeit 6 Monate
Hylo Commod® AT, 3×1 Tr + bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Hylo Gel® Gel, 3×1 Tr + bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Hyaluronsäure + Dexpanthenol
Bepanthen® AT, ED bei Bedarf, Haltbarkeit 12 Monate (Multidosenbehälter)
Hylo Care® AT, 3×1 Tr + bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Hyaluronsäure + Ectoin
Hylo Dual (intense)® AT, 3×1 Tr + bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Hyaluronsäure + Euphrasia
Hylo Fresh® AT, 3×1 Tr + bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Hyaluronsäure + Heparin
Hylo Parin® AT, 3×1 Tr + bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Hyaluronsäure + Hydrocortison
Idroflog® AT, ED, 2–4× 1–2 Tr unter fachärztlicher Kontrolle
Hyaluronsäure + Macrogol + Cyanocobalamin + Calcium, Magnesium, Kaliumchlorid
Arthelac Rebalance® AT, ED, bei Bedarf, Haltbarkeit 12 Wochen
Hyaluronsäure + Trehalose
Thealoz Duo® AT, Gel, 4–6× 1 Tr, Haltbarkeit 3 Monate
Hyaluronsäure + Trehalose + NAAGA
Thealoz Total® AT, 3–6× 1 Tr, Haltbarkeit 3 Monate
Hypromellose
Arthelac® AT, ED, bei Bedarf, Haltbarkeit 12 Wochen
Liposomen – bei geschlossenen Augen anwenden Tears
Again® Spray, bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Okuzell® Spray, bei Bedarf, Haltbarkeit 8 Wochen
PEG
Systane® AT, bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Perfluorohexyloctane (Eyesol®) (+Omega 3)
Evotears® AT, bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Vitamin A
Hylo Night® AuSlb, bis 3×1 bei Bedarf, Haltbarkeit 6 Monate
Oleovital® AuSlb, 3×1, Haltbarkeit 3 Monate
Arzneimittel
Befeuchtung und Reizlinderung
Carbomer
Aqua Tears® AuGel, 4×1 Tr oder häufiger
Dexpanthenol
Bepanthen® Augen- und Nasensalbe, 1 bis mehrmals täglich
Hypromellose + Vitamin A
Oculotect® Fluid AT, 4×1 Tr oder häufiger
Prosicca® AT, 3–5× 1 Tr einträufeln
Polyvinylalkohol + Dexpanthenol
Siccaprotect® AT, 6×1 Tr evtl. stündlich
Gefäßzusammenziehend
Naphazolin
Aconex® 0,1 % AT, 1–2× 1–2 Tr, max. 2 Tage
Coldan® AT, 1–2 Tr im Abstand von 4 h
Ophtaguttal „Agepha“® AT, 6–8× 2–3 Tr, max. 18 Tr
KI: Keratokonjunktivitis sicca, Rhinitis sicca, schwere Hypertonie, Engwinkelglaukom, nach chirurgischen Eingriffen am Auge oder im Kopfbereich (Freilegung der Dura mater), Kinder unter 2 Jahren, Thyreotoxikose
WW: KI: Tri- und Tetracyclische Antidepressiva, MAO-Hemmer (2 Wochen Abstand), Vorsicht: ZNS dämpfende Arzneimittel verstärkt, Theophyllin, Reserpin, Guanethidin, Sympathomimetika und -lytika.
Befeuchtung und Reizlinderung
Zur vorbeugenden Gesunderhaltung des Auges, aber auch zur Behandlung leichter akuter Beschwerden werden verschiedene Tränenersatzflüssigkeiten in flüssiger oder in Gelform angewendet. Diese enthalten filmbildende, in unterschiedlichem Ausmaß viskositätserhöhende Substanzen, die den Tränenfilm stabilisieren. Die am häufigsten verwendete ist sicherlich die Hyaluronsäure. Sie ist eine körpereigene Substanz und dadurch sehr gut verträglich. Aufgrund der Ähnlichkeit mit den Mucinen (Schleimstoffen) des körpereigenen Tränenfilms haftet die Hyaluronsäure sehr gut an der Augenoberfläche. Der Tränenfilm wird stabilisiert, die Tränenaufrisszeit und Verweildauer im Auge erhöht. Hyaluronsäure wirkt weiters antioxidativ, schützend und wundheilend auf die Hornhaut. Die genannten positiven Eigenschaften stellen sich ab einer Konzentration von 0,1 % ein. Eine Kombination mit PEG 8000 erhöht die Befeuchtungswirkung der Hyaluronsäure zusätzlich. Weitere Substanzen in wässrigen Tränenersatzmitteln wären PVA (Polyvinylalkohol) und PVP (Povidon). Sie sind wenig viskos und können bei sehr leichten Beschwerden eingesetzt werden. Celluloseverbindungen wie Carmellose oder Hypromellose wirken ähnlich bei etwas längerer Wirkdauer. Carbomere sind ebenfalls etwas viskoser als PVA und PVP und ähneln den Mucinen der innersten Schicht des Tränenfilms. Sie werden hauptsächlich in Augengelen verwendet. Neben den wässrigen Tränenersatzflüssigkeiten bieten sich auch lipidhaltige Varianten an. Diese sind in Augentropfenform mit mittelkettigen Triglyceriden (MCT) oder Glycerol erhältlich. Eine effiziente Möglichkeit sind auch Lidsprays. Diese enthalten Phospholipide (Sojalecithin) und werden mit in etwa 10 cm Abstand auf die geschlossenen Augenlider aufgesprüht. Die im Spray enthaltenen Phospholipide sind in Liposomen verpackt, welche über die Ränder der Augenlider in die äußere Lipidschicht des Auges gelangen und dort ihre filmstabilisierende Wirkung entfalten. Liegt ein Lipidmangel des Tränenfilms vor, ist es zusätzlich sinnvoll, die Lidränder zu behandeln. Dazu sollten zweimal täglich feuchte warme Kompressen (z. B. Wattepads) 5 bis 10 Minuten auf die geschlossenen Augenlider gelegt werden, wodurch das Sekret der Lipid-produzierenden Drüsen verflüssigt wird. Anschließend wird dieses durch Massage der Augenlider entfernt und die Lidränder gereinigt. Danach sollen die besprochenen Tränenersatzmittel angewendet werden. Es gibt auch spezielle Pflegeprodukte zur Reinigung der Lidränder.
Aus der Pflanzenheilkunde bietet sich der Augentrost (Euphrasia) an. Das in ihm enthaltene Aucubin wirkt entzündungshemmend. Seine augenberuhigende Wirkung ist seit Jahrhunderten aus der Volksheilkunde bekannt. Eine eigene Wirkklasse bilden Augentropfen mit Perfluorohexyloctane. Sie sind wasserfrei und legen sich wie eine Lipidschicht über die Wasserphase der Tränenflüssigkeit und verhindert so ihr verdunsten.
Ein weiteres Produkt, das etwas von der üblichen Zusammensetzung abweicht, enthält zusätzlich zur Hyaluronsäure Hydrocortison in 0,001 % Konzentration. Dies soll insbesondere Brennen, Jucken und Rötungen zusätzlich lindern und wegen der sehr niedrigen Dosierung auch zur Langzeitanwendung geeignet sein. Der Hersteller empfiehlt jedoch eine Anwendung unter fachärztlicher Aufsicht.
Gefäßzusammenziehende Wirkstoffe
Insbesondere bei leichter Rötung und Tränenfluss sind sogenannte Vasokonstringenzien den Tränenersatzflüssigkeiten überlegen. Sie erleichtern den Tränenabfluss und bewirken eine Verminderung der Rötung der Bindehaut durch das Zusammenziehen der Blutgefäße. Sie dürfen jedoch nur maximal 72 h angewendet werden. Eine gemeinsame Anwendung mit Kontaktlinsen ist nicht möglich. Auch die große Anzahl an Gegenanzeigen und das hohe Wechselwirkungspotenzial sind zu beachten.
Tipps aus der Praxis
Haltbarkeiten beachten. Am besten nach dem Öffnen das Datum auf der Packung notieren.
Beim Aufenthalt im Freien eine Sonnenbrille als Schutz vor UV-Strahlung, Wind und Staub verwenden.
Die Anwendung von mehreren Tropfen pro Auge (außer bei bewussten Spülungen) ist sinnlos, da das Auge nur einen Tropfen fassen kann.
Zwischen der Anwendung von verschiedenen Augentropfen wird ein empfohlener Abstand von 5–15 Minuten angegeben. Bei der kombinierten Anwendung von Augentropfen, Augengelen und -salben werden 30 Minuten Abstand empfohlen.
Genügend Schlaf zur Regeneration des Auges. Keine Arbeiten vor Bildschirmen, oder diese zumindest regelmäßig unterbrechen. Augen oft bewusst schließen. Hilfreich kann hier die 20–20–20 Regel sein. Alle 20 Minuten sollten man 20 Sekunden den Blick vom Bildschirm abwenden und in ungefähr 20 Fuß (6 Meter) Entfernung ein Objekt gezielt anschauen. Das entspannt die Augenmuskulatur und erhöht die Anzahl an Lidschlägen. Dadurch kann der Tränenfilm besser verteilt werden.
Kein Reiben an den Augen.
Luftfeuchtigkeit in Innenräumen erhöhen.
Kühle Auflagen für die Augen verwenden.
Bei Problemen beim Eintropfen bietet sich die kanthale Applikation an. Man legt sich waagrecht hin und tropft bei geschlossenem Auge einen Tropfen in den Augenwinkel. Beim Öffnen verteilt sich der Tropfen im Auge.
4 Blähungen
Ungefähr 20 % der Erwachsenen leiden unter Blähungen, wobei Blähung ein sehr oberflächlicher Begriff ist. Viele Patienten bezeichnen auch Völle- und Spannungsgefühl als Blähung. Hierfür ist die genaue Bezeichnung jedoch Meteorismus. Wieder andere Patienten bezeichnen Luftansammlungen im Darm, die als Winde abgehen, als Blähungen. Hier lautet der Fachbegriff Flatulenz. Da beide Beschwerden vielfältige Ursachen haben und auch oft in Kombination auftreten, ist eine Unterscheidung schwierig. Beiden gemein ist, dass fast immer ein Ungleichgewicht in der Verdauung besteht. Die Nahrung wird nicht vollständig verdaut und weitertransportiert. Dadurch gelangen unverdaute Nahrungsbestandteile in tiefere, für sie nicht vorgesehene Darmabschnitte, wo sie von den dort anzutreffenden Bakterien unter Bildung von Gas verstoffwechselt werden. Späte üppige Mahlzeiten und Stress wirken verstärkend auf dieses Ungleichgewicht. Durch die ständige Aktivierung des sympathischen Nervensystems ist der unter anderem für die Verdauung zuständige Gegenspieler, der Parasympathikus, nicht ausreichend aktiv. Eine weitere Personengruppe, die häufig unter Blähungen und Völlegefühl leidet, sind Personen mit funktionellen Verdauungsstörungen. Hier treten die Beschwerden oft schon nach kleinen Mahlzeiten in Verbindung mit Schmerzen und Krämpfen auf. Als funktionelle Verdauungsstörungen bezeichnet man solche Beschwerden, für die keine organische Ursache gefunden werden kann. Oft spricht man auch von Reizdarm oder Reizmagen. Weitere Ursachen für Blähungen und Völlegefühl können eine zu hohe Aufnahme von Luft in den Körper sein, beispielsweise durch zu schnelles Essen, Kaugummikauen oder kohlensäurehaltige Getränke. Auch blähende Lebensmittel wie Bohnen, Kohlgemüse, Knoblauch und ofenfrisches Brot sowie Lebensmittelunverträglichkeiten (Lactose, Fructose etc.) spielen oft eine Rolle. Eine bakterielle Fehlbesiedlung – zum Beispiel nach Antibiotikagabe, Enzymmangelzuständen, hormonellen Veränderungen in der Schwangerschaft oder Übergewicht – sind ebenfalls ursächlich.
Ergänzungssortiment
Ätherische Öle
Gaspan 90 mg/50 mg Wkps, 2×1 30 min vor der Mahlzeit
Entschäumer
Lefax FlKps, Gran, bis 4×1 je nach Indikation
Papayaenzyme
Caricol® Sticks, 1×1 nach der Hauptmahlzeit
Tees,3–4 Tassen täglich
Anis, Kümmel, Fenchel
Tinkturenkombinationen
Carmol® Tr, 10–20 Tr mehrmals
Arzneimittel
Entschäumer
Simeticon
Anitflat® Ktbl, 3× 1–2
Anitflat® Tr, 3–5× 32–48 Tr
Lefax® extra Ktbl, 3–8× 1–2 Tbl
Lefax® Susp, 3–5× 4 Pumpstöße
Sab Simplex ® Tr, alle 4–6 h 30–45 Tr
Enzyme – Pankreatin
Helopanflat® Drg, 4–6× 2 Drg kurz nach den Mahlzeiten
Pflanzliche Arzneimittel
esto-gast® Tr, 2–3× 2 ml
GastroMed® Madaus Tr, 3×20 Tr
Iberogast® Tr, 3×20 Tr
Kamillosan® Tr, 4×1, 100 ml Wasser + 5 ml Kamillosan
Klosterfrau Melissengeist®, 3× 5–10 ml
Montana Haustropfen®, 1–2 TL in Wasser mehrmals
Ätherisches Pfefferminzöl + Kümmelöl
Gaspan® WKps, 2×1 Kps
Tees3–4 Tassen täglich
Dr. Kottas® Blähungs- und Verdauungstee
Dr. Kottas® Tausendguldenkrauttee
Sidroga® Fencheltee
Sidroga® Magen Darm Beruhigungstee
Ernährung und pflanzliche Anwendungen
Bei Problemen mit Blähungen sollte man bestimmte Lebensmittel meiden. Dazu gehören Hülsenfrüchte, Kohl, Knoblauch, frisches Brot, kohlensäurehaltige Getränke und Zuckeraustauschstoffe in größeren Mengen. Wichtig ist es auch, sich mit dem Essen Zeit zu lassen, da Stress einen negativen Einfluss auf die Verdauung hat.
Klassische pflanzliche Anwendungen bei Blähungen enthalten meist Fenchel, Anis und/oder Kümmel. Die ätherischen Öle dieser Pflanzen wirken karminativ (gegen Blähungen) und spasmolytisch (krampflösend) auf den Magen-Darm-Trakt. Bewährt haben sich auch ätherische Öle aus Pfefferminze und Kümmel, die in magensaftresistente Weichkapseln verpackt 30 Minuten vor den Mahlzeiten eingenommen werden müssen, um eine optimale Aufnahme zu gewährleisten.
Entschäumer
Entschäumer wirken rein physikalisch und setzen die Oberflächenspannung der im Verdauungsprozess entstandenen Gasbläschen herab. Dadurch mindert sich das Völlegefühl im Bauchraum. Die Einnahme empfiehlt sich zu oder direkt nach den Mahlzeiten.
Pflanzliche Arzneimittel
Diese bestehen neben den schon besprochenen pflanzlichen Komponenten oft aus einer Vielzahl von weiteren alkoholischen Auszügen, die die Verdauung durch beispielsweise vermehrte Säuresekretion anregen sollen. Alle bitteren Drogen wie Enzian oder Schleifenblume sind hier zu nennen. Beruhigend wirken Melisse oder Kamille. Es empfiehlt sich, diese Tinkturenkombinationen schon 30 min vor dem Essen einzunehmen, um die Verdauung auf die kommende „Belastung“ vorzubereiten.
Eine weitere Möglichkeit sind Weichkapseln mit ätherischen Ölen aus Pfefferminze und Kümmel. Pfefferminze wirkt dabei krampflösend und Kümmel gegen Blähungen. Sie werden aufgrund ihrer magensaftresistenten Zubereitung 30 Minuten vor den Mahlzeiten eingenommen.
Tipps aus der Praxis
Ausreichend Bewegung.
Stress reduzieren und ausreichend Zeiten für Erholung einhalten. In Ruhe essen.
Statt großen Mahlzeiten mehrere kleine einnehmen.
Bei krampfartigen Blähungen kann Butylscopolamin (Buscopan®) kurzfristig Linderung schaffen.
Stärkung der Darmflora mit Bakterienpräparaten (siehe Durchfall S. 49).
Massage der Bauchmuskulatur (mit ätherischen Ölen wie Fenchel und Kümmel) und warme Auflagen.
Arzneimittel wie Lactulose oder Antibiotika können Blähungen auslösen. Daher immer die bestehende Medikation erfragen und bei Bedarf in Rücksprache mit dem Arzt anpassen.
Kohlensäurehaltige und blähende Lebensmittel meiden.
Lebensmittelunverträglichkeiten (Fructose, Lactose etc.) ausschließen.
Lebensmittel mit Zuckeraustauschstoffen meiden.