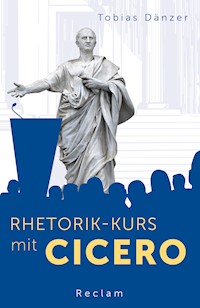
7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Reclams Universal-Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Was macht eine gute Rede aus? Und wie gelingt sie? Der berühmte römische Politiker Cicero (106–43 v. Chr.) hat der Nachwelt theoretische Schriften zur Rhetorik hinterlassen und es selbst in dieser Kunst zur Perfektion gebracht. Warum die Rhetorik also nicht von ihm erlernen? Dieser Kurs in zehn Lektionen macht es möglich – konzipiert aus Ciceros Tipps und mit Beispielen aus seinen Reden. Lektion 1: Was ist gute Rhetorik? Lektion 2: Besser reden – ein methodischer Leitfaden Lektion 3: Die Rede beginnen Lektion 4: Das Beweisziel finden Lektion 5: Mitreißend erzählen Lektion 6: Überzeugend argumentieren Lektion 7: Stilistisch beeindrucken Lektion 8: Mit Humor gewinnen Lektion 9: Frei und sicher sprechen Lektion 10: Wirkungsvoll auftreten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 133
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tobias Dänzer
Rhetorik-Kurs mit Cicero
Reclam
2022 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH nach einem Konzept von Tanja Jung, dialog-grafik.de
Coverabbildung: Cicero-Standbild vor dem Palazzo di Giustizia in Rom (Shutterstock / Andrea Izzotti)
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2022
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962073-2
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-014306-3
www.reclam.de
Inhalt
Einleitung
Warum Rhetorik?
Warum antike Rhetorik?
Warum gerade Cicero?
Zwischenblatt
LEKTION 1: Was ist gute Rhetorik?
LEKTION 2: Besser reden – ein methodischer Leitfaden
Lektion 3: Die Rede beginnen
LEKTION 4: Das Beweisziel finden
LEKTION 5: Mitreißend erzählen
LEKTION 6: Überzeugend argumentieren
LEKTION 7: Stilistisch beeindrucken
LEKTION 8: Mit Humor gewinnen
LEKTION 9: Frei und sicher sprechen
LEKTION 10: Wirkungsvoll auftreten
Literaturhinweise
Werke Ciceros in Übersetzung (Auswahl)
Ausgaben und Übersetzungen weiterer zitierter Autoren
Zitierte, benutzte und weiterführende Literatur
Einleitung
Rhetorik ist in Mode, sie hat Konjunktur. Wer sich für Rhetorik interessiert, kann aus einer unübersehbaren Fülle an Ratgeberliteratur, Seminaren, Internetseiten, Videos und Blogs wählen, die großen und vor allem schnellen Erfolg versprechen. In Aussicht gestellt werden zügig erlernte Durchsetzungsfähigkeit, neu gewonnene Selbstsicherheit und damit beruflicher und finanzieller Aufstieg. Verknappte Kompetenzmodelle und Erfolgskurven suggerieren einfache Machbarkeit, moderne Begrifflichkeiten wie Framing und Storytelling Neuheit der Erkenntnisse. Rhetorik verkauft sich, indem sie als modisches und handliches Werkzeug für das unmittelbare persönliche Fortkommen dargestellt wird.
Im vorliegenden Buch wird Rhetorik aus einer anderen Perspektive betrachtet, die nicht weniger am praktischen Nutzen orientiert ist, die aber den umfassenden Anspruch und die überzeitliche Bedeutung des Themas in den Mittelpunkt stellt: Es ist die Perspektive der Antike. Das Buch ist der Überzeugung verpflichtet, dass Kenntnis der antiken Rhetorik zu einem tieferen Verständnis von Rede und Kommunikation führt und besonders heute frische Impulse, neue Ideen und überraschende Einsichten geben kann.
Als ›Rhetorik-Trainer‹ aus der Antike kommt dabei derjenige Denker zu Wort, der sich durch seine Redegabe überzeitlichen Ruhm erworben hat: Marcus Tullius Cicero (106–43 v. Chr.). Für ihn gilt bis heute das Urteil, das der römische Redelehrer Quintilian rund 150 Jahre nach seinem Tod gefällt hat (Institutio oratoria 10,1,112): ›Cicero‹ sei nicht der Name eines Menschen, sondern der »Inbegriff der Redekunst« (nomen eloquentiae).
Cicero eignet sich insbesondere deshalb zum Begleiter durch die antike Rhetorik, da er sich sowohl als Redetheoretiker wie auch als Redepraktiker hervorgetan hat. In seinen rhetorischen Schriften hat er die Lehre des wirkungsvollen Sprechens dargestellt und erläutert, in seinen Reden hat er sie zur Anwendung gebracht und perfektioniert. In den folgenden zehn Lektionen sind diese beiden Teile des rhetorischen Wirkens Ciceros zusammengebracht, indem wesentliche Überlegungen zur Redetheorie von ›Anwendungsbeispielen‹ aus den Reden begleitet werden.
Das Anliegen des Kurses lässt sich in drei Leitfragen veranschaulichen: Warum lohnt sich die Beschäftigung mit Rhetorik überhaupt? Was kann die antike Rhetorik beitragen? Und schließlich: Weshalb eignet sich Cicero besonders als Trainer für einen Rhetorik-Kurs aus der Antike?
Warum Rhetorik?
Rhetorik, verkürzt von der griechischen rhētorikē technē, ist die »Kunst der Rede«. Man assoziiert sie vor allem mit dem öffentlichen Raum, mit der pathosschweren Rede in Politik, bei Gericht, vor großen Menschenansammlungen. Viele dieser öffentlichen Reden haben Berühmtheit erlangt und stehen sinnbildlich für historische Abschnitte oder epochale Ereignisse. Dies gilt im Positiven wie im Negativen: Bürgerrechts-, Geschlechter- und Klimabewegungen bedienten und bedienen sich ebenso der Rhetorik wie die Propagandisten totalitärer Regime.
Das hat mit der grundlegenden Definition von Rhetorik zu tun: Rhetorik ist die Kunst des Überzeugens und Überredens, das heißt die Kunst, einem Gegenüber mit Worten die eigene Meinung zu vermitteln und bestenfalls überzustreifen. In der manipulativen Kraft der Rhetorik liegt die wichtigste Antwort auf die Frage, warum sich die Beschäftigung mit ihr lohnt. Rhetorische Bildung liefert die Analysemittel für intuitive und emotionale Vorgänge, die beim Hören einer Rede, häufig unbewusst, ablaufen. Rhetorik kann daher vor manipulativer Rede schützen, indem sie lehrt, nicht nur die Inhalte selbst, sondern auch deren argumentative Anordnung und sprachliche Darbietung durch Rednerinnen oder Redner kritisch zu hinterfragen. Sie gibt Antworten auf Fragen wie: Warum habe ich mich überzeugen lassen? Wie waren die Argumente aufgebaut? Welche Assoziationen und Gefühle haben die gewählten Worte bei mir ausgelöst, und weshalb?
Das gilt jedoch nicht nur für die mitreißende Rede im öffentlichen Raum: Auch im zwischenmenschlichen Bereich, im täglichen Miteinander, hat Rhetorik ihren Platz. Jede bewusste Äußerung, die auf eine weitere Person (oder auch auf die eigene, etwa im Selbstgespräch oder beim Tagebucheintrag) einwirkt, ist Rhetorik. Durch Reden bestimmen wir, wie wir von anderen wahrgenommen werden (wollen), wie wir unsere Ziele erreichen und welche Stellung wir innerhalb der Gemeinschaft einnehmen. Verständnis für rhetorische Strukturen, für die Funktionsweisen von Rede und Kommunikation, ist daher überall dort wichtig, wo wir uns der Sprache bedienen und ins Gespräch kommen.
Damit ist Rhetorik nicht nur die Kunst der großen Rede, sondern die Kunst, sich als Mensch und Mitmensch zu definieren. Rede ist das, was den Menschen als vernunftbegabtes Wesen ausmacht. Cicero prägte den Begriff des »Menschseins« (humanitas), das untrennbar mit der Fähigkeit verknüpft sei, sich auszudrücken:
Lasst uns nicht immer nur an Forum, Richterbänke, Rednertribüne und Senat denken: Was kann im Privatleben angenehmer und unserem Menschsein angemessener sein als eine elegante und kultivierte Redeweise? (De oratore 1,32)
Warum antike Rhetorik?
Die heutige Vorstellung von Rhetorik ist eine wesentlich andere als in der Antike. Heute versteht man Rhetorik zumeist als Anleitung zu einem souveränen Auftritt. Bei Rhetorik-Schulungen wird größter Wert auf Körpersprache, Stimmeinsatz und selbstbewusstes Auftreten gelegt. Häufig wird der Satz bemüht, der Auftritt, nicht der Inhalt mache den Redeerfolg aus. Freilich gehörte die Theorie des Auftretens vor Publikum auch in der Antike zur Rhetorik, aber es war dort der letzte Schritt der rhetorischen Aufgaben, nicht, wie heute leicht der Eindruck vermittelt wird, der erste und einzige.
Die antike Rhetorik war ein umfassendes Denksystem, das die Kultur, die Politik und das gesellschaftliche Zusammenleben prägte. Die römische Kultur war in erster Linie eine mündliche, eine rhetorische. Das lässt sich am besten daran ablesen, dass die Ausbildung zum Anwalt und Politiker, den bedeutendsten Berufen der Antike, eine Ausbildung im Reden war. Im Laufe des ersten vorchristlichen Jahrhunderts etablierte sich die Rhetorik-Schule, die, in etwa vergleichbar mit den höheren Klassen des Gymnasiums oder dem Studium, die Absolventen auf eine Karriere vorbereitete. ›Rhetorik‹ hieß also, wie heute Abitur oder Examen, die höhere Ausbildung.
In der Schule ging es um Rhetorik in ihrer Gesamtheit, die in den fünf »Aufgaben des Redners« (officia oratoris) zusammengefasst war (siehe dazu genauer auf S. 22): Man lernte, wie man das Redethema fand (inventio, »Auffindung«), wie man die Redeteile und die Argumente wirkungsvoll anordnete (dispositio, »Anordnung«), wie man die Rede ausformulierte (elocutio, »Ausdruck«), wie man sie auswendig lernte (memoria, »Gedächtnis«) und schließlich, im letzten Schritt, wie man sie vor Publikum vortrug (actio, »Vortrag«). Dabei lag der Fokus, wie angedeutet, keineswegs auf dem letzten Punkt, dem Auftreten: Das lernte man vor allem in der »Probezeit auf dem Forum« (tirocinium fori), wo man sich einem berühmten Redner anschloss, den man auf Schritt und Tritt begleitete und dessen Auftrittswirkung man beobachtete und nachzuahmen versuchte.
Aus der Bedeutung der Rhetorik für das antike Denken geht hervor, weshalb die Beschäftigung mit ihr besonders heute vielversprechend ist: In der griechisch-römischen Antike erlangte Rhetorik einen Entwicklungsstand, wie er später nicht mehr erreicht worden ist. Der Grad der Differenzierung rhetorischer Konzepte und Begriffe, die Menge rhetorischer Lehrschriften aus der Feder der größten griechischen und römischen Denker und die bis heute fortdauernde, unmittelbare Wirkung der antiken Reden legen nahe, dass man Rhetorik von denen lernen sollte, die sich am ausführlichsten damit beschäftigt haben.
Warum gerade Cicero?
Cicero eignet sich nicht nur deshalb zum Wortführer und Lehrer, weil er im nahezu einhelligen Urteil der Nachwelt als größter antiker Redner gilt, sondern auch, weil er sich seine hohe Stellung durch Rhetorik erarbeiten musste. Geboren 106 v. Chr. in der kleinen Landstadt Arpinum als Sohn eines Mannes aus dem Ritterstand (ordo equester), gehörte er nicht zur Nobilität, der ersten Gesellschaftsschicht, aus der sich in Rom die führenden Politiker rekrutierten. Zeitlebens bekundete Cicero Stolz auf seine eigene Leistung, es als Außenseiter und Emporgekommener (homo novus) an die Spitze des Staates geschafft zu haben.
Seine Redegabe gründete sich allerdings nicht allein auf Talent, sondern war das Resultat sorgfältiger Ausbildung und harter Arbeit. Cicero bildete sich noch nicht in der Rhetorik-Schule – dies wurde erst im Laufe des 1. Jahrhunderts v. Chr. gängig –, sondern schloss sich berühmten Lehrern an. So verbrachte er seine Studienzeit vor allem auf Reisen, die ihn auch auf die Insel Rhodos führten, wo er beim angesehenen Redelehrer Apollonios Molon Rhetorik-Unterricht nahm. Dazu gehörte auch die Stärkung der Lunge, der Stimme und des ganzen Körpers: Stundenlanges, lautes Reden auf dem Forum forderte eine kräftige Konstitution.
Ciceros Redekunst, die er in aufsehenerregenden Politprozessen, so in den Anklagereden gegen den berüchtigten Statthalter Siziliens Gaius Verres oder den Putschisten Catilina, erfolgreich einzusetzen wusste, brachte ihm genügend Anerkennung ein, um schließlich, zum frühestmöglichen Karrierezeitpunkt (suo anno), ins Amt des Konsuls gewählt zu werden (63 v. Chr). Als Konsul vereitelte er den Umsturzversuch Catilinas und ließ die Drahtzieher – ohne Gerichtsbeschluss – hinrichten. Dies bedeutete den Wendepunkt seiner Karriere: Durch einen entsprechenden (rückwirkenden) Gesetzesentwurf des Volkstribuns Publius Clodius Pulcher sollte der geächtet werden, der einen römischen Bürger ohne Gerichtsurteil tötete. Cicero entzog sich der Strafe, indem er Rom verließ und nach Griechenland floh.
Mit dem ›Exil‹ des Jahres 57 v. Chr. und seiner Rückkehr nach Rom begann eine wechselvolle Zeit im Leben Ciceros: Zeiten politischer Hoffnung und großer Reden auf dem Forum (zu nennen ist hier vor allem die Rede Pro Sestio, worin Cicero sein staatspolitisches Programm entwarf) wechselten sich ab mit Phasen des erzwungenen Rückzugs ins Private. Diesen ist es vor allem zu verdanken, dass Cicero auch seine theoretischen Ansichten zur Rhetorik niederlegte, denn er schrieb immer dann, wenn er politisch im Abseits stand. So stammt sein drei Bücher umfassendes rhetorisches Hauptwerk De oratore aus dem Jahr 55 v. Chr., dem Jahr nach dem erneuerten Machtbündnis zwischen Caesar, Pompeius und Crassus, das Cicero in die politische Ohnmacht zwang. Die beiden Schriften Brutus, eine Geschichte der Redekunst, und Orator, worin Cicero das Idealbild eines Redners entwarf, entstanden 46 v. Chr., in dem Jahr, in dem er, der Pompeius-Anhänger, von Caesar begnadigt und zum Stillhalten genötigt wurde. In weiteren Schriften betätigte sich Cicero als Theoretiker der Redekunst, so in seiner Jugendschrift De inventione, in den Partitiones oratoriae, einer Unterweisungsschrift in Form eines Zwiegesprächs mit seinem Sohn, und in den Topica, die dem Juristen Gaius Trebatius Testa die rhetorische Argumentationslehre nahebringen sollten.
Wie Ciceros Leben von Rhetorik begleitet war, so war es auch sein Tod: Seine Redekunst hatte ihm einen beispiellosen Aufstieg beschert, und sie war es, die ihm ein schmachvolles Ende bereitete. In der Auseinandersetzung zwischen Antonius und Octavian, dem späteren Kaiser Augustus, hatte Cicero die Seite des Letzteren gewählt und Antonius mit heftigen persönlichen Angriffen überzogen, die in den berüchtigten Orationes Philippicae Ausdruck fanden, benannt nach den Schmähreden des Demosthenes gegen den Makedonenkönig Philipp im 4. Jahrhundert v. Chr. Das Kalkül ging nicht auf: Als sich die späteren Bürgerkriegsgegner Antonius und Octavian 43 v. Chr. zeitweilig zusammengeschlossen hatten, war Cicero einer der Ersten, die auf die Proskriptionsliste gesetzt und damit für vogelfrei erklärt wurden.
Cicero wandte sich zur Flucht, wurde entdeckt und enthauptet. Kopf und Hände wurden auf den rostra, der römischen Rednerbühne, ausgestellt, Antonius’ Frau Fulvia soll ihm die Zunge mit ihrer Haarnadel durchbohrt haben. Eben der Ort, an dem Cicero seine größten rhetorischen Erfolge gefeiert und wo er die Philippischen Reden gehalten hatte, geriet so zum Mahnmal eines Redners, der seine leidenschaftliche Rhetorik mit dem Leben bezahlte.
Wenngleich Ciceros Ende in abschreckender Weise zeigt, wozu öffentliches Reden führen kann, so eröffnet die Beschäftigung mit seinem Leben und Werk doch die einzigartige Möglichkeit, Rhetorik in ihrer Gesamtheit, in ihrer theoretischen und lebenspraktischen Dimension zu begreifen. Dazu gehört auch das Eingeständnis so mancher (rhetorischer oder menschlicher) Schwächen Ciceros, die in den folgenden Kapiteln nicht übergangen werden. Eben dies mag eine tröstliche Ermunterung für all diejenigen sein, die sich rhetorisch verbessern möchten: dass auch der größte Redner nicht unfehlbar ist.
Das Motto des vorliegenden Bändchens ist Ciceros frühester rhetorischer Schrift De inventione entnommen, die er in seinen zwanziger Jahren verfasste und die ihm, wie er später nicht ohne die ihm eigene Eitelkeit schrieb, etwas zu früh entschlüpft sei. Hierin ist eine didaktische Maßgabe formuliert, der sich der Autor dieses Bandes verpflichtet fühlt – Klügere zu Wort kommen zu lassen:
Ich bin doch der Meinung, dass die Menschen, in vielerlei Hinsicht bedürftiger und schwächer als die Tiere, diese vor allem darin übertreffen, dass sie sprechen können. Daher hat meiner Ansicht nach Vortreffliches erreicht, wer da, wo die Menschen die Tiere übertreffen, noch die Menschen übertrifft. Wenn sich das vielleicht nicht allein durch Talent und Übung einstellt, sondern auch durch Theorie vermittelt wird, dann ist es nicht abwegig, die Meinung derer einzuholen, die uns darüber Regeln hinterlassen haben.
(De inventione 1,5)
Wie eine Rede gelingtZehn rhetorische Lektionen mit Cicero
LEKTION 1: Was ist gute Rhetorik?
Die wohl schönste antike Definition der Rhetorik stammt nicht von Cicero, sondern von dessen glühendstem Verehrer Quintilian (um 35–96): Rhetorik sei die »Wissenschaft des guten Redens« (scientia bene dicendi), also ein erlernbares System, das einen befähigt, gut zu sprechen. So kurz diese Bestimmung auch ist, sie hat es in sich. Im Wörtchen ›gut‹ liegt die ganze Problematik der Rhetorik, die entscheidende Frage, die Cicero ein Leben lang beschäftigte und die am Beginn jeder Auseinandersetzung mit Rhetorik stehen sollte: Was ist ›gute‹ Rhetorik?
Rhetorik kann in verschiedener Hinsicht ›gut‹ sein: moralisch gut, technisch gut, gut im Sinne der Publikumswirkung. Bevor man sich mit den Einzelheiten der Rhetorik-Theorie und -Praxis befasst, hat man also einen Schritt zurückzugehen und sich Gedanken zu machen über die Grundfunktion und die moralische Problematik von Rhetorik, über ihre technische Seite und ihren Wirkanspruch. Dabei steht die grundlegendste Frage am Anfang: Was ist Rhetorik überhaupt?
Definitionssache: Was ist Rhetorik?
Aus der Antike ist eine große Menge unterschiedlich lautender Definitionen bekannt. So hatte Platon (um 428–348 v. Chr.) die Rhetorik im Gorgias etwas verächtlich als peithus dēmiurgos, als »Werkmeisterin der Überzeugung«, bezeichnet, also als moralisch indifferentes Mittel zur Manipulation. Aristoteles (384–322 v. Chr.) hat in seiner Rhetorik definiert, Rhetorik sei die Fähigkeit, alles ausfindig zu machen, was in der Rede überzeugen könne (Rhetorica 1,2). Cicero wiederum formulierte, Aufgabe des Redners sei es, »zum Überzeugen geeignet zu sprechen«, das verfolgte Ziel bestehe in »Überzeugung durch Rede« (De inventione 1,6). In Überzeugung und Überredung, ja in Beugung und Brechung des Gegenübers liegt nach Cicero die eigentliche Macht der Rede:
So große Macht hat die Rede, die von einem guten Dichter trefflich als »Seelenbeugerin und Königin der Welt« bezeichnet wurde, dass sie nicht nur einen Wankenden aufrichtet und einen Stehenden ins Wanken bringt, sondern dass sie selbst, gleich einem tapferen und guten Feldherrn, einen widerstrebenden Feind gefangen nimmt.
(De oratore 2,187)
Mit dem Grad der Überzeugung versucht man auch, die Qualität von Rhetorik zu ›messen‹. So hat etwa der Altphilologe Wilfried Stroh in seinem Buch Die Macht der Rede Beispiele genannt, wo ein Redner beim Publikum einen Meinungsumschwung erreicht (2009, S. 21 f.). Er zitiert die berühmte Rede des Antonius aus Shakespeares Julius Caesar, die aus Anhängern der Caesarmörder deren Feinde macht, oder die Rede des damaligen Außenministers Joschka Fischer auf dem Sonderparteitag der Grünen 1999, als er eine erklärte Friedenspartei, die ihn eingangs als ›Kriegstreiber‹ beschimpft hatte, dazu





























