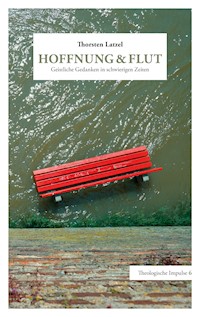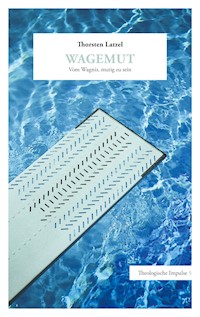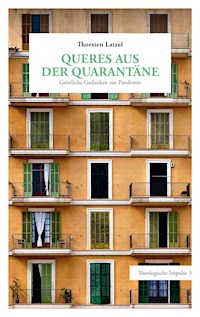Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
"There's a crack, a crack in everything. That's how the light gets in." (Leonard Cohen, Anthem) Die 22 Essays in diesem Buch beschäftigen sich mit der wundervollen Schönheit, der tiefen Verletzlichkeit und der Widersprüchlichkeit menschlichen Lebens. Und damit, wie oftmals gerade in den Rissen etwas von einer anderen Wahrheit sichtbar wird. In ihnen geht es etwa um die Berufung des stotternden Mose, zitternde Hände, die Kunst des Radfahrens, Liebe in Zeiten des Alltags, morgendliche Suchfragen oder das wichtige Wörtlein "vielleicht".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Anette, Josephine, Charlotte und Julius
INHALT
Vorwort
Hineni oder: Der stotternde Mose
Das Zittern meiner linken Hand
Die fremden Witwen
Von der geistlichen Kunst des Radfahrens
Von Einsam-, Zweisam- und Allsamkeit
Welches Stück?
Stirnrunzeln
Die ersten sieben Tage
„Frí-da! Júu-hu! Where is the cat?“
„Vielleicht.“
Zur Ruhe kommen.
Vom Rudern zu zweit und guten Geschichten
Rückwärtsgehen
„Du sollst deinen Populisten lieben“
Der zweite Schlaf
„Bruder Blau-Auge“
Pilgern
Flowerpower
Der 29. Februar und das Ewige Leben
„Und die Wahrheit wird euch frei machen“
„Was wird aus Erwin – jetzt, wo er tot ist?“
Der Weg in das Land Bitterkeit – und der Ort, „da der Herr sieht“
Anmerkungen
VORWORT
Eine ältere Frau hat einmal zu mir gesagt: „Das Leben ist eines der schönsten und schwersten, das es gibt.“ Was für ein feiner und weiser Satz. Es zeichnet meines Erachtens gute Dichtung ebenso wie gute Theologie aus, wenn sie allen drei damit getroffenen Aussagen versucht gerecht zu werden.
Zunächst zur Schönheit: Leider gab und gibt es in der christlichen Religion (wie in manchen anderen Religionen) oft ein geistliches Misstrauen gegenüber allem Schönen, Bunten, Sinnlichen. „Alles nichtig, eitel und ein Haschen nach Wind.“ Was für ein unheiliger Unsinn. So als könnte man den Schöpfer mit langweiligen, graublauen Wollpullovern irgendwie besser loben. Ich meine, Gott hat sich Flamingos, Eisvögel und Tukane ausgedacht. Bei allem Verständnis für Askese und innere Freiheit von Modediktaten: Ästhetische Wurm-Madigkeit ist kein Erweis besonderer Frömmigkeit. Zum Glauben gehört vielmehr die Erkenntnis, „dass ich wunderbar gemacht bin“ (Ps 139,14) – und alle andere Menschen, Tiere und Pflanzen auch. Das Leben als Wunder zu erkennen, ist ein Akt des Glaubens.
Zum Leben gehört dann aber auch seine Schwere. Ein Leiden an seinen dunklen Seiten: angefangen von den physischen „Übeln“ wie Schmerzen, Demenz oder Krebs, über das Böse, das wir einander zufügen, bis hin zur Tatsache unserer aller Endlichkeit. Ich, die anderen, die Welt sind nicht die, die wir sein sollten. Das macht es so schwierig. Jedes Leben ist verletzlich, trägt Risse, Lücken, Wunden. Und gerade, wenn wir so verständlich wie verzweifelt versuchen, uns und unsere Lieben mit allen Mitteln davor zu schützen, machen wir es oft noch viel schlimmer.
Wie das Schöne und das Schwere zusammengeht, gehört zu den großen Herausforderungen im eigenen Leben. Die eigentliche, tiefe Glaubensfrage bei dem eingangs zitierten Satz steckt im „und“, im bei-, mit-, neben-, in- und durcheinander von beidem. Wie lassen sich die Widersprüchlichkeiten, die Ambivalenzen jenseits eines bloßen „und“ verstehen? Und vor allem wie lässt sich mit ihnen leben, lieben, glauben, hoffen?
Die Essays in diesem Buch gehen dem auf verschiedene Weise nach. Sie bieten keine fertigen Antworten, aber Ansätze, wie ich selbst mit diesen Fragen umzugehen versuche – im Horizont des seinerseits schönen, verletzlichen und „wider-sprüchlichen“ Glaubens an den Gekreuzigten. Denn was für das Leben gilt, gilt auch für den Glauben: Ohne ihre (wohlverstandene) tiefe „Wider-Sprüchlichkeit“ sind beide nicht zu haben. Sonst hätte Gott sich das mit Kreuz und Auferstehung auch sparen können.
Herzlichen Dank allen, die zum Entstehen des Buches beigetragen haben, vor allem Frau Weintz, Herrn Stenzel und meiner Frau Anette. Sie haben mancher „Irrsal und Wirrsal“ gewehrt.
Ich freue mich, wenn die Gedanken Ihnen oder anderen dazu helfen, in getroster Ambivalenz zu leben – mit all der Schönheit, Verletzlichkeit und Wider-Sprüchlichkeit, die dazu gehören.
Thorsten Latzel Darmstadt, Januar 2020
1. HINENI ODER: DER STOTTERNDE MOSE
Hommage an Leonard Cohen
Ein persönliches Lied, ein voluminöses Kunstwerk und eine brennende Frage.
Ein persönliches Lied
Am 7. Nov. 2016 starb der kanadische Dichter, Komponist und Sänger Leonard Cohen. Bekannt geworden ist er durch Stücke wie Hallelujah, Suzanne oder So Long, Marianne. Zeitlebens litt Leonard Cohen unter schweren Depressionen. Er liebte intensiv verschiedene Frauen – ohne jemals verheiratet gewesen zu sein. Sein Großvater und Urgroßvater waren Synagogenvorsteher gewesen, seine Lieder sind tief geprägt vom jüdischen Glauben und der Sprache des Alten Testaments. Drei Wochen vor seinem Tod erschien sein letztes Album You want it darker.
In düsteren, melancholischen Liedern singt der jüdische Sänger Cohen in Form eines Liebesliedes über sich selbst und über Gott und über die unmögliche Möglichkeit, an ihn zu glauben. You want it darker ist eine hoch persönliche Ballade eines tiefgläubigen Atheisten, eines frommen Zweiflers.
“If you are the dealer
I'm out of the game
If you are the healer
I'm broken and lame
If thine is the glory
Then mine must be the shame
You want it darker
We kill the flame”
1
In einem anderen Stück des Albums – Treaty – spitzt Cohen seine Auseinandersetzung mit Gott noch weiter zu – bis hin zur Bestreitung von dessen Existenz, für die er sich paradoxer Weise bei Gott in einem Gebet entschuldigt.
“I'm so sorry for that ghost I made you be
Only one of us was real – and that was me.”
“A million candles burning
For the help that never came”2
Ein voluminöses Kunstwerk
Im Rahmen der EKHN-Kunstinitiative „Gnade“ im Jahr 2017 kreierte der junge Stuttgarter Künstler Georg Lutz in der Martinskirche in Darmstadt das Kunstwerk „5 tons of prayer“.3 Wachs- und Kerzenreste von Gebets-Kerzen, die im letzten dreiviertel Jahr in einer Kölner Kirche abgebrannt worden waren. Georg Lutz hatte sie zu einem großen Reste-Berg angehäuft. Ein Kunstwerk, das durch seine schiere Masse sprach. Fünf Tonnen. Soviel, dass zunächst unsicher war, ob das Kellergewölbe der Kirche sie würde tragen können. Stumme Spuren menschlichen Redens mit Gott. Eine Materialisierung von tausenden und abertausenden von Bitten, Dank, Klagen, die an Gott gerichtet wurden. Gebete, von denen die Betenden hoffen, dass sie erhört werden. So, wie es die großen, alten Verheißungen der Bibel zusagen:
„Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen.“ (Jes 42,3) „Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet, ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan.“ (Mt 7,7)
Der Gebetskerzen-Berg als ein Zeichen von Glauben und Zuversicht gegen die Dunkelheit.
Oder sind die Gebete mit den Kerzen verraucht und verloschen? Der Kerzenberg stünde dann als Monument für viele enttäuschte Hoffnungen. So, wie es auch die Mütter und Väter unseres Glaubens beklagt haben.
Etwa in Psalm 22, den Worten, mit denen Jesus am Kreuz starb:
„Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen?
Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne.
Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht; und des Nachts, doch finde ich keine Ruhe.“ (Ps 22,2f.)
“A million candles burning for the help that never came”?
Womit wir bei der brennenden Frage sind:
Ob Gott hört? Ob er unsere Bitten erhört? Ob unsere Gebete mehr sind als ein spirituelles Beruhigungsmittel – gut für Kinder, Alte, Kranke, Bettler und fromme Narren, die sich selbst nicht anders zu helfen wissen? Gnade und Gnadenlosigkeit: Das Gebet ist der Ort, an dem beides im Leben erfahren werden kann.
Bei der Frage, ob Gott hört, geht es um mehr als nur um fromme Innerlichkeit. Es geht letztlich um eine Hoffnung für die gesamte Schöpfung. Um eine Zukunft für uns, unsere Gesellschaft, unsere Welt – über das Vorfindliche hinaus. Eine Hoffnung jenseits von Optimismus, gegen den Augenschein, wider das Gefühl allgegenwärtiger Krisen.
Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die in besonderer Weise von dieser Frage handelt, ob Gott hört. Die Geschichte vom brennenden Dornbusch (2.Mose 3,1–4,17). Es ist eine Geschichte von großer persönlicher Intimität, die Berufung des Mose. Es ist zudem eine Geschichte von gesellschaftlicher Relevanz: Die Rettung des Volkes Israel beginnt. Und es ist die einzige Stelle in der Bibel, in der Gott seinen Namen verrät.
Der Name Gottes ist zugleich der Schlüssel für die Frage, ob Gott hört. Es ist ein Name, der nicht zu übersetzen ist, weil er viele verschiedene Bedeutungsschichten hat, so verschieden wie die Erfahrungen mit dem Gebet. Drei klassische Übersetzungsversuche, die alle etwas aussagen über Gott, den Menschen und die Frage, ob er unser Beten hört.
1. Ich werde sein, der ich sein werde
Im Gebet erfährt der Mensch die unbedingte, radikale Freiheit Gottes – und die eigene ebenso unbedingte Angewiesenheit auf ihn. In der Geschichte spiegelt sich dies in dem Bild des brennenden Dornbuschs. Er ist nicht zu fassen, unverfügbar, von letztgültiger, erhabener Freiheit. Mose zieht es die Schuhe aus. Er verhüllt sein Angesicht. Der Mensch als existentiell barfußes Wesen mit verhülltem Angesicht. Wir haben kein metaphysisches Fell, keine Schuhe, keinen sicheren Stand, keinen klaren Blick auf die Welt, das Leben, auf Gott. Ein Gott, der für uns planbar, handhabbar, berechenbar wäre, wäre kein Gott. Wir sind – soweit wir es wissen – das einzige Geschöpf, das um Gott weiß. Und zugleich auch das einzige, das weiß, dass Gott uns nicht zur Verfügung steht. Wir haben es nicht in der Hand, dass Gott hört. Wir stehen geistlich barfuß da.
2. Ich werde da sein
Das Gebet ist sodann verbunden mit der Erfahrung der verborgenen Gegenwart Gottes. Selbst in seinem Schweigen ist Gott gegenwärtig. Es ist eine zutiefst paradoxe Zuversicht des Glaubens, die oft selbst gegen die eigene Erfahrung steht. Die Zuversicht, dass Gott da ist. Dass er uns hört, selbst wenn er schweigt. Auch wenn das, was er hört, oft nur noch meine Klage über seine Ferne ist. In der Geschichte spiegelt sich das ebenfalls in dem Bild des brennenden Busches wider. Der Busch brennt als Zeichen der Gegenwart Gottes. Gott ist da, Gott hört. Und in diesem Falle spricht Gott sogar. Aus dem Busch erfolgt die Anrede an Mose. Gott sagt zu, dass er das Schreien seines Volkes hört, dass er sein Elend sieht, dass er gegenwärtig ist und sein wird.
Gott wird da sein. Gott hört – auch wenn er schweigt. Das ist seine Zusage aus dem brennenden Dornbusch. Und es die unverwüstliche Hoffnung des Glaubens – immer wieder auch im Widerspruch zur eigenen Erfahrung der Gottesferne.
3. Ich werde für dich da sein – ich werde mit dir sein
Im Gebet erfahren wir schließlich manchmal, gebrochen, in Hoffnung, dass Gott hilft und dass wir frei sind. Gott mischt sich ein, macht das Leid Israels, der Menschen, der Welt zu seinem Leid. Und er macht Mose, sein Volk, den Menschen zugleich frei, um für andere da zu sein. Die Erfahrung des helfenden Eingreifens Gottes und der eigenen Freiheit zu lieben. Auch das gehört zum Gebet. In der Geschichte drückt sich dies in der Berufung des Mose aus. Es ist die Geschichte des hadernden, stotternden, zweifelnden Menschen – und des in ihn vertrauenden Gottes. Mose findet immer neue Gründe, warum er nicht der sein kann, der das Volk herausführt. Doch Gott nimmt ihn mit hinein in sein eigenes „Ich werde für dich da sein“. Dem Namen Gottes entspricht das „Hineni“ des Mose vom Anfang: „Hier bin ich.“ Wir werden als Menschen so selbst hineingenommen in die drei Namen Gottes und in den Prozess der Liebe, die sich darin ausdrückt, in seine Freiheit, in seine Gegenwart, in seine Selbsthingabe für andere. Wenn wir mit ihm das Schreien der anderen hören, uns nicht länger vom eigenen Unvermögen bestimmen lassen und unser eigenes „Hier bin ich“, sprechen.
Mit Leonard Cohen habe ich begonnen. Mit ihm möchte ich auch schließen. In einem früheren Stück Anthem gibt es einen wunderschönen Satz der Hoffnung wider allen Augenschein:
“There is a crack, a crack in everything
That’s how the light gets in.”4
Unsere Brüche, unser Unvermögen, unser Stottern sind es, in denen das Licht der Hoffnung in unsere Welt dringt. Wie in der Berufung des hadernden Mose. Es sind die Risse, die wir zulassen; durch sie scheint, so es Gott gefällt, für uns und für andere Licht herein.
2. DAS ZITTERN MEINER LINKEN HAND
Vielleicht kennen Sie das auch, dass eines Ihrer Körperteile nicht tut, was es soll: Das Ohr pfeift, das Knie scheuert, der Magen krampft. Jede/r hat seine/ihre eigene Achillesferse. Bei mir ist es (neben ein paar anderen Macken) gerade meine linke Hand. Sie zittert. Das tut sie eigentlich schon immer, so lang ich denken kann. Essentieller Tremor. Nicht weiter schlimm. In den letzten Jahren ist es nur intensiver geworden. Was recht lästig werden kann, etwa beim Halten von Suppenschälchen bei Empfängen. Als ich einen Facharzt noch einmal dazu befragt habe, meinte er lapidar: „Na, Ihre Rechte zittert ja ebenfalls. Das fällt nur nicht so auf.“ Auch nett.
Wenn am eigenen Körper etwas nicht richtig funktioniert, fehlt oder seltsam aussieht, bekommt die Sache für einen persönlich oft mit einem Mal einen besonderen Wert. Ich habe etwa 48 Jahre lang nie auch nur im Geringsten das wahre Wunderwerk meines Schultergelenks gewürdigt, bis ich es mir gebrochen hatte. Was meine linke Hand betrifft: Ich finde mittlerweile Neurochirurgen, Pianisten und Bogenschützen faszinierend. Dr. Derek Shepherd in „Grey’s anatomy“, den Musiker Don Shirley in „Green Book“ oder Russell Crowe als „Robin Hood“. Alles Helden, die ihre Taten mit „ruhiger Hand“ vollbringen. Ein Ausdruck für aufreizende Gelassenheit, kompetente Souveränität, tiefen zen-artigen Einklang mit sich selbst. Geht mit meiner Hand leider alles nicht. Meine Linke zittert (schon gut, die Rechte auch). Von daher ist es auch perspektivisch gut, dass ich Pfarrer geworden bin. Beim Segnen hat das Zittern eher eine magische Wirkung (auf jeden Fall besser als bei einer Gehirn-OP).
Nun will ich mich gar nicht beschweren. Handicaps gehören zum Menschsein dazu. Was wäre unsere Menschheit ohne die Gehandicapten. Moses hat wohl gestottert. Sokrates war ausnehmend hässlich. Aristoteles Epileptiker. Thomas von Aquin adipös. Bei Mozart besteht Verdacht auf Tourette-Syndrom. Frida Kahlo litt an Kinderlähmung und Spina bifida. Stephen Hawking an der degenerativen Nervenkrankheit ALS. Helen Keller war taubblind. John Nash schizophren. Jürgen Habermas kam mit einer Gaumenspalte zur Welt. Und Lady Gaga hat neben Bulimie eine Auto-Immun-Krankheit.
Wie wäre die Geistes- und Kulturgeschichte eigentlich verlaufen, wenn man zu früheren Zeiten schon eine umfassende Pränataldiagnostik hätte durchführen können: „Herr und Frau Einstein, ich muss Ihnen leider mitteilen, Ihr Kind könnte möglicherweise behindert sein“? Wir hätten lauter kerngesunde Schaufensterpuppen, mit ruhigen Händen.
Ohne körperliches oder psychisches Leiden wegreden zu wollen: „Behinderung“ ist der treffende Ausdruck für die Unfähigkeit einer Gesellschaft, mit der besonderen Eigenart und den Einschränkungen von Menschen umgehen zu können.
In Kindheit und Alter gehören Handicaps ohnehin flächendeckend dazu. Angesichts einer durchschnittlichen Lebenserwartung von etwa 80 Jahren ist es schon verwunderlich, dass wir ungefähr ein Drittel unseres Lebens zwischen 15 und 40 als „normal“ ansehen und den Rest als „handicap-time“.
Eine zentrale Frage ist, wie ich lerne, mit meinen Einschränkungen und Behinderungen umzugehen. Nicht nur praktisch (Suppe vermeiden), sondern auch im Blick darauf, wie ich mich, mein Leben, Gott verstehe.
In der Bibel spielt das eine große Rolle. Etwa in den Berufungsgeschichten von Prophet/innen. Sie laufen meist nach einem ähnlichen Schema ab. Gott beauftragt einen Menschen. Der sagt, dass er zu klein, dick, dumm und hässlich und überhaupt zu ungeschickt sei. Und Gott sagt, dass er es trotzdem tun soll, weil er mit ihm ist. Das finde ich hilfreich, dass ich mich in meiner „Bestimmung“ nicht durch meine Behinderung beschränken lassen sollten.
Eine ältere Besucherin unserer Akademie, die nur noch sehr schwer hören und laufen kann, hat das einmal auf eindrückliche Weise ausgedrückt: „Ich lasse mir durch meine Krankheit doch nicht vorschreiben, was ich tue oder nicht.“
Eine besonders intensive Auseinandersetzung mit eigenem Leiden findet sich bei Paulus. Es ist eine Stelle von tiefer persönlicher religiöser Erkenntnis – und zugleich eine Stelle, die in der Kirche viel Unheil angerichtet hat. Paulus spricht dort von einem „Pfahl im Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.“ (2.Kor 12,7–10)
Die Verse sind in der Geschichte der Christen oft als eine religiöse „Umwertung aller Werte“ (Nietzsche)5 verstanden worden: „Wenn ich schwach bin, so bin ich stark.“ Eine Sichtweise, die dann alles Starke, Schöne, Kluge ... suspekt erscheinen lässt – und in Schwachheit, Leiden, Krankheit umgekehrt einen positiven Wert an sich sieht.
Was für ein Unsinn! Und was für ein madenwurmiges, popeliges Denken, das glaubt, Gott näher zu sein, indem es sich selbst – und andere – immer kleiner, grauer, hässlicher macht. Gott hat überhaupt kein Problem mit meiner Schönheit. Und auch nicht damit, wenn ich klug, stark, gesund bin. Im Gegenteil: Er hat mich schließlich so geschaffen. Das Zittern meiner Hand ist kein Zeichen besonderer Heiligkeit.