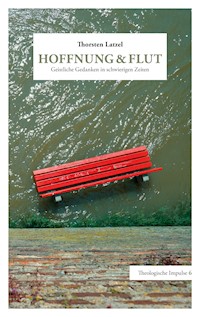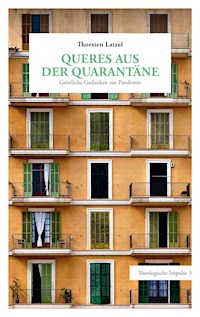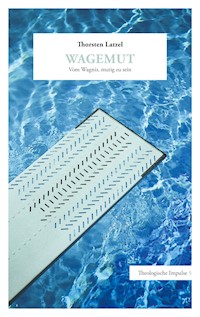
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Serie: Theologische Impulse
- Sprache: Deutsch
"Wagemutig" - das steht für couragiert, kühn, verwegen. Was gibt uns den "Mut, mutig zu sein" - und auch so zu leben? Gerade in Zeiten, in denen die Welt auf dem Kopf steht, ist es wichtig, nach den Quellen des eigenen Lebensmutes zu fragen. In den Essays geht es u.a. um Lebensmut, Tee-Beutel-Sprüche, geistigen Mumpitz, den Umgang mit Ängsten, Noahs fatales Schweigen, den Sinn langweiliger Texte, schrecklich-schöne Jahre, knarzende Schlafzimmertüren, die Kunst, abschiedlich zu leben - und darum, wie Gott zum ersten Mal jazzte.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 125
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Anette, Josephine, Charlotte und Julius
INHALT
Vorwort
Von knarzenden Schlafzimmertüren & den Störgeräuschen der Anderen
„... und Gott jazzte“
Tee-Beutel-Sprüche
Im Spiegel der Angst
Vom eigenen USP & der Unverfügbarkeit Gottes
Mumpitz, Firlefanz & Kokolores
Von Ausreden und vom einander Ausredenlassen
Von Kreuzwort-Rätseln & dem Geheimnis des Liebens
Von SUVs, der Arche & Noahs fatalem Schweigen
Einander Priester/-in sein in Zeiten der Pandemie
„Wie lange noch ...“
Verlieren lernen
Wider die Einsamkeit
Annus horribilis oder mirabilis – Was wird aus 2020?
Der Morgengesang des alten Priesters
Wurzeln, Advent & der Sinn langweiliger Bibeltexte
Der Stall in unseren Häusern
Auf dem Berge Nebo oder: Abschiedlich leben
Vom Raufen der Zeit
Anmerkungen
VORWORT
„Ohn' eine Tat zu wagen, trennt man sich.
Der Versammlungen gar viel
sah ich, wie diese, ohne Zweck und Ziel, [...].
Handelt sich's nur um weisen Rat?
An Ratsherrn wird es nie gebrechen.
Doch gilt's entschlossne, frische Tat –
ja, Freund, dann ist kein Mensch zu sprechen!“1
„Wage-mutig“ – was für ein wundervolles Wort! Nicht „waghalsig“, das wäre überzogene Tollkühnheit und (nach Aristoteles) das andere Extrem im Gegenüber zur Feigheit. Leichthin den Hals und mit ihm Kopf, Kragen, Leib und Leben zu riskieren, ohne Sinn und Verstand. Aber eben auch nicht der Ratsherren und -damen vermeintlich weise Sesselsitzigkeit: eine gremiale Bedenkenträgerkultur, die Reden mit Handeln verwechselt und leider auch kirchlich allzu oft anzutreffen ist.
„Wage-mutig“ – das steht für couragiert, kühn, verwegen, risikobereit. Nimmt man’s genau, ist es noch einmal von „tapfer“ zu unterscheiden: Beschreibt „wagemutig“ die Bereitschaft, ein Wagnis überhaupt einzugehen, so „tapfer“ die Durchhaltekraft, die damit verbundenen Widerstände standhaft auszuhalten.
„Wagemutig“ – das weckt archaische Bilder: Dürers Kupferstich „Ritter, Tod und Teufel“ (1513) oder Captain Jack Sparrow auf dem Deck der Black Pearl. Klingt fast schon etwas überladen, „wagen“ und „mutig sein“. Pleonastisch, doppeltgemoppelt. Doch genau darum geht es: den Mut haben, mutig zu sein.
Die Idee der Aufklärung hat Kant einmal mit dem antiken Satz „sapere aude“ beschrieben: Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes – ohne Anleitung eines anderen – zu bedienen. Die Idee der Reformation ließe sich in Entsprechung dazu als „fidere aude“ formulieren: Habe Mut, der unbedingten Liebe Gottes zu vertrauen ohne Absicherung durch irgendetwas anderes. Will man dieses „Vertrauen“ noch näher beschreiben, so geht es um ein „audere aude“, eben um jenen Mut zweiter Ordnung, um den „Mut, mutig zu sein“: Habe Mut, dich selbst zu wagen, verwegen du selbst zu sein, dein Leben zu riskieren – aus Liebe für andere. Im Vertrauen darauf, dass Gott dich im Letzten trägt. Leben, Liebe, Freiheit sind letztlich ohne solchen Wagemut nicht zu haben. Poetisch formuliert mit dem Grabspruch von Hilde Domin: „Ich setzte den Fuß in die Luft, und sie trug.“2
Anfang der 20-er Jahre unseres Jahrhunderts stehen wir vor Herausforderungen, die einem leicht die Hoffnung rauben können. Ein drohender Klimakollaps – mit nahenden Kipp-Punkten, die wir nicht mehr rückgängig machen können, und mit dauerhaft massiven Folgen für das Leben auf der Erde. Eine Pandemie, die soziale Ungerechtigkeiten weltweit weiter vertieft und die Ärmsten noch ärmer macht. Ein sich anbahnender neuer Kalter Krieg zwischen den USA und China. Die Liste ließe sich schnell erweitern, mit den dazukommenden Problemen im persönlichen Umfeld jeder bzw. jedes Einzelnen.
Die Frage: „Was gibt uns den Mut, mutig zu sein?“, gewinnt angesichts all dessen besondere Bedeutung. Vor 500 Jahren verteidigte Martin Luther seine Glaubensüberzeugungen auf dem Reichstag zu Worms. Die folgenden geistlichen Impulse handeln davon, wie Glaube als „lebendige, verwegene Zuversicht“ helfen kann in schwierigen Situationen wagemutig zu handeln.3 Es geht darum, dem eigenen Gewissen zu folgen, Haltung zu zeigen und Gott zu vertrauen. Um wagemutig zu leben und zu handeln, ist es hilfreich, sich selbst in der Gemeinschaft mit den Mutigen anderer Zeiten und Weltgegenden zu erfahren. Mit Menschen, die es wagten, gegen allen Augenschein ihren Fuß „in die Luft“ zu setzen – und die dabei erfuhren: „Sie trägt!“ Was gibt Menschen den Mut, sich heraus, hervor, hinein zu wagen? Was ist ihre Hoffnung wider allen Augenschein? Und was macht sie frei, auf ihre innere Stimme zu hören und mutige Zeichen zu setzen, wo andere nur vom Untergang oder der Macht der Verhältnisse reden?
Gewissen befreien – Haltung zeigen – Gott vertrauen. Die hier gesammelten Impulse kreisen um die Frage, wie wir die kleinen und großen Luft-Schritte wagen, die unsere Zeit braucht.
Alle Texte stammen aus dem Jahr 2020 und wurden für die Buchfassung nur leicht redigiert und mit Anmerkungen versehen. Ein herzlicher Dank gilt wie immer meiner Frau Anette für ihr kluges Korrekturlesen. Es hat Sie, liebe Leser/innen, und mich vor Schlimmeren bewahrt.
1. VON KNARZENDEN SCHLAFZIMMERTÜREN & DEN STÖRGERÄUSCHEN DER ANDEREN
Unsere Schlafzimmertür knarzt. Das ist ihr gutes Recht. Immerhin ist sie schon über einhundert Jahre alt. Wenn ich einmal so alt bin, werde ich auf jeden Fall auch knarzen. Habe ich mir fest vorgenommen. Bei unserer Tür nervt das Geräusch aber trotzdem. Vor allem, weil die Schlafzeiten von meiner Frau und mir stark auseinandergehen. In der Wissenschaft spricht man hier von verschiedenen Chronotypen, „Lerche“ bzw. „Eule“.4 Das klingt ornithologisch klug, geradezu poetisch. Hilft in der Sache aber nicht wirklich weiter, da Lerchen und Eulen selten gemeinsame Schlafzimmertüren haben. Von Vorteil ist es dann schon eher, wenn man einen gesunden Tiefschlaf hat – oder, wie ich, einfach nicht so gut hört.
Das Knarzen von Schlafzimmertüren: Es gehört zu den kleinen oder großen „Störgeräuschen der Anderen“ im Getriebe der Welt. Das Klackern der Kollegen mit dem Kugelschreiber im Büro, das Chipstüten-Rascheln im Kino, die Laut-Telefonierer im Zug mit den zwangs-kollektivierten Intimitäten: „Schatz, ich wollte bloß mal hören, was bei Deinem Besuch bei der Ärztin herausgekommen ist.“ Nein, sharing ist hier kein caring. Von unsinnigen Erfindungen wie Laubbläsern oder Auspuff-Tuning ganz zu schweigen, vor allem in der Nachbarschaft. Noch schlimmer, weil gesundheitsgefährdend: die Belastungen durch Straßen-, Bahn- oder Fluglärm, bei dem die Mobilität der einen die Lebensqualität der anderen massiv beeinträchtigt. Es ist kein Zufall, dass Robert Gernhardt in seiner Parodie „Gott. Das elfte Gebot“ (1996) Gott die Aufforderung „Du sollst nicht lärmen!“, mit rund dreitausendjähriger Verspätung diesmal am Feldberg offenbaren lässt.5 Mitmenschen sind etwas Feines – solange sie einem nicht auf die Ohren gehen.
Der Krach der Anderen. Es gibt verschiedene Wege, wie gegenwärtig darauf reagiert wird. Rein technisch etwa durch Active-Noise-Cancellation (ANC) – eine Eigenschaft von neueren Kopfhörern, bei der Schall durch spiegelbildlich erzeugte Anti-Schall-Wellen in der Wahrnehmung reduziert wird (destruktive Interferenzen). Funktioniert erstaunlich gut bis zu einem gewissen Grad. Von Stille im eigentlichen Sinn ist man damit freilich immer noch weit entfernt. Der Boom von Meditations- und Achtsamkeitsübungen – eine andere Reaktionsweise auf den Lärm der Zeit – ist dafür ein Zeichen.
„Stille“ meint dabei etwas anderes als die Abwesenheit von störenden Geräuschen. Es beschreibt eine Zeit der Konzentration, einer wirklichen Begegnung: mit sich selbst, mit anderen, mit Gott. Eine Zeit, um emotional Ordnung zu schaffen, sich Ängsten zu stellen, auf die innere Stimme, das eigene Gewissen zu hören. Stille ist die Zeit zum Lesen, Denken, Beten. Auch dazu bedarf es einer gewissen äußeren Geräuschkulisse. Das Blättern der Seiten, den eigenen Puls, den Atem der anderen, das Ticken der Uhr. Wir können nicht nicht-hören. Und es ist gut, sich vor einer Verabsolutierung von Stille zu hüten. Völlige Stille als Entzug jedes Außenreizes führt als „sensorische Deprivation“ (Sinnesentzug) zur Desorientierung – und ist eine Form der Folter. Absolute Stille bietet allein der Tod. Als Menschen sind wir exzentrische Wesen, die ihre Mitte außerhalb ihrer selbst haben. Säuglinge werden gestillt, auch indem sie den Herzschlag der Mutter spüren. Wir brauchen nicht Lärm, aber den rechten Klang von außen, damit in uns selber etwas schwingt.
Die Aufforderung: „Sei ganz bei dir selbst!“, beliebt in spirituell aufgeladener Werbung, löst bei mir deswegen immer ganz unspirituelle Magenkrämpfe aus. Es lebe das religiöse Monadentum der Konsumgesellschaft: Was kümmert mich das Leid der Welt, solange ich Klangschale und Räucherstäbchen in meinem Apartment habe? Nein: Stille, wahre Stille fördert Begegnung und sensibilisiert – für mich selbst, für Gott, für andere. In der antiken Philosophie, bei den Anhängern des Pythagoras, gab es die Idee der „Sphärenmusik“6: ein harmonischer Zusammenklang von Tönen, die durch die Bewegung der Himmelskörper und deren mathematisches Verhältnis zueinander entstehe. Als Menschen würden wir sie nur nicht wahrnehmen, weil sie uns die ganze Zeit umgebe. Rein physikalisch teile ich die Skepsis, die diese Theorie vor allem bei empirisch orientierten Denkern erfahren hat. Als Metapher ist sie freilich stark: dass die Welt, das Leben einen Klang hat. Dass Stille etwas mit Hören-Lernen zu tun hat. Dass es in ihr – christlich gesprochen – um einen Bezug zur Liebe Gottes geht, die als „alles bestimmende Wirklichkeit“7 die ganze Welt als Schöpfung durchdringt.
In einer so verstandenen Stille ziehe ich mich zwar aus dem „Lärm der Zeit“8 zurück, aber gerade um den Anderen, der Welt auf neue Weise zu begegnen. Und ich erfahre in ihr, dass ich den „Klang der Anderen“ brauche. Damit ich mehr bin als ein von Kaufhaus-Musik berieselter Konsument, mehr als ein durch Kopfhörer abgeschotteter Eremit neben anderen, mehr als die Quelle der Lärmbelästigung für meinen Nachbarn. Stille, so verstanden, ist eine Zeit, in der ich mich darin übe, etwas zum Klang, nicht zum Krach im Leben meiner Mitmenschen beizutragen. Mit Worten und Taten, die aus der Stille kommen und der Stille des Anderen dienen.
Vor Kurzem habe ich übrigens gemeinsam mit meiner Frau unsere Schlafzimmertür gefettet und geölt. Beide Türzapfen, mehrmals, intensiv. Jetzt knarzt sie fast überhaupt nicht mehr. Nur noch auf den entscheidenden letzten Zentimetern, kurz vorm Schließen. Das dafür aber ziemlich verlässlich. Weil dann ihre Holzverankerung in der Türzarge arbeitet. Soviel Eigensinnigkeit nötigt schon wieder Respekt ab. „Ach, weißt du“, meinte meine Frau nach dem gefühlt siebenunddreißigsten Versuch, „irgendwie mag ich das Geräusch von der Tür ja auch. Das hat so etwas Vertrautes.“ Es erinnert ein bisschen an die lose Fliese in der Küche in einer unserer früheren Wohnungen, kurz vor der Treppe in den Keller, die immer so hübsch geklackert hat, wenn jemand draufgetreten ist. Aber das ist eine andere Geschichte.
2. „... UND GOTT JAZZTE“
Eine kleine Theologie der Improvisation
Jazz gilt musikalisch weithin als Inbegriff von Improvisation. Entstanden aus einer Verschmelzung von Spirituals, Field Hollers und Blues, entwickelt er sich Anfang des 20. Jh. als eine Stilrichtung, in der vor allem Afroamerikaner/People of Color ihre Lebens– und Leidenserfahrungen kreativ-befreiend verarbeiteten. In ihm spielt Improvisation eine zentrale Rolle – als Erfahrung spontaner, freier, kreativer Individualität.
Die Frage, wann diese dem Jazz zu Grunde liegende Idee in die Welt kam, lässt sich – biblisch betrachtet – recht eindeutig beantworten: im zweiten Kapitel des ersten Buches Mose, der Genesis. Noch genauer gesagt in Vers 18: „Und Gott, der HERR, sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei.“ Es war der Moment, in dem „Gott jazzte“. Die Einsamkeit des Menschen veranlasste Gott zu einer improvisierenden Reaktion ganz eigener Art. Und in der kurzen, nüchternen Feststellung und in dem folgenden Handeln Gottes klingt theologisch das an, was später den Jazz musikalisch ausmachen wird:
die spontane, kreative Interaktion, hier als Gottes „Response“ auf den „Call“ der menschlichen Situation,
der „Off-Beat“, der in den bis dahin wohlgeordneten, gleichförmigen Gang der Schöpfung hineinkommt,
die Verarbeitung der ersten Disharmonie („nicht gut“),
die leidgeborenen, neuen Blues-Zwischen-Töne, die als „Blue Notes“ darin mitschwingen,
und die Entstehung völlig neuer kreativer Individualität („Eva“) durch die umgestaltete Tradition („Rippe“).
In diesem Sinne: Der Versuch einer kleinen Theologie der Improvisation in fünf Stationen.
1. Station: Anfangen
„Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer. Und es war finster auf der Tiefe. Und der Geist Gottes schwebte auf dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht! Und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Da schied Gott das Licht von der Finsternis und er nannte das Licht Tag und die Finsternis Nacht. Da ward aus Abend und Morgen der erste Tag.“ (1. Mose 1, 1–5)
Die Bibel beginnt – ebenso wie die Schöpfung, von der sie erzählt – mit einer Komposition, nicht mit einer Improvisation. Die Erschaffung von Himmel und Erde in einem wohlgeordneten, festen Schema von sieben Tagen. Stets der gleiche Ablauf: „Und Gott sprach ... und es geschah.“ Immer ein harmonischer Schlusston: „Und siehe, es war (sehr) gut.“ Alles zur rechten Zeit und am rechten Ort. Eine große, harmonische, allumfassende Komposition. Es ist die tiefe, letzte Gewissheit, die wir als Menschen – wie das Volk Israel im Exil – brauchen, um mit den tiefen Unsicherheiten des Lebens irgendwie klarkommen zu können: Dass die Chaos-Mächte eine Grenze haben. Dass das Dunkel nicht ewig dauert. Dass auf jede Nacht ein neuer Tag folgt. Dass alle Lebewesen ihren Platz haben. Dass es genug für alle gibt. Dass Sonne, Mond und Sterne für uns geschaffen sind. Dass es gut ist, dass es uns gibt. Das kann helfen, mit der Erfahrung von Fremde, Trauer, Verlust umzugehen. Mit den Tagen, den Jahren, wenn alle Pläne über den Haufen geworfen werden. Wenn einem die Hoffnungen entgleitet. Wenn das Leben völlig anders verläuft als gedacht und gewünscht.
Dem entgegen steht der Trost aus einer tiefen himmlischen Harmonie: Gott komponiert, er improvisiert nicht. Wie könnte es auch anders sein: „Im-provisieren“ heißt wörtlich „nicht vorhersehen“. Mit etwas Überraschendem, Unerwartetem umzugehen, das einem in einer Situation geschieht.
Gott aber, so erzählt es die erste Schöpfungsgeschichte, ist eben nicht in der Welt, sondern schafft die Welt. Er schafft aus dem Nichts. Die göttliche Komposition als letzter Halt, wenn einem alles im Leben verlorengeht. Und als tiefer Grund, um selbst improvisieren, mit dem Unvorhersehbaren umgehen zu können – auch wenn wir die Komposition selber niemals ganz verstehen.
2. Station: Alleine, nackt und vergänglich sein
„Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan, und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren, und flochten sich Feigenblätter zusammen und machten sich Schurze.“ (1. Mose 3,7)
Die Improvisation beginnt dann gleich in der zweiten Erzählung von der Schöpfung. Sie beginnt damit, dass für den Menschen unter allen Lebewesen kein Gegenüber gefunden wird. Gott macht den Menschen aus Lehm, bläst ihm den Lebensodem in die Nase, setzt ihn in den Garten in Eden, dass er ihn bebaue und bewahre. „Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen; aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach.“ (1. Mose 2,20) Er ist bei allem Leben um sich herum im Letzten einsam. So die erste Erkenntnis über das „Mängelwesen“ Mensch (A. Gehlen).
Und die Improvisationen setzen sich fort. Schon bald, nach dem Griff nach der verbotenen Frucht, werden die Menschen selbst erkennen, dass sie nackt sind. Nun bastelt zunächst der Mensch sich notdürftig Kleidung. Später wird Gott ihnen Röcke aus Fellen machen. Und zugleich erfährt der Mensch die Vergänglichkeit seines Lebens: „Staub bist du und zum Staub kehrst du zurück.“ (1. Mose 3,19)