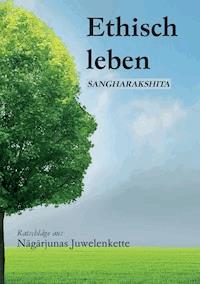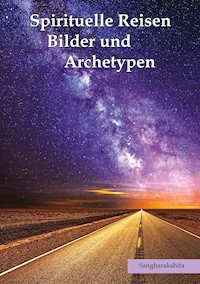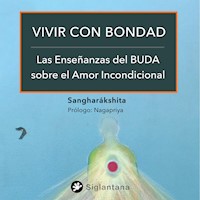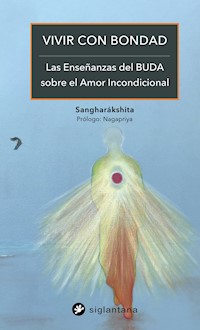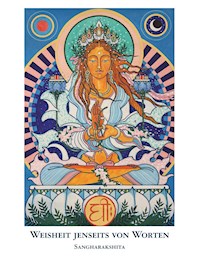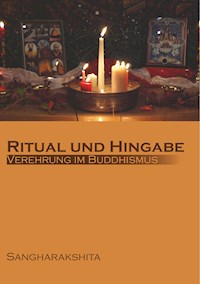
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Viele Menschen im Westen erleben die Übung von Verehrung und Hingabe als sehr konfrontativ und ignorieren diesen Teil der buddhistischen Praxis gerne. Sangharakshita lenkt uns gekonnt durch Schwierigkeiten hindurch, die uns dabei begegnen können. Er zeigt auf, welche wesentliche Rolle Rituale und Ehrerbietung im spirituellen Leben spielen, da sie die Sprache des Herzens sprechen. Er leitet uns durch die Siebenfältige Puja, eine poetische Abfolge von spirituellen Stimmungen, und vermittelt uns ein Gefühl für die Tiefe spiritueller Praxis, die sich durch Rezitation, Opfergaben und Mantras offenbart.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
ÜBER DEN AUTOR
Urgyen Sangharakshita – bürgerlich Dennis Lingwood – wurde 1925 in London geboren und starb 2018 in Adhisthana in Herefordshire, Großbritannien (siehe www.adhisthana.org).
Als junger Mann lebte er in Indien, wo er über zwanzig Jahre den Buddhismus unter Lehrern verschiedener Traditionen (Theravåda, Mahåyåna und Vajrayåna) übte und studierte. 1967 kehrte er nach England zurück und gründete die Freunde des Westlichen Buddhistischen Ordens (FWBO). Inzwischen entstand daraus eine internationale Bewegung mit Zentren in der ganzen Welt. 2010 wurde die Gemeinschaft umbenannt und heißt heute Buddhistische Gemeinschaft Triratna.
Heute zählt Sangharakshita zu den wichtigsten Lehrern des Buddhismus im Westen und ist als Autor zahlreicher Bücher bekannt. Er versteht sich vor allem als „Übersetzer“ – zwischen Ost und West, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Prinzipien und Methoden. Seine Bücher wurden bisher in 30 Sprachen übersetzt.
INHALT
Vorwort des Herausgebers
Emotionale Energie und spirituelles Streben
Die Psychologie des Rituals
Ursprünge der Siebenfältigen Puja
Wie wir uns der Siebenfältigen Puja nähern können
Verehrung
Opfergaben
Begrüßung
Zufluchtnahme
Eingeständnis von Fehlern
Lob des Guten
Bitte um Belehrung und Verweilen
Abgabe der Verdienste und Selbsthingabe
Abschließende Mantras
Siebenfältige Puja
Begriffserläuterungen
Hinweise zur Schreibung und Aussprache
Adressen
VORWORT DES HERAUSGEBERS
Jeder westliche Buddhist heute ist durch einen Prozess der Verwandlung gegangen oder tut es vielleicht noch. Selbst wenn Sie wie der 16-jährige junge Mann, der Sangharakshita wurde, eines Tages klar entdecken, dass Sie Buddhist sind und es immer schon gewesen sind, durchlaufen Sie zumindest einen Prozess, um diese Tatsache bewusst zu verinnerlichen. Sie beginnen zu benennen, was für Sie bisher namenlos war, untersuchen in der Sonne des Tageslichts, was Sie vorher nur im dämmerigen Schatten wahrgenommen haben.
Einer der großen Vorteile dieses bewussten Verwandlungsprozesses ist, dass Sie die spirituellen Praktiken ihres gewählten Weges nicht für selbstverständlich halten, so wie jemand, der vielleicht in einer bestimmten religiösen Tradition aufgewachsen ist. Diejenigen, die in traditionellen Gesellschaften oder eng zusammengewachsenen Gemeinschaften leben, die sich auf eine einzige Religion beziehen, mögen bestimmte Bräuche aufrechterhalten, nur weil ihre Familien und Nachbarn dies tun. Sie mögen sich an speziellen Praktiken und Traditionen erfreuen oder Trost in ihnen finden, weil sie mit ihnen von Kindesbeinen an vertraut sind, ohne notwendigerweise ihre Bedeutung ganz zu verstehen. Diese Möglichkeiten sind für einen „Bekehrten“ versperrt, der üblicherweise den Sinn der spirituellen Praxis erkennen möchte, der er oder sie sich verpflichtet: Was ist ihr Nutzen? Wo kommt sie her? Passt sie zu mir? Wir möchten Antworten auf diese Fragen bekommen, insbesondere wenn die Praxis uns nicht unmittelbar anspricht oder eine Menge Anstrengung kostet – oder uns nur ein wenig rätselhaft erscheint.
Auch wenn wir nicht genau wissen müssen, wie und warum etwas funktioniert, um eine Wirkung zu haben, ist ein Forschergeist generell gesund und hilfreich für das spirituelle Leben. Wir werden uns wahrscheinlich stärker für die spirituelle Praxis engagieren und bewussteren Gebrauch von ihr machen, wenn wir etwas über ihre Bedeutung und Funktion verstehen. Nichtsdestotrotz hat der Wunsch, alles über eine Sache zu verstehen, in die wir uns vertiefen, wie viele positive Geisteszustände einen „nahen Feind“, für den vor allem wir Westler anfällig sind. Der „nahe Feind“ ist die Haltung, dass wir die Bedeutung einer Sache allein durch den Intellekt vollständig durchdringen können, wenn wir etwas nur gründlich genug konzeptualisiert haben, wenn wir alles über etwas zu wissen meinen. Ein Buddhist, der erklärtermaßen nach einem direkten Wissen über die Realität jenseits aller Konzepte strebt, sollte natürlich nicht in solches Denken verfallen. Und trotzdem ist unsere Konditionierung durch die westliche Tradition des wissenschaftlichen Rationalismus stark und stützt fast unvermeidlich die verborgenen Ansichten hinter unseren Gedankengängen.
Ein anderer heimlicher Feind bei unserer Suche nach Erkenntnis ist einfach der Wunsch nach einer fertigen Meinung über eine bestimmte Sache, die wir in Unterhaltungen einbringen oder erneuern können, wenn herausfordernde Fragen aufgeworfen werden. Dieses Verlangen führt uns dazu, eine Myriade von Informationsschnipseln – und oft Fehlinformationen – aus zweiter Hand aufzuschnappen und für später zu sammeln, ohne etwas aus eigener Erfahrung, aus Studium oder Reflektion wirklich zu wissen. Eines der Probleme, denen Sangharakshita bei seiner Rückkehr nach England gegenüberstand, nachdem er zuvor zwanzig Jahre in Indien gelebt hatte, war das große Ausmaß an Fehlinformationen, die unter den englischen Buddhisten in den 60er Jahren zirkulierte. Vieles von dem Material in diesem Buch geht auf Vorträge und Seminare zurück, die Sangharakshita in den ersten Jahren nach seiner Rückkehr gehalten hat, als er mit großem Geschick und großer Beharrlichkeit dem Durcheinander und den Missverständnissen, die damals vorherrschten, etwas entgegen setzte.
Es gibt vieles über die Ursprünge und Bedeutung buddhistischer Hingabepraxis oder Puja zu erklären. Sangharakshita legt dieses Material mit seiner üblichen Klarheit und Kompetenz dar, erhellt durch den Reichtum an persönlicher Erfahrung, Studium und tiefer Reflektion. Aber dies alles zu lesen und zu verstehen bedeutet nicht, die Puja selbst zu kennen. Puja kann man nur durch das Praktizieren begreifen, durch das Erleben und die Entwicklung von Rezeptivität über eine erhebliche Zeitspanne hinweg, vorzugsweise durch regelmäßige Praxis in Gemeinschaft mit anderen. Solch erfahrungsbezogenes Wissen über die Puja kann uns nicht auf dem Tablett serviert werden. Selbst Sangharakshita kann nicht mehr zwischen diesen Buchdeckeln tun als uns Hinweise zu geben und die Richtung zu weisen. Dieser Band ist deswegen eine Art „Gebrauchsanleitung.“ Er ist ein Begleiter für die Pujapraxis, nicht ihr Ersatz.
Als literarisches Dokument ist das Buch eine bearbeitete Zusammenstellung verschiedener Unterweisungen, die Sangharakshita zum Thema Puja gegeben hat. Die umfangreichste Einzelquelle, die sich im Material der Kapitel 5 und 7 bis 12 sowie in einigen Textteilen der Kapitel 3 und 4 befindet, wurde als Abschrift eines Seminars über die Siebenfältige Puja 1978 erstellt. Die Kapitel 1 und 2 wurden hauptsächlich aus Vorträgen von 1967 bzw. 1968 entnommen, und ein großer Teil von Kapitel 13 stammt aus Vorträgen von 1972. Der Rest des Stoffs umfasst kurze Zusammenfassungen zahlreicher unterschiedlicher Seminare, die Sangharakshita größtenteils in den 80er Jahren geleitet hat.
Um den Text prägnant und lesbar zu machen, wurde der Seminarstoff aus dem ursprünglichen Dialogformat in durchgängiger Prosa wiedergegeben. Verbundene Teile wurden zusammengefasst und Wiederholungen und Aspekte lediglich vorübergehenden Interesses wurden weggelassen. Angesichts der Tatsache, dass Sangharakshita während der ursprünglichen Seminare und Vorträge teilweise auf spezifische Fragen und zu Themen Stellung bezogen hat, die zu der Zeit von besonderem Interesse für die Mitglieder von Triratna (Anm.: im Originaltext FWBO, wird im Folgenden jeweils durch den neuen Namen ersetzt) gewesen sind, kann es sein, dass manchmal die Materialauswahl für die Diskussion ein wenig eigenwillig erscheint. Trotzdem wurde das Material im Text gelassen, so weit es von inhaltlichem Interesse ist und Bedeutung für die Puja hat. An einigen Stellen wurde Text hinzugefügt, der ursprünglich nicht in den Seminaren oder Vorträgen vorkam, um die Argumentationslinie aufrechtzuerhalten oder um Missverständnisse zu vermeiden. Die fertig bearbeitete Endversion wurde selbstverständlich von Sangharakshita frei gegeben.
Im Namen des Spoken Word Project’s möchte ich mich für die Arbeit bei den vielen Menschen bedanken, die unter der Leitung von Dharmachari Silabhadra das Gesprochene von Sangharakshita ins Schriftliche übertragen haben. Ohne ihre harte Arbeit wäre unsere um vieles schwieriger geworden.
Puja ist eine wunderbare, anregende und effektive Form spiritueller Praxis. Sangharakshitas Überlegungen dazu beschenken uns mit einer faszinierenden und inspirierenden Mischung aus spiritueller Lehre, psychologischer Einsicht, historischem und kulturellem Kontext, persönlichen Anekdoten und praktischer Anleitung, verflochten mit freundlicher, aber unwiderstehlicher Ermutigung, die Puja immer tiefer und authentischer zu praktizieren. Dieses Buch wurde in der Hoffnung zusammengestellt, dass seine Leser inspiriert und darin bestärkt werden, genau das zu tun.
Simon Carruth, Spoken Word Project, London, September 1995
1. EMOTIONALE ENERGIE UND SPIRITUELLES STREBEN
Sokrates pflegte zu sagen, das Gute zu erkennen sei ausreichend. Er sagte, das Gute zu tun würde automatisch dem Wissen darüber folgen. Das mag für Sokrates so gewesen sein, ist es aber sicherlich nicht für die große Mehrheit von uns. Wir verfolgen tugendhafte Handlungen keineswegs automatisch wegen des Wissens über das, was richtig ist. Und warum dies so ist, kann man ein wenig aus der Kritik von Aristoteles gegenüber dem Argument von Sokrates erahnen. Er sagte, dass Sokrates generell nicht das berücksichtigt, was Aristoteles die „irrationalen Aspekte der Seele“ nannte.
Die Kontroverse zwischen diesen beiden altgriechischen Philosophen zeigt eines der grundsätzlichen Probleme, die im spirituellen Leben auftauchen: das Problem, wie man Wissen in Sein umsetzen kann. Die Wahrheit zu erkennen und zu verstehen, eine intuitive Ahnung der Realität zu erlangen, ist schwierig genug, aber es in das persönliche Leben und in das eigene Sein zu integrieren ist hundertmal schwerer. Wie viel wir auch immer verstanden haben mögen und wie breit und klar dieses Verständnis auch sein mag, so bleibt es doch sehr schwer, es in die Praxis umzusetzen, in unsere Alltagsaktivitäten und in unser Verhalten. Jeder Buddhist wird das aus eigener Erfahrung wissen.
Der Buddhismus als Ganzes ist sehr mit dieser grundsätzlichen Problematik befasst und die Aufmerksamkeit liegt auf der Unterscheidung, die im Buddhismus zwischen dem Pfad der Schauung und dem Pfad der Verwandlung gemacht wird. Der Pfad der Schauung repräsentiert die anfängliche spirituelle Einsicht oder Erfahrung, die eine Person auf die spirituelle Suche führt. Für eine ganze Reihe von Menschen kommt diese Einsicht oder Erfahrung spontan. Sie trifft sie plötzlich, überwältigt sie sogar: eine unerklärliche Ahnung über die Wahrheit oder zumindest über eine höhere und weitere Dimension des Seins und des Bewusstseins. Für andere mag die anfängliche Einsicht und Erfahrung Resultat von Studium sein, vielleicht während des Lesens eines Buches oder während des Nachdenkens über eine bestimmte Passage. Es mag auch während des Versuchs geschehen, den Geist während der Meditation zu konzentrieren. In der Tat kann diese anfängliche Einsicht zu jeder Zeit und an jedem Ort geschehen, auf jede Weise, entweder spontan oder in Verbindung mit einer besonderen Aktivität, ob sie nun religiös im formalen Sinne sei oder von anderer Art. Wie immer es auch geschieht, es ist das, was im Buddhismus als der Pfad der Schauung bekannt ist.
Der Weg der Verwandlung stellt die Umgestaltung des ganzen Lebens im Einklang mit dieser anfänglichen Schauung dar. Der zweite Weg ist deswegen sehr viel länger und schwieriger als der erste. In der berühmten Formulierung in Buddhas Lehre, die bekannt ist als der Edle Achtfältige Pfad, wird der Pfad der Schauung als der erste Schritt dargestellt, der am besten verstanden wird als „vollkommene Schauung“, auch wenn es weniger hilfreich oft als „rechte Ansicht“ oder „rechtes Verständnis“ übersetzt wird. Der Weg der Verwandlung wird repräsentiert durch alle anderen sieben Schritte des Achtfältigen Pfades: vollkommene Emotion, vollkommene Rede, vollkommene Handlung, vollkommene Lebensweise, vollkommene Bemühung, vollkommenes Gewahrsein und vollkommenes Samādhi1. All diese Schritte stellen die Verfeinerung der anfänglichen Einsicht in unterschiedlichen Aspekten unseres Lebens und unserer Aktivitäten dar.
Aber warum sollte es so schwer sein, das Wissen ins Sein zu übertragen? Warum sind wir nicht alle wie Sokrates in der Lage, das Gute zu wissen und es auch sofort umzusetzen, ohne jede Unterbrechung zwischen den beiden Aspekten? Was ist es in uns, das uns davon abhält, diesen Weg der Schauung zum Weg der Verwandlung in seiner Gänze zu gehen? Es ist nicht schwierig, diese Frage zu beantworten. Die Antwort ist indirekt in einer dieser populären Sprachwendungen zu finden, die manchmal eine Menge traditioneller Weisheit enthalten. Stellen Sie sich vor, jemand ist in einem Projekt engagiert, von dem er meint, dass er es tun sollte, aber er ist nicht ganz bei der Sache und macht deswegen seine Arbeit nicht besonders gut. Unter diesen Umständen sagen wir üblicherweise: “Er macht es halbherzig.”
Er ist nicht mit ganzem Herzen dabei. Mit anderen Worten: er ist nicht emotional beteiligt. Die Energie hängt von Emotionen ab. Wenn es keine Emotion gibt, gibt es keine Energie, keinen Antrieb; und deswegen wird die Arbeit nicht gut gemacht. Wir können diesen Punkt aus unserer Alltagserfahrung nachvollziehen. Wenn dies aber wahr ist für unser Alltagsleben, so ist es vielleicht noch wahrer für das spirituelle Leben. Wir mögen ein bestimmtes Ausmaß an spiritueller Einsicht haben, ein bestimmtes Maß an Verständnis, sogar eine bestimmte Fülle an Erfahrung. Aber wenn es für dieses Verständnis keine emotionale Entsprechung gibt, wird es nicht in unser Leben integriert. Es ist nützlich, uns drei verschiedene Zentren vorzustellen, aus denen heraus wir funktionieren: ein Denkzentrum, ein emotionales Zentrum und ein Bewegungszentrum. (Innerhalb eines speziellen spirituellen Kontextes werden diese zu „höheren Zentren“: ein höheres Denkzentrum oder sogar ein intuitives oder visionäres Zentrum; ein positives emotionales Zentrum und ein Zentrum spiritueller Praxis und Erfahrung). Dabei stellt sich heraus, dass das Denkzentrum das Bewegungszentrum nur über das emotionale Zentrum beeinflussen kann.
Das Verständnis muss sozusagen durch die Emotionen hindurch, bevor es die Art und Weise beeinflussen kann, wie wir unser Leben führen. Dieser Umstand wird durch die Strukturen des Edlen Achtfachen Pfades deutlich gemacht. Der erste Schritt ist die vollkommene Schauung. Der zweite Schritt oder Aspekt ist Vollkommene Emotion (traditionell übersetzt als „rechte Entschlossenheit“). Dadurch wird Vollkommene Emotion der erste von sieben Schritten, durch die die Verwandlung zustande kommt. Die vollkommene Schauung muss durchschritten und übersetzt werden in vollkommene Emotion, bevor sie sich als vollkommene Rede manifestieren kann, als vollkommene Handlung und all die anderen aufeinander folgenden Schritte des Weges. Die wichtige Frage ist, wie diese positive Ursachenkette zu Stande kommen kann. Wie können wir unsere Emotionen in ein spirituelles Unterfangen einbringen? Und dies wiederum wirft weitere Fragen auf: Warum, so könnte man fragen, werden die emotionalen Energien nicht mit eingebunden? Emotionen sind sicher irgendwo in uns – was aber ist mit ihnen passiert? Warum stehen sie uns nicht sofort zur Verfügung?
Diese Fragen können sowohl allgemein als auch spezifisch beantwortet werden. Wenn wir uns zunächst den umfassenderen Fragen zuwenden, können wir sagen, dass es einen generellen Mangel an frei fließender Emotion in unserer Gesellschaft gibt, die zum Teil Resultat unserer notwendigen Sozialisation sein könnte. In einer zivilisierten Gesellschaft kann man seine eigenen groben Gefühle und Emotionen nicht ausdrücken. So könnten Sie das Gefühl haben, jemanden gern umbringen zu wollen, aber Sie können nicht einfach losgehen und das tun. Sie könnten den Wunsch haben, etwas zu stehlen; das bedeutet aber nicht, dass Sie die Freiheit haben, das auch zu tun. Ein bestimmtes Maß an Sozialisation, eine Unterdrückung der gröberen Gefühle ist notwendig. Einige der gerade wirkenden Emotionen – die sich z.B. im Verhalten der Fans beim Fußballspiel ausdrücken – müssen im Alltag unserer Gesellschaft unterdrückt werden. Das Problem ist, dass diese Unterdrückung zu solchen Extremen führen kann, dass für den größeren Teil der Menschen das emotionale Leben ganz erstickt wird – umso mehr, wenn ihre Emotionen generell ziemlich grob und unkultiviert sind. Es gibt dann vielleicht nichts, das man durchgehen lassen darf.
Um dem destruktiven Ausdruck grober Emotionen zuvorzukommen, konditioniert uns die Gesellschaft dazu, Selbstkontrolle zu entwickeln. In den meisten Fällen ist es kein Individuum, das unterdrückt wird; es ist noch keine wirkliche Individualität vorhanden. Letzten Endes streben aber Buddhisten an Individuen zu werden – d.h. über die mehr oder weniger bedenkenlose Bindung an Gruppenwerte hinauszugehen. Aber Menschen müssen positive Gruppenmitglieder sein, bevor sie Individualität entwickeln können. Jemand, dessen Emotionen eher grob und ungebärdig sind, kann damit beginnen, sie zu verfeinern, indem er ein positiv funktionierendes Mitglied einer Gemeinschaft wird, vorausgesetzt, dass die Gemeinschaft eine verhältnismäßig positive ist. Wenn Sie Glück gehabt haben mit ihrer Familie, in die Sie hineingeboren worden sind, oder der Schule, in die Sie gegangen sind, können Sie zu einem gesunden Gruppenmitglied und einem potentiellen Individuum heranwachsen, bereit für den nächsten Schritt. Aber so viele Menschen sind eher wie missgestaltete Tiere, nicht einmal verkrüppelte menschliche Wesen. Ein randalierender Rebell ist nicht notwendigerweise ein Proto-Individuum.
Wir müssen deswegen aufpassen, die Situation nicht zu romantisieren. Ein Fußball-Hooligan ist nicht jemand, der versucht, ein Individuum zu werden. Oft weist er einfach die Notwendigkeit der nötigen Beschränkungen einer positiven Gruppe zurück, als wolle er in einen Zustand animalischer Anarchie und Barbarei zurückfallen. Es ist keineswegs der Fall, dass ein solcher Mensch sich als ein gesundes Individuum entpuppen würde, wenn die Beschränkungen der Gesellschaft beseitigt würden. Das wäre die Sicht von Rousseau: dass die Organisation der Gesellschaft niederträchtig ist und das Individuum unterdrückt wird. Es gibt in der Tat Unterdrückung, aber was unterdrückt wird, ist nicht das Individuum. Wir brauchen Sozialisation, die Disziplin einer Gruppe in einem bestimmten Ausmaß, bevor sie beginnen kann, Individuen hervorzubringen. Jedoch ist es so, als ob die Gesellschaft auf einem solchen Ausmaß an Selbstkontrolle besteht, dass wir aus der Unterdrückung eine unbewusste Gewohnheit machen. Die Selbstkontrolle hört auf bewusst zu sein und wird zu einem Automatismus. Wir können sie auch dann nicht loslassen, wenn die Gesellschaft es gelegentlich erlaubt oder wenn wir uns völlig gerechtfertigte Gefühle erlauben wollen. Es passiert nur allzu oft, dass das sich entwickelnde Individuum durch zu viel Kontrolle zu sehr eingeengt wird. Wenn Individualität aufzublühen beginnt, müssen wir Disziplin, insbesondere unbewusste Disziplin, nach und nach abstreifen, um unsere echten Emotionen zu verfeinern. Ein Individuum, das emotional hoch entwickelt ist, braucht keine äußere oder gar viel innere Disziplin, um sich in positiver und hilfreicher Art zu verhalten.
Verfeinerung der Gefühle – statt Kontrolle – kann sich sogar schon in der Kindheit entwickeln, manchmal in Verbindung mit der Natur oder öfter noch in Verbindung mit Künsten. Das Kind mag etwas Verfeinertes, Musik oder Literatur, erleben und beginnen es zu genießen, obwohl dies natürlich von der Art der Literatur und von der Art der Musik abhängt. Einige Musiksorten sind spürbar feiner als andere. Junge Leute tanzen oft zu Rockmusik und scheinen wie betäubt zu sein, fast wie Roboter – nicht erhoben durch irgendeine Verfeinerung emotionaler Erfahrung, sondern eingetaucht im groben Erleben von Bewegung und Rhythmus. Es scheint dort kaum irgendein Gefühlselement zu geben, auch wenn es wahrscheinlich einen Fortschritt in Bezug auf vollkommen chaotische Energie gibt, weil sie rhythmischer ist und ein Maß an Kontrolle einschließt. Es ist zweifellos besser, auf ein Rockkonzert zu gehen als Bierflaschen herum zu werfen und Fenster einzuwerfen.
Es wird oft vermutet, dass das Leben in Großstädten es für uns sehr schwer macht, mit unseren Gefühlen in Kontakt zu bleiben. Das kann sich sicher so anfühlen, als gäbe es eine Menge Unterdrückung in Städten, aber es gibt dort auch eine Menge Freiheit. Es mag sich anhören, als seien Menschen „ohne Kontakt zur Natur“, aber wir müssen vorsichtig sein, zu schnell Schlüsse zu ziehen. In der Stadt atmen sie trotzdem Luft, Sie können den Himmel sehen, es gibt zumindest einige Bäume. Kümmert sich der durchschnittliche Dorfbewohner zwangsläufig mehr um die Natur? Ich kann mich erinnern, dass einst einige Lepchas aus den Wäldern mein Tor in Kalimpong passierten. Sie schauten zu den Bergen hoch und einer sagte zum anderen: „Ich kann nicht verstehen, warum sich die fremden Besucher andauernd diese Berge anschauen. Was gibt es da zu sehen? Einfach nur ein paar Berge.“ Sie wären lieber jeden Tag in Kalkutta. Auch wenn das Stadtleben einige Nachteile für unsere emotionale Entwicklung bereithält, müssen wir vorsichtig sein, nicht in die „Zurück-aufs-Land“-Romantik und ins ländliche Klischee zurückzufallen. Viele Menschen, die auf dem Land leben, halten die Stadt für einen Ort der Befreiung, weg von den Einschränkungen und der Enge, der Trivialität und des Dogmatismus des Dorfes.
Die Qualität der Kontakte mit Menschen – die Anwesenheit oder Abwesenheit persönlicher Kommunikation – ist ein wichtiger Faktor. Als Faustregel gilt, dass die Emotionen wahrscheinlich eher blockiert oder die nichtblockierten Emotionen einer Person wahrscheinlich eher negativ sind, wenn die Person keine befriedigende Kommunikation mit anderen Menschen hat. Das ist das grundsätzliche Kriterium. Und Sie können Gelegenheiten für echte Kommunikation finden, ob Sie nun auf dem Dorf leben oder in der Stadt. In der Tat können Sie in der Stadt immer gleich gesinnte Menschen finden, woran auch immer Sie Interesse haben. Wenn Sie sich zum Beispiel für Malerei interessieren, können Sie wahrscheinlich Hunderte von anderen Malern in der Stadt finden, während Sie auf dem Dorf möglicherweise keine einzige Person finden, mit der Sie über das sprechen können, was Sie am meisten berührt. Aber wenn Sie in der Stadt leben und nicht irgendeine Gemeinschaft und gleich gesinnte Geister finden, können Sie sich sehr einsam und isoliert vorkommen. Die Art der menschlichen Kontakte, die Sie haben, ist möglicherweise überhaupt nicht befriedigend, und Sie könnten diese riesengroße anonyme Masse von Menschen überall um sich herum bemerken. Dadurch entsteht in gewisser Weise psychischer Druck – was keine gesunde Situation ist. Dennoch besteht in der Stadt zumindest die Möglichkeit zu intensiverem Kontakt, als Sie es wohl in einer Kleinstadt oder auf einem Dorf finden würden.
Wir müssen deswegen aufpassen, nicht einem verallgemeinerten romantischen Rousseauismus oder einem altmodischen Kommunismus aufzusitzen: der Idee, dass Menschen wirklich gute, glückliche, gesunde, positive und freundliche Menschen würden, wenn man nur die sozialen Beschränkungen wegnähme, wenn wir nur das politische System änderten, wenn man sie nur aus den großen, üblen Städten in irgendein Utopia oder Garten Eden brächte. Diese Sicht ist im Allgemeinen ungerechtfertigt. Auch wenn der Buddhismus der Ansicht ist, dass die richtigen Bedingungen Menschen dabei helfen können, sich in positiver Weise zu entwickeln, sind Veränderungen der äußeren Bedingungen nicht immer genug. Sie können manche sehr negative Menschen in scheinbar positiven Umgebungen antreffen. Das kommt daher, weil wir – biologisch gesprochen – ein tierisches Erbe in uns tragen. Wir haben tierische Instinkte, die immer noch sehr stark sind, in vielen Fällen viel stärker als alles andere in uns. Zivilisation und Kultur bilden eine sehr zerbrechliche Struktur, die der Barbarei gewissermaßen nur aufgesetzt ist. Bei unserem Vorgehen gegen das, was in der Gesellschaft falsch läuft, müssen wir aufpassen Zivilisation und Kultur nicht vollständig auszulöschen, in der Annahme, dass es darunter so etwas wie eine ursprüngliche Unschuld gibt. Mit anderen Worten, die Bedeutung einer positiven Gruppe sollte nicht unterschätzt werden, egal wie sehr wir die spirituelle Gemeinschaft schätzen und egal wie sehr die soziale Gruppe, die wir vorfinden, zu den Idealen einer positiven Gruppe tatsächlich auflebt. Sie können nicht geradewegs von primitiver Grausamkeit in eine spirituelle Gemeinschaft hinüber gleiten. Die positive Gruppe wird gebraucht, um die Energien der Menschen positiv und konstruktiv zu sozialisieren.
Dies ist ein kurzer Blick auf den sozialen Hintergrund bezüglich der Schwierigkeit, die wir manchmal im Erleben und im Ausdruck unserer Gefühle erleben – eine Schwierigkeit, die uns davon abhalten kann, unsere Herzen dem spirituellen Leben zu widmen.
Lassen Sie uns nun weitergehen und ein wenig spezifischer darauf schauen, was passiert, wenn wir unsere Gefühle nicht ausdrücken können, und was wir tun können, um die Situation zu verändern. Nach meiner Vorstellung gibt es drei große Bereiche, warum uns unsere Gefühle nicht zur Verfügung stehen: sie können blockiert sein, sie können verschwendet werden oder sie könnten zu grob sein.
Das buddhistische Ritual der Puja ist nur eine von vielen Methoden spiritueller Praxis, das sich mit dem Problem beschäftigt, wie wir unsere Gefühle ins spirituelle Leben bringen können. Die Puja beschäftigt sich teilweise mit dem dritten Bereich, den ich erwähnt habe, der Verfeinerung emotionaler Energien. Gelegentlich mag sie auch den Effekt haben, emotionale Blockierungen zu beseitigen und die emotionale Energie davor zu bewahren, sich zu verschwenden, zumindest für die Zeit, während wir an der Puja teilnehmen. Aber die Untersuchung aller drei dieser Bereiche wird uns helfen, die spezielle Rolle des Rituals im spirituellen Leben zu verstehen. Schließlich können wir nur Energie verfeinern, die uns tatsächlich zur Verfügung steht. Wenn unsere Gefühle blockiert sind oder wir sie regelmäßig verschwenden, haben wir ziemlich wenig Energie übrig, mit der die Puja ihren verfeinernden Zauber bewirken kann.
Bezüglich der blockierten emotionalen Energie berührt Ouspensky, der Hauptschüler von Gurdjieff, einen wichtigen Punkt. In seinem Buch In Search of the Miraculous sagte er, dass Menschen auch nicht annähernd emotional genug seien. Er meint damit, dass unsere emotionalen Zentren nicht frei funktionieren. Die Emotionen fließen nicht natürlich, sie würden irgendwie blockiert. Es ist so, als wenn jemand Sand ins Getriebe geworfen hätte, vielleicht als wir jung waren. Insbesondere von den Engländern wird oft von Menschen anderer Nationen gesagt, dass sie sehr reserviert seien und insgesamt emotional ziemlich blockiert. Als Russe würde Ouspensky dieser Sichtweise sicher zugestimmt haben.
Ob die emotionale Blockierung von Engländern im Vergleich zu anderen Nationen wahr ist oder nicht, so ist sie sicherlich wahr, wenn man Erwachsene mit jungen Menschen vergleicht. Die emotionalen Zentren bei Kindern funktionieren tatsächlich üblicherweise sehr frei. Kinder sind emotional spontan, bis ihre Eltern beginnen, sie zu konditionieren. Natürlich funktioniert das emotionale Zentrum eines Kindes auf einer einfacheren Ebene, aber zumindest arbeitet es frei und natürlich. Bei Erwachsenen ist dies üblicherweise nicht mehr der Fall. Sehr oft werden die Menschen, je älter sie werden, emotional blockiert und unfähig, sich über ihr Herz auszudrücken.
Es gibt für diese Blockade verschiedene Gründe. Einer ist, dass wir uns unter Umständen jahrelang mit Routine- und mechanischer Arbeit beschäftigen müssen, Arbeit, in der wir unfähig sind, unsere emotionalen Energien unterzubringen, Arbeit, die uns schlichtweg nicht interessiert. Die Anstrengungen, die wir in diese Art von Arbeit stecken müssen, haben Belastungen und Schwierigkeiten, Spannung und Verwirrung zur Folge. Sie bauen unangenehme Reaktionen und Nachhalleffekte in uns auf. Insofern wir unsere emotionalen Energien nicht in die Arbeit stecken können, fallen wir in die alte Gewohnheit sie zurückzuhalten, bis die emotionale Energie möglicherweise erstarrt. Zuerst wird sie unbeweglich und klebrig, dann verhärtet sie sich in uns immer mehr und schließlich versteinert sie sogar, so dass wir unfähig sind, irgendeine Vitalität oder Enthusiasmus in Arbeit oder in irgendetwas anderes stecken zu können.
Manchmal entwickeln sich emotionale Blockaden einfach durch Frustration oder Enttäuschung. Viele Menschen finden im Laufe ihres Lebens nie wirklich positive oder kreative Wege für ihre Emotionen, weder durch Arbeit noch durch Freundschaft oder durch sonst was. Einige Menschen wiederum haben Angst, wegen ihrer Emotionen verletzt zu werden, so dass sie nicht das Risiko auf sich nehmen, ihre emotionalen Energien fließen zu lassen. Sie behalten sie sicherheitshalber für sich.