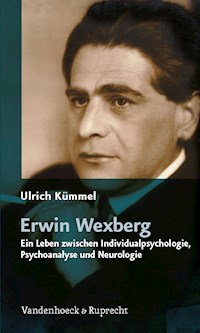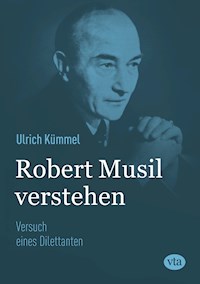
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Dies ist ein Buch für alle, die schon einmal vorhatten, sich näher mit dem Werk Robert Musils zu befassen, sich dann aber angesichts seines Mammutwerks, insbesondere des "Mannes ohne Eigenschaften", überfordert fühlten. Diesen Interessierten fühlt sich der Autor verbunden. Vieles, was beim ersten Lesen Musils irritiert und teilweise sogar Empörung hervorruft, wie etwa die Bedeutung, die Musil dem Sexualmörder Moosbrugger zuteil werden lässt, wurde mit der Zeit verständlicher und klarer. Es ist mir ein großes Anliegen, gerade diese Irritationen, denen sich der Leser anfangs ausgeliefert fühlt, auf meine eigene Art für alle verstehbar zu machen. Dazu habe ich mich zunächst den frühen Novellen Musils zugewandt, die ich vorstelle, ehe ich mich dem "Mann ohne Eigenschaften" und weiteren Texten zuwende. Meine Hoffnung ist, dass durch die Lektüre meines Buches sich einige Leser angeregt fühlen, sich auf diesen oft verkannten, aber genialen österreichischen Schriftsteller (1880-1942) einzulassen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dr. Ulrich Kümmel, geb. 1935, Sozialarbeiter und Sonderschullehrer. Seit 2000 im Ruhestand. Danach eine vierjährige Tätigkeit als Lerntherapeut in eigener Praxis. 2008 Promotion mit einer Arbeit über den Individualpsychologen Erwin Wexberg. Seit 2009 Leitung von kreativen Schreibgruppen im Rahmen von gruppendynamischen Wochenenden und Tagungen der Deutschen Akademie für Psychoanalyse (Berlin).
Inhalt
Einführung
Musils Kindheit und Berichte von Zeitzeugen zu seiner Persönlichkeit
Die frühen Novellen
Herma Dietz: Musils erste längere Beziehung
„Tonka“
Musils Ehefrau Martha, gesch. Marcovaldi, verw. Alexander, geb. Heimann
„Die Vereinigungen“
Erste Fassung der „Versuchung der stillen Veronika“
„Das verzauberte Haus“
„Die Versuchung der stillen Veronika“
„Die Vollendung der Liebe“
Nachlass zu Lebzeiten
Kurzgeschichten
„Die Amsel“
„Der Mann ohne Eigenschaften“
Einführung
„Die vergessene überaus wichtige Geschichte mit der Gattin eines Majors“
Heilige Gespräche
„Die Reise ins Paradies“
Gartengespräche – Gespräche über die Liebe
„Mondstrahlen bei Tage“
„Wandel unter Menschen“
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“
„Gespräche über die Liebe“
„Schwierigkeiten, wo sie nicht gesucht werden“
„Es ist nicht einfach zu lieben“
„Atemzüge eines Sommertags“
Nachwort
Danksagung
Literatur
Jeder sieht am andern nur soviel, als er selbst auch ist; denn er kann ihn nur nach Maßgabe seiner eigenen Intelligenz fassen und verstehen. (Arthur Schopenhauer)
Einführung
Der Mann ohne Eigenschaften zählt zu den berühmtesten und gleichzeitig kaum gelesenen Werken der Weltliteratur. Von Fachleuten wird er als einer der gewaltigsten Romane der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts bezeichnet. Im Katalog der Staatsbibliothek Berlin finden sich 1399 Eintragungen zu Robert Musil. Die meisten Arbeiten stammen von Germanisten und sind für Fachleute geschrieben. Das kann einschüchternd wirken.
Nimmt man als durchschnittlicher Leser Musils Hauptwerk Der Mann ohne Eigenschaften in die Hand, so werden die meisten von uns zunächst einmal einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis werfen und schon hier Zweifel bekommen, ob man dieser Lektüre gewachsen sein werde, denn wir sehen uns bereits im ersten Buch mit 123 Kapiteln und mit noch 38 weiteren Kapiteln im zweiten Buch konfrontiert. Hinzu kommt, dass einige der Kapitelüberschriften für den Laien bizarr und seltsam erscheinen wie zum Beispiel das 1. Kapitel „Woraus bemerkenswerter Weise nichts hervorgeht“, das 13. Kapitel „Ein geniales Rennpferd reift die Erkenntnis, ein Mann ohne Eigenschaften zu sein“, oder das 39. Kapitel „Ein Mann ohne Eigenschaften besteht aus Eigenschaften ohne Mann“, um nur einige der Überschriften herauszustellen. Man braucht also nicht nur Ausdauer, um sich auf dieses Mammutwerk einzulassen, sondern auch eine gewisse Großzügigkeit dem Autor gegenüber und Zutrauen, dass die Mühe sich schon lohnen und am Ende auszahlen wird.
Ein Sprichwort sagt: Einen Menschen verstehen heißt, die Wege gehen, die er gegangen ist. Vielleicht kann man daraus auch folgern: Das Hauptwerk eines Schriftstellers verstehen heißt, zunächst seine kleineren Werke zu verstehen suchen, um sich erst danach seinem Hauptwerk zu widmen.
Ich werde zunächst einige Ereignisse von Musils Kindheit und Jugend, die mir für ein Verständnis seiner Person und seines Werkes wichtig erscheinen, schildern, um dann im Folgenden kleine Schriften und Novellen Musils aus meiner persönlichen Sicht darzustellen, wobei die Reihenfolge der Texte meinen Weg der Annäherung an Musil aufzeichnet, aber nicht den Anspruch erhebt, Musils schriftstellerische Entwicklung bis hin zu seinem Hauptwerk vollständig zu beschreiben. Zum Abschluss der Werktexte widme ich mich Ausschnitten aus den zu Lebzeiten Musils unveröffentlichten Texten eines geplanten dritten Bandes: Aus dem Nachlass.
Nachdem Musil sich als junger Mann entschloss, die ihm offen stehende und zu seiner Zeit höchst attraktive Offizierskarriere abzulehnen, wandte er sich der Naturwissenschaft zu. Die frühen Jahre des 20. Jahrhunderts waren durch einen schier unbegrenzten Fortschrittsglauben geprägt, dem sich der junge Musil begeistert anschloss. Er entschied sich zu einer Ausbildung zum Ingenieur und legte 1901 im Alter von 21 Jahren sein Examen als Ingenieur im Fachbereich Maschinenbau ab. Danach war er kurzfristig als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Technischen Hochschule Stuttgart tätig. Die routinemäßige Arbeit an diesem Institut ernüchterte ihn und die Lebensweise seiner unmittelbaren Berufskollegen desillusionierte ihn. Er konnte sich nicht vorstellen, sein ganzes Leben einer solchen Tätigkeit zu widmen. Musil war allerdings durch sein Studium geprägt und seine Begeisterung für die sich durch Technik und Wissenschaft ergebenden Möglichkeiten, das Leben der Menschen zu verbessern, konnte er sich auch im späteren Leben erhalten. 1903 begann Musil an der Friedrich-Wilhelm-Universität Berlin ein Zweitstudium der Philosophie und Psychologie. Neben der experimentellen Psychologie beschäftigte er sich mit den Anfängen der Gestaltpsychologie, mit Physik und Mathematik. Gleichzeitig schrieb Musil Die Verwirrungen des Zöglings Törleß. Diese Schrift ist Robert Musils erster Roman und gilt als eines der frühen Hauptwerke der literarischen Moderne. Die Erstausgabe erschien 1906 im Wiener Verlag. Der große Erfolg dieser Frühschrift ermutigte ihn, an eine Zukunft als freier Schriftsteller zu glauben. Er wurde für sein Erstlingswerk mit vielen Lobeshymnen bedacht, was sicher seine spätere Entscheidung, sich ganz der Literatur zu widmen, beeinflusst hat. Der Törleß wurde zu Musils einzigem großem Bucherfolg zu seinen Lebzeiten. Die Taschenbuch-Ausgabe wurde später mehr als eine halbe Million Mal verkauft und in unzählige Sprachen übersetzt.
Ich erinnerte mich an ein weiteres Frühwerk Musils mit dem Sammeltitel Drei Frauen, welches ich als Jugendlicher in einem Antiquariat erworben hatte. Es umfasst drei Novellen: Grigia, Die Portugiesin und Tonka (Musil 1952). Ich glaube nicht, dass ich diese Novellen damals auch nur annähernd verstanden habe. Die Art der Darstellung empfand ich als ungewohnt und fremdartig, aber einige Erinnerungen haben sich vielleicht gerade deswegen tief eingeprägt: Beim nochmaligen Lesen musste ich überrascht feststellen, dass manche dieser „tiefen“ Erinnerungen nur im Ansatz dem Originaltext entsprachen.
Wir gehen heute davon aus, dass jedes Werk eines Schriftstellers mehr oder weniger autobiographische Hintergründe erkennen lässt. Besonders lässt sich dieses an der Novelle Tonka nachweisen. Musils Biograph Karl Corino hat dies sehr differenziert und glaubhaft herausgearbeitet.
Zum besseren Verständnis der frühen Schriften Musils beginne ich mit einer Darstellung der biographischen Hintergründe für diese Werke. Danach bespreche ich die Novelle Tonka (1922) Es folgt die Bearbeitung der wesentlich früher erschienenen Vereinigungen mit den beiden Novellen Die Vollendung der Liebe (1910) und Die Versuchung der stillen Veronika (1911). Diese Texte gelten auch unter Fachleuten als schwer lesbar. Ich habe versucht, die Inhalte in einer verständlichen Sprache wiederzugeben und sie in ihrer Bedeutung für das Gesamtwerk Musils zu würdigen. Die Besprechung der Tonkanovelle wurde von mir vorgezogen, weil Musil darin seine erste längere Beziehung zu einem Mädchen aus einfachen Verhältnissen verarbeitet. Er hatte Herma Dietz etwa um 1901 kennen gelernt. Sie begleitete seinen Lebensweg bis zu ihrem tragischen Tod im Herbst 1907. Musils Biograph Corino glaubt, dass Musil sich zeit seines Lebens Vorwürfe gemacht hat, an ihrem Tod mitschuldig zu sein und dass er die Novelle aus diesem Grunde erst so spät veröffentlichen konnte.
1936 erschien der Nachlass zu Lebzeiten. (Musil 1999) Die darin enthaltenen kurzen Geschichten einschließlich der Novelle Die Amsel sind zwischen 1920 und 1922 entstanden. In ihnen verdichten sich bereits die späteren Grundthemen Musils, die im Mann ohne Eigenschaften genauer diskutiert werden wie zum Beispiel das Thema des anderen Zustands.
Es war die Lektüre der Amsel, die dazu führte, mich näher mit dem Musilschen Grundthema des anderen Zustands zu befassen. Dabei stieß ich auf die Dissertationsschrift von Bücker Das Meer und der andere Zustand, in der Bücker ausführlich auf die Novelle Die Versuchung der stillen Veronika zu sprechen kommt. (Bücker 2016) Bücker nutzt in ihrer Argumentation und Beweisführung auch Texte aus dem Mann ohne Eigenschaften, wie zum Beispiel das Kapitel Die vergessene und überaus wichtige Geschichte mit der Gattin des Majors. Darüber hinaus verweist sie ausführlich auf Die Reise ins Paradies aus dem legendären Musilschen Nachlass. (Musil 2004) Ich übernehme die Ausführungen Bückers im Wesentlichen und setze mich mit ihnen kritisch auseinander.
Die Lektüre der Reise ins Paradies führte in meiner Auseinandersetzung mit dem Begriff des anderen Zustands dazu, mich weiter auf die Schriften Aus dem Nachlass einzulassen und so fand ich eine mehrere Kapitel umfassende Rahmenerzählung, der ich die Überschrift: Gartengespräche geben möchte. Diese Gartengespräche bilden mit dem Text Atemzüge eines Sommertags den Abschluss meiner Arbeit. In diesen Gesprächen können wir Grundthemen Musils wie seine Gefühlstheorie, die Bedeutung eines Möglichkeitssinns und den Musilschen Begriff des anderen Zustands noch einmal nachvollziehen, wie beispielhaft Agathes ekstatisches Naturerlebnis in Atemzüge eines Sommertags. In Musils Mann ohne Eigenschaften finden sich viele lange Passagen, die man allgemein als Essays über unterschiedliche aktuelle Themen seiner Zeit bezeichnen kann. In den Gartengesprächen lässt sich bewundern, wie es ihm gelingt, dieses essayistische Gedankengut in die Gespräche seiner Protagonisten Agathe und Ulrich zu integrieren.
Im letzten Teil dieser Arbeit versuche ich darzustellen, warum ich, trotz der Schwierigkeiten, die ich mit dem Verständnis des Musilschen Gesamtwerkes im Grunde während der gesamten Dauer dieses Prozesses hatte, nicht aufgegeben habe und was mich letztendlich doch davon überzeugte, dass diese Auseinandersetzung für mich und wie ich meine auch für andere wichtig sein könnte. Ich stelle dar, was mich persönlich an diesem Werk reizt und welche Möglichkeiten für meine Entwicklung ich darin gefunden zu haben glaube. Dieser Teil meiner Arbeit ist sehr persönlich, mag aber doch für manchen Leser neue Sichtweisen und Anregungen bieten und einige vielleicht dazu bewegen, sich ebenfalls auf die Lektüre Musils einzulassen.
Musils Kindheit und Berichte von Zeitzeugen zu seiner Persönlichkeit
Manchmal ist mir, als wäre alles schon in der Kindheit beschlossen gewesen. (Corino 1982, S. 98)
„Einen Menschen verstehen heißt, die Wege gehen, die er gegangen ist“. Dieser Gedanke, auf den bereits in der Einführung hingewiesen wurde, deutet an, dass es nahezu unmöglich ist, einen Menschen wirklich zu verstehen, denn wer will sich anmaßen, alle Wege, Situationen und Herausforderungen eines Menschen, die ihn geformt haben, nachzuvollziehen.
Ein wenig erleichtert wird die Aufgabe, wenn es sich um Menschen handelt, die uns viele Überlegungen zu ihrer eigenen Entwicklung in Form von Tagebüchern, Notizen oder Briefen hinterlassen haben oder über die bereits ihre Zeitgenossen in vielfältiger Weise Stellung bezogen haben. Bei besonderen Menschen, zu denen ich Musil rechnen möchte, ist aber auch dies wegen der dann vorhandenen Fülle an Material, das uns hinterlassen wurde und den vielfältigen wissenschaftlichen Arbeiten, nicht einfach.
Die beiden bedeutendsten Biographen Robert Musils, Karl Corino und Oliver Pfohlmann, weisen darauf hin, dass Musil den Erlebnissen der Kindheit für spätere Lebenseinstellungen eine große Bedeutung zuschreibt. Corino hat seiner Biographie einen Text aus Musils Schauspiel Die Schwärmer vorangestellt: „Manchmal ist mir, als wäre alles schon in der Kindheit beschlossen gewesen. Steigend kommt man immer wieder an den gleichen Punkten vorbei, dreht sich über dem vorgezeichneten Grundriss im Leeren. Wie eine Wendeltreppe.“ (Corino 1982, S. 98). Pfohlmann ergänzt:
Dieser Eindruck drängt sich angesichts der frühen Jahre des Dichters in der Tat auf. Viele der seine Texte bestimmenden Motive sind bereits in den Kindheitserinnerungen, die er später in seinen Tagebuchheften notierte, angelegt: etwa das Ideal einer Fernliebe oder erste Erfahrungen mit einem die Realität überschreitenden anderen Zustand. Der behüteten Kindheit in bürgerlichen Verhältnissen stand eine schon früh einsetzende eigensinnige Suche nach einer anderen Wirklichkeitsform gegenüber, so schreibt er in einer seiner Tagebuchnotizen: „Nie im Schoße der Familie wohl gefühlt. Eher sie gering geschätzt. Ein Anfang der von der Wirklichkeit abbiegenden Linie.“ (Pfohlmann 2012, S. 10)
Sein Elternhaus bezeichnete Musil als bürgerlich, liberal, aufgeklärt; man glaube an nichts, würde aber auch nichts als Ersatz dafür geben. Rattner weist auf eine Notiz hin, die Musil als 23-jähriger über sich als Kind niedergeschrieben hat:
Öfter stand er lange – eine halbe Stunde, dreiviertel Stunden – an einem Fenster und schaute in den Garten. Aber auch dies war mehr ein unerklärlicher Bann als ein Genuss … aber auch das sah Robert nicht. Er sah nur eine dunkle Masse, eine langsam bewegte, atmende Masse, etwas Dunkles breitete sich über sein Inneres, etwas ganz Gleichmäßiges, ohne alle Kennzeichen, erfüllte seine Seele. Und wenn er sich endlich vom Fenster losriss, war er stets müde und zum Weinen aufgelegt. … Fassen wir diese Eigenarten und Charakterprägungen Musils zusammen und berücksichtigen wir die aus seiner Kindheit erhaltenen Fotographien, entsteht das Bild eines introvertierten, narzisstisch in sich verfangenen und zwanghaft gehemmten Jungen, dem es an spontaner Lebensfreude, spielerischer Ausgelassenheit und ungezwungenem Kontakt zu Freunden und Kameraden mangelte. (Rattner 2004, S. 232)
Die gutbürgerlichen Verhältnisse, in denen Robert aufwuchs, waren keineswegs so geordnet, wie es von außen gesehen den Anschein hatte. Der Vater war zwar beruflich als Ingenieur sehr erfolgreich. Bereits in Roberts früher Kindheit wurde er zum Direktor der staatlichen Fachschule und Versuchsanstalt für Stahl- und Eisenindustrie in Steyr ernannt, um danach als Direktor an die Technische Hochschule Brünn zu wechseln. Musil selber hat einen Teil seiner Ausbildung zum Ingenieur hier absolviert. Kurz vor seinem Tod wurde Musils Vater in den erblichen Adelsstand als „Edler von Musil“ gehoben (1917). Die Situation in der Familie aber war, soweit Musil zurückdenken konnte, äußerst undurchsichtig und problematisch. Ein um zehn Jahre jüngerer Freund der Familie, Heinrich Reiter, ein sehr männlicher Typ, begleitete die Musils oft in die Ferien und war auch sonst wie selbstverständlich Gast im Hause Musil.
Hermine Musil hat ihrem Sohn in einem unbedachten Moment gestanden, dass Reiter damals zum einzigen Inhalt ihres Lebens geworden sei. (Pfohlmann 2012, S. 13) Musil beschreibt die Beziehung zu seiner Mutter als gespalten, er zeichnet sie als eine nervöse, reizbare und in ihren Stimmungen äußerst wechselhafte Frau, die den Vater aufgrund seiner beruflichen Erfolge zwar achtete, als Mann und Partner aber entsprach er nicht ihren innersten Wünschen. Als Kind war Robert dieser Grundstimmung im Hause Musil durchgehend ausgesetzt, manches irritierte ihn, ohne dass er es zum damaligen Zeitpunkt in Worte fassen konnte. Später hat er diese Irritationen in seinen Tagebuchaufzeichnungen und in seiner Novelle Tonka beschrieben. Dort heißt es: „So groß war die durch das ungenaue Sehen hervorgerufene Qual oder so ungenau durch die Qual in der Dunkelheit das Sehen.“ (Musil 1952, S. 91). Pfohlmann hat seiner Musilbiographie ein Familienfoto beigefügt, in dem der Vater hinter der Gruppe stehend wie verloren und nicht dazugehörig wirkt und der Familienfreund im Gegensatz dazu breitbeinig und selbstbewusst sein Bein an Musils Mutter drückt; selbst Robert schmiegt sich wie selbstverständlich an ihn. (vgl. Pfohlmann, S. 15) Wenn Musil in seinem Werk in immer wieder neuen Formen die hinter der wahrgenommenen Wirklichkeit existierenden Widersprüche hervorhebt, mag die Ursache auch in den undurchsichtigen, verschleierten Spannungen seiner Familie zu suchen sein. Hier kann man auch den Ursprung seines späteren Interesses am Aufdecken von Widersprüchen der bürgerlichen Moral vermuten und seine lebenslange Auseinandersetzung mit ethischen Fragen.
Wie oben dargestellt, erlebte Musil die Kindheit als problematisch. Vieles drang auf ihn ein, ohne dass er es zum damaligen Zeitpunkt einordnen konnte und es waren nicht nur die äußeren Einwirkungen. Auf der einen Seite konnte er sich über das allgemeine Maß den Phantasieexzessen der Einsamkeit passiv hingeben, auf der anderen Seite war er frühreif und in diesem Bereich hochaktiv. Er selbst beschreibt die Zeit zwischen dem Alter von vier Jahren und dem zehnten Lebensjahr als sexbewegt-romantisch. (vgl. Pfohlmann S. 17) Der Junge war ausgesprochen neugierig und wissensdurstig. So hat Musil als Knabe ein kleines Mädchen aus dem Kindergarten entführt und ein anderes Mädchen zu Doktorspielen verführt. Pfohlmann spricht von einer aggressiven Suche nach Erlebnissen, die Erregung und Erkenntnis verheißen, um das Leere, Unglückliche des Kindseins zu vertreiben.
Am 29. August 1892, also im Alter von 12 Jahren, trat Robert in die Militär-Unterrealschule Eisenstadt ein. Sein Verhältnis zu seiner Mutter hatte sich in der Zeit seiner Vorpubertät so sehr verschlechtert, dass es zu täglichen Auseinandersetzungen kam. So schien auch für Robert selber die Loslösung von seiner Familie und die Aussicht auf eine Offizierslaufbahn attraktiv. (vgl. Pfohlmann S. 19) Mit dreizehn Jahren, am 1. September 1894 wechselte er in die Militär-Oberrealschule Mährisch-Weißenkirchen. Die Erlebnisse an dieser militärischen Ausbildungsstätte, die zur damaligen Zeit einen vorbildlichen Ruf in der Bevölkerung genoss, hat Musil in seinem Erfolgsroman Die Verwirrungen des Zöglings Törleß ungeschminkt geschildert. Die Beschreibung der Zustände an diesem Ausbildungsinstitut geht auf Ereignisse zurück, die zwischen dem Herbst 1895 und dem Frühjahr 1896 stattfanden.
Beim Lesen von Musils Werken fällt auf, dass sich immer wieder Bezüge zwischen Musils gelebtem Leben und seinen Texten finden lassen. Wie andere Schriftsteller auch verarbeitet er eigene Erlebnisse, Begegnungen mit Menschen, persönlichen Krisen dichterisch, das heißt, er lässt sich durch sie anregen und nutzt, verarbeitet und verändert das selbst Erlebte in seinem Romankonzept, sodass der Leser vorsichtig in seinen Interpretationen und Vergleichen sein sollte.
Wenn Musil in seinem Roman Der Mann ohne Eigenschaften den bisherigen Lebenslauf des zu Beginn des Romans 32-jährigen Ulrich darstellt, so werden jedem Leser Übereinstimmungen mit Musils eigenem Weg auffallen. Der Protagonist Ulrich lebt offensichtlich frei von allen äußeren Zwängen. Sein Vater ist vermögend, sodass Ulrich in der Lage ist, ohne jede finanziellen Erwägungen ein Jahr Urlaub zu nehmen, sich eine Auszeit zu leisten. Drei hervorragende Möglichkeiten auf eigenen Beinen zu stehen, seinen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen, hat er ausgeschlagen. Er kann es sich sogar leisten, für diese Auszeit ein eigenes Schlösschen zu mieten. Dass Musil seinen Protagonisten während des ganzen Romans aus allen wirtschaftlichen Erwägungen heraushält, geschieht sicher bewusst. Musil selber hat in seinen jungen Jahren ähnlich wie Ulrich von der Großzügigkeit seines vermögenden Vaters profitiert und erlaubte sich, drei herausragende berufliche Karrieren ausschlagen, um sich dann für die unsichere Existenz eines Schriftstellers zu entscheiden. Im Laufe der Kriegsereignisse [I.Weltkrieg und anschließende Wirtschaftskrise] verlor die Familie allerdings ihr gesamtes Vermögen mit der tragischen Folge einer lebenslangen finanziellen Notlage Musils. Ohne die Unterstützung von Förderern hätte er als Schriftsteller nicht arbeiten können.
Musil beendete den Krieg als Reserveoffizierhauptmann mit mehreren Auszeichnungen. Menschen, die ihn in seinem Leben begleitet haben, heben hervor, dass er in seinem Auftreten bis ins Alter die Ausstrahlung eines Offiziers hatte.
Der Musilkenner und Biograph Karl Corino hat zahlreiche Berichte von Zeitzeugen herausgegeben, von denen einige hier zitiert werden. (Corino 2010) Ende 1923, Musil war inzwischen 43 Jahre alt, lernte ihn der Nachrichtenredakteur beim Ullsteinverlag, Guillemin, kennen. Guillemin schreibt später, Musil habe eine autistische Veranlagung. Vieles würde sich daraus erklären. Er habe eine Unfähigkeit Musils beobachtet, sich anderen Menschen handelnd anzuschließen und er führt dies auf Musils Wissen um die schier unbesiegbare Kompliziertheit aller Dinge und seine hohe Bewertung von Einzelheiten und Nuancen zurück. … Der Umgang mit ihm sei schwierig. Nicht nur ein starkes Selbstwertgefühl und ein großer Stolz sei an in ihm wahrnehmbar, sondern daneben auch Kleinmut und Ängstlichkeit, sowie eine übermäßige Vorsicht, die wahrscheinlich mit seinem Möglichkeitssinn zusammenhinge. (vgl. Corino 2010, S. 169) Ein Freund der späten Jahre, der Bildhauer Wotruba, schreibt über Musil:
Äußerlich war er ein gut aussehender Mann mit einer kräftigen und proportionierten Figur. Berufsoffizier und Gelehrter ergaben eine seltsame Mischung. Seine Haltung war altösterreichisch, kavaliermäßig nobel, der Schädel und Körperbau typisch slawisch, ein breiter Hals, dem ein feiner müde wirkender Kopf aufgesetzt war. Jeder Morgen begann mit gymnastischen Übungen. Alles im Tagesablauf war geordnet, beginnend bei den Bleistiften, die in Reih und Glied wohlgespitzt und griffbereit auf dem Tisch lagen. Ein Arbeitsbeginn ohne den peinlich genauen Kult der äußerst umständlichen Toilette, zu der eine aalglatte Rasur gehörte, war undenkbar. Ebenso undenkbar war irgendwelche Nachlässigkeit in der Kleidung. (Corino 2010, S. 431)
Ein weiterer Freund, Karl Otten, berichtet:
Im übrigen war Musil der Mensch ohne den leisesten Minderwertigkeitskomplex: Er war sich seines Wertes als Schriftsteller, oder, wie er sich selbst empfand, als Dichter so vollauf bewusst, dass er sein Verhältnis zur Welt, als welche er das deutsche Sprachgebiet betrachtete, in eine Forderung verwandelte. Der Inhalt dieser Forderung war das Verlangen nach Anerkennung seiner Leistung, seines Wertes durch Staat oder Stadt, private oder öffentliche Mittel, die es ihm ermöglicht hätten, seinem Werk ohne die Sorge um das tägliche Brot seine volle Arbeitskraft zu widmen. Dass ihm diese Anerkennung zu Lebzeiten versagt blieb, schmerzte wie unverschuldet erlittenes Unrecht, blieb als Stachel in seiner empfindsamen Seele. (Corino 2010, S. 12)
Die Malerin Valerie Petter-Zeis schreibt über Musil: „Nie hat eine Erstbegegnung mir einen so nachhaltigen Eindruck hinterlassen wie der mit Robert Musil, so dass sie noch jetzt nach vielen Jahren, fast bildhaft vor mir steht. Es war wohl eine vage, kaum bewusste Ahnung, einem ganz außergewöhnlichen Menschen begegnet zu sein, die den Eindruck dieser Erstbegegnung so unverwischbar gemacht hat.“ (Corino 2010, S. 94)
Die frühen Novellen
Herma Dietz: Musils erste längere Beziehung
Im Folgenden werden die Texte Tonka und die Vereinigungen mit den Novellen Die Vollendung der Liebe (Nov. 1911) und Die Versuchung der stillen Veronika (Jan. 1912) interpretiert, aber nicht in der zeitlichen Reihenfolge ihres Erscheinens, sondern in der Reihenfolge der tatsächlichen biographischen Abläufe. 1921 erschien die Novelle Grigia und 1923 die beiden Novellen Tonka und Die Portugiesin. Alle drei Texte fasste Musil 1924 unter dem Titel Drei Frauen zusammen. Tonka gilt als die Ergreifendste der drei Erzählungen, weil man davon ausgeht, dass Musil hier die Geschichte seiner ersten längeren Beziehung verarbeitet hat, seiner Beziehung zu Herma Dietz, einem einfachen Mädchen, das nicht seinem Stande und seiner geistigen Potenz entsprach. Er hatte sie 1901 in Brünn kennen gelernt. Bereits 1907 verstarb sie unter tragischen Umständen in Berlin. Insofern nimmt diese Erzählung im Werk Musils eine besondere Stellung ein. Es ist nicht auszuschließen, dass Musil wegen seiner offensichtlich berechtigten Schuldgefühle eine längere Zeit bis zu einer Veröffentlichung dieses komplizierten Geschehens verstreichen lassen musste.
In der Literaturwissenschaft wird allgemein betont, dass Musil in den Drei Frauen gegenüber dem experimentellen Charakter der wesentlich früher herausgegebenen Vereinigungen eine mehr traditionelle, konventionelle Schreibweise nutzte. Musil kehre hier zu einem ausgewogenen Verhältnis zwischen der sprachlichen und der inhaltlichen Darstellung zurück, das sich in dem realistischen Stil der drei Novellen manifestiere. (vgl. Rauch 2000, S. 82). Im Unterschied zu den Vereinigungen stellen Die drei Frauen die Formen des Weiblichen in den Kontext einer männlichen Sichtweise. Sie beziehen die im Titel genannten Frauen auf jeweils unterschiedliche Weise auf ein männliches Gegenüber, dessen Ichkrise eigentlicher Gegenstand der Darstellung ist. (vgl. Rauch 2000, S. 13)
Laut Corino hat Musil Herma Dietz am 1. Oktober 1901 in Brünn kennen gelernt. Herma arbeitete in einem Brünner Textilwarengeschäft als Verkäuferin. Er selbst befand sich in seinem einjährigen Freiwilligenjahr beim Militär. Da es über Herma kaum Unterlagen gibt, übernimmt Corino in seiner Musilbiographie (2003) die Beschreibung dieser ersten Begegnung ungekürzt aus der Novelle Tonka. 1901/1902 mietete Musil in einer Brünner Vorstadt ein so genanntes Schmeichelzimmer. Das war, wie Corino schreibt, unter den jungen Herren in Brünn so üblich, weil man ja im Winter nicht stundenlang in der Kälte spazieren konnte. In einer Notiz vom 13. Februar 1902 schreibt Musil: „Heute mit Herma voraussichtlich das letzte Mal in unserem alten Zimmer gewesen, in dessen Verschwiegenheit ihre Unschuld verloren ging. Herma ist sehr hübsch.“ Pfohlmann beschreibt Musils Militärjahr wie folgt:
Begegnungen mit behüteten Bürgertöchtern wechselten mit Abenden im Varieté oder bei einer Prostituierten namens Joszà. Musils Besuche bei Prostituierten hatten Folgen. Am 2.März 1902 notierte er: „Heute unsagbares dumpfes Elend. Es ist mir, als ob ich mit einem Schlage so grässlich krank geworden wäre. Heute erst.“ Dass er sich in seinem Einjährig Freiwilligenjahr mit Syphilis infiziert hatte, verriet der Nachwelt erst ein Kopfzettel des Reservehospitals Innsbruck vom März 2006. Danach musste sich Musil nach der Infektion eineinhalb Jahre mit giftiger Quecksilbersalbe eincremen – offenbar erfolgreich, da spätere Tests negativ ausfielen. Außerdem informiert der Kopfzettel über eine syphellitische Fehlgeburt 1906. [seiner Lebensgefährtin Herma Dietz]. (Nübel 2016, S. 12)
Nach dem Abschluss des Ingenieurstudiums, der Staatsprüfung sowie seines Freiwilligenjahres beim k.k. Infanterieregiment in Brünn, nahm Musil eine Voluntärassistentenstelle in Stuttgart an. Er nahm seine Geliebte Herma Dietz mit und sie folgte ihm auch 1903 nach Berlin, als er dort sein Studium in Philosophie und Psychologie an der Universität begann. Auch in Berlin arbeitete Herma wieder in einem Tuchgeschäft als Verkäuferin. Für den gemeinsamen Lebensunterhalt war ihr Einkommen wichtig.
Die Beziehung Musils zu Herma geriet in eine schwere Krise, als sie 1906 schwanger wurde und gleichzeitig Symptome einer Syphilisinfektion zeigte. Musil fragte sich, ob die Infektion Hermas tatsächlich auf ihn zurückging, da seine eigene Lueserkrankung bereits vier Jahre zurücklag und er eine eineinhalbjährige Behandlung hinter sich gebracht hatte. Er war unsicher, ob Herma ihn vielleicht mit einem anderen Mann betrogen haben könnte und sich bei diesem angesteckt hätte. Hinzu kam, dass Musils Eltern, als sie von der Schwangerschaft erfuhren, eine Trennung und eine Abfindung des Mädchens erwarteten, wie es damals in den besseren Kreisen üblich war. Sie drängten auf eine standesgemäße Partie mit einer gewissen Anne, über die nichts Näheres bekannt ist. Musil lehnte beides ab, befand sich aber zu diesem Zeitpunkt auch in einer finanziellen Notlage und somit in Abhängigkeit gegenüber seinen Eltern.
Die beiden lebten während ihrer Erkrankung getrennt. Herma bewohnte in einem Hinterhaus in Berlin, Elsässer Str. 90, ein Zimmer bei der Vermieterin Prawelzik. In der Zeit, in der Hermas gesundheitlicher Zustand sich verschlimmerte, beendete Musil seine Dissertationsschrift und konnte sie einreichen. Danach verreiste er zur Sommerfrische nach Steinach am Brenner, als Tourist nach Venedig, als Trauzeuge bei der Hochzeit seines Freundes Gustav Donath nach Seis am Schlern und zur Erholung nach Sistina bei Duino. Schließlich besuchte er noch seine Eltern in Brünn und kehrte in den ersten Tagen des Novembers 1907 nach Berlin zurück. Wie Corino ermittelt hat [aus Notizen Musils] war Herma gerade gestorben, als er in ihrer Mansarde auftauchte: „Er steht an Hermas Bahre in einem Moment, als die Totenstarre erst einzutreten beginnt oder nach 24 bis 48 Stunden schon wieder weicht.“ (Corino2003, S. 283)
Nie zuvor und danach habe Musil eine ähnliche Erschütterung gespürt und geäußert – und prompt hat er sich ihrer geschämt. … Als sein Freund Donath eigens aus München anreiste, nahm der Schmerz sofort etwas Geschäftsmäßiges an – etwa wie man bei einem Todesfall in der Familie Kondolenzen annimmt … Und weil Robert sonst nichts sagte, frug Gustl nach einer Weile: „Sag, geht es dir überhaupt nach?“ Da bemerkte er erst, dass Robert weinte und schwieg. (Corino, S. 284)
An anderer Stelle heißt es: „Der Autor musste sich bei der Veröffentlichung seiner Tonka etwa 15 Jahre nach dem Tod Hermas darüber im Klaren sein, es könnten noch Augenzeugen und Kenner der Verhältnisse leben.“ (Corino, S. 190) Die folgende, später in der Novelle unterdrückte Abschiedsszene, die Musil in einem seiner Entwürfe der Novelle notiert, gehört nach der Meinung von Corino zu den eindrucksvollsten aus Musils Feder überhaupt. Umso bedauerlicher sei es, dass sie der Selbstzensur zum Opfer fiel und nicht in den Text (Tonka) aufgenommen wurde. In den Entwürfen benutzt Musil für seine Protagonisten noch die echten Namen Herma und Robert: