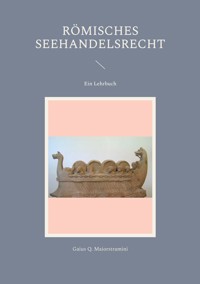
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Es handelt sich um eine lehrbuchartige Darstellung des römischen Seehandelsrechts, die schwerpunktmäßig die lex Rhodia de iactu, die actio exercitoria, das foenus nauticum und die receptum-Haftung umfasst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 213
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
IN HOC SIGNO VINCES
Inhaltsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
§ 1 Bedeutung des Seehandels im
Imperium Romanum
§ 2 Die lex Rhodia de iactu
1.) Zusammenfassung
2.) Bedeutung und Ursprünge
3.) Grundsatz, Parteien
4.) Ersatzfähiger Schaden
5.) Schadensberechnung, Mankohaftung
§ 3 Die actio exercitoria
1.) Zusammenfassung
2.) Ausgangslage und Problemstellung
a) Mittelbare Stellvertretung
b) Die actio de peculio
c) Die actio exercitoria
d) Anwendungsfälle
e) Gegenwärtige Rechtslage
3.) Voraussetzungen
4.) Persönliche Reichweite
a) Vertrag mit Matrosen
b) Quirite als
magister navis
c) Mehrere magistri navis
d) Fragen der Gesamtschuldnerschaft
e) Bestellung eines Unter-
magister
f) Der gewaltunterworfene
exercitor
5.) Sachliche Reichweite
a) Vorab: Die
praepositio
b) Geschäfte im Rahmen der
praepositio
c) Darlehensaufnahme
6.) Gegenklage des exercitor
§ 4 Foenus nauticum (Seedarlehen)
1.) Zusammenfassung
2.) Grundzüge, Form, Gefahrtragung, Zinsen
3.) Zufall und Verschulden
4.)
Actio exercitoria
und
traiecticia pecunia
5.) Weitere Entwicklung (Bodmerei)
§ 5 Haftung für eingebrachte Sachen (
receptum
-Haftung)
1.) Zusammenfassung
2.) Grundzüge, Geschichte und
ratio legis
3.) Handelnde, Verpflichtete
4.) Objekte
5.) Berechtigte, fremdes Eigentum, Zufall
6.) Einbringung
7.) Verlust durch Zerstörung
8.) Haftung für Freie
9.) Haftungsausschluss
10.) Regress
§ 6 Vertragsrecht
Anhang (Rechtsquellen)
Dig. 14. BUCH.
Erster Titel.
Zweiter Titel.
Dig. 22. Buch.
Zweiter Titel.
Codex 4. Buch,
33. Titel.
Dig. 4. Buch
Neunter Titel.
Dig. 47. Buch
Fünfter Titel
Abkürzungsverzeichnis
a.u.c.
ab urbe condita
(Beginn der römischen Zeitrechnung, ab 21. April 753 v.Chr.G.)
Baumb/Hopt
35
Baumbach/Hopt, Kommentar zum HGB, 35. A., 2012
C.
Codex
CICiv.
Corpus Iuris Civilis
D.
Digesten
Gai.
Institutionen des Gaius
Honsell
Römisches Recht, 8. A. 2015
i.A.
im Allgemeinen
iFd/v
in Form des/der/von oder im Fall des/der/von
Inst.
Institutionen Justinians
KKL
Kaser/Knütel/Lohsse, 21. A., 2017
Palandt
Komm. z. BGB, soweit nicht anders angegeben 78. A., 2019
P
I
K
O
Pichler/Kossarz, Casebook Römisches Recht, Wien 2014
§ 1 Bedeutung des Seehandels im Imperium Romanum
[1] Wie auch heute1 hatte der Seehandel eine immense Bedeutung für die Wirtschaft der römischen Antike. Es gab Verbindungen nach Gallien, Afrika und Sardinien, um wesentliche, aber auch Luxusgüter zu importieren. So bspw. Holz für den (Kriegs-)Schiffbau oder Lebensmittel für den gehobenen Bedarf wie Wein, Datteln und, aus Baetica2, dem heutigen Andalusien, Oliven, die nicht nur kulinarische Verwendung fanden, sondern deren Öl auch zur Beleuchtung diente3. Ferner, Gipfel des Luxus in der Möbelproduktion, Zitronenholz aus dem Atlasgebirge, aber auch Purpur aus Tyrus, das unerlässliche Essentiale antiker Haute Couture, Perlen aus Palmyra, Petra oder Alexandria sowie Seide aus China4, aber auch von der Insel Kos5, wobei aus letzterer die coae vestes6, die durchsichtigen(!) koischen Seidengewänder der Hetären, gefertigt wurden. Der Hafen von Alexandria soll jährlich bis zu 300 Mio. HS allein an Zöllen erbracht haben7. Zum Vergleich: Ein Hauslehrer verdiente 1.000 HS p.a.8
[2] V.a. aber war der Seehandel unerlässlich zum Import des lebensnotwendigen Getreides, da Rom sich aus seinem Umland nicht ausreichend mit Lebensmitteln versorgen konnte9 und deshalb die Getreideversorgung zunächst aus Sizilien, später auch Ägypten sicherstellen musste (annona)10. Dies ging so weit, dass diese Gebiete gezwungen wurden, 10% ihres Jahresertrags nach Rom zu verkaufen11, um die Ernährung von dessen Bevölkerung zu gewährleisten. Die navicularii, die die Schiffe zum Getreideimport betrieben, genossen umfangreiche Privilegien: Sozialer Aufstieg war ihnen unter Claudius sicher, und Nero gewährte ihnen Steuerermäßigungen12. Hierzu HÖCKMANN: „Das Funktionieren dieser Importe ist für Rom ein Politikum ersten Ranges gewesen, um Unruhen in der Hauptstadt zu vermeiden13.“
STECKLINA meint, es seien zur Versorgung Roms jährlich 800 Schiffe nötig gewesen, weil aber ein beträchtlicher Teil sank, kommt er auf 1.00014. Dabei geht er von 320.000 Haushalten à 45 kg/Mo. aus und kommt auf einen Gesamtbedarf von 270.000 t. Ich komme bei Zugrundelegung dieser Zahlen aber nur auf ca. 173.000 t. Bedenkt man, dass nur wenige Schiffe die Maximallast von 1.000 t laden konnten, und geht deshalb von einer durchschnittlichen Größe von 300 t15 aus, so kommt man auf ca. 600 Schiffe und bei Einrechnung eines Schwunds von ca. 20%16 auf 750 Schiffe. HOFMANN kommt allerdings, wenn auch aufgrund anderer Berechnungsgrundlagen, ebenfalls auf 800 bzw. 1.000 Schiffe17.
[3] Selten hingegen war anfänglich der Passagiertransport18, der jedoch mit zunehmendem Reichtum der römischen Bevölkerung an Bedeutung gewann. Reiche Kaufleute unternahmen sogar Lustreisen zu Sehenswürdigkeiten, Offiziere wurden versetzt, Truppen an überseeische Kriegsschauplätze verlegt, und hohe Beamte unternahmen Inspektionsreisen in überseeische Provinzen19. Der Sklaventransport fällt nicht hierunter, da Sklaven als Sachen angesehen wurden20.
Angesichts dieser herausragenden Bedeutung des Seehandels, aber auch der damit verbundenen Risiken ist es naheliegend, dass die damit zusammenhängenden Probleme einer differenzierten rechtlichen Regelung unterzogen wurden, wie wir das von den Römern der Antike kennen. Immerhin heißt es in D. 14, 1, 1, 20 in Bezug auf die actio exercitoria, dass „die Reederei mit den wichtigsten Angelegenheiten des Staates in Beziehung steht.“ Dennoch, die Quellen über das römische Seehandelsrecht sind spärlich. Im Wesentlichen sind folgende Materien geregelt:
die
lex Rhodia de iactu
, das Rhodische Gesetz über den Seewurf, in D. 14, 2;
die
actio exercitoria
, die Klage gegen den Reeder, in D. 14, 1, ferner
das
foenus nauticum
, das Seedarlehen, in D. 22, 2 sowie
die
receptum-
Haftung der Reeder in D. 4, 9.
Daneben gibt es noch einige verstreute Vorschriften zum Vertragsrecht zwischen Befrachter und Verfrachter, die ebenfalls Berücksichtigung finden.
Diese Materien sollen in dem folgenden kurzen Abriss dargestellt werden.
Zum Schluss noch folgender Hinweis bzgl. der Quellen: Was das Corpus Iuris Civilis angeht, habe ich mich der aus den 1830er Jahren stammenden Übersetzung bedient, die über http://digital.ub.uniduesseldorf.de/urn/urn:nbn:de:hbz: 061:1-28361 (abgerufen Januar 2024) zugänglich ist, sie aber nicht wörtlich zitiert und ggf. sprachlich geglättet, um den Lesefluss nicht zu hemmen. Die Institutionen des Gaius folgen der Übersetzung von HUCHTHAUSEN in DIESELBE/HÄRTEL, Römisches Recht, Berlin, Weimar 1975.
1Https://geohilfe.de/welthandel-seeweg-visualisiert/#google_vignette „Der Welthandel auf dem Seeweg hat immense Bedeutung am globalen Güterverkehr: 90% des Welthandels werden über den Schiffverkehr abgewickelt. Es sind über 50.000 Handelsschiffe unterwegs, auf denen mehr als eine Million Matrosen aus Ländern aller Welt arbeiten“ (abgerufen 22.12.2023, Hervorh. i.O.).
2 Der Begriff findet sich noch heute im Namen des Fußballclubs Betis Sevilla (https://de.wikipedia.org/wiki/Betis_Sevilla, 03.01.24).
3 Ja, die Römer erleuchteten ihre Umgebung mit Kaltgepresstem. Näheres bei KLOFT, Die Wirtschaft des Imperium Romanum, Mainz 2006, S. 24 f.
4Https://lehrerfortbildung-bw.de/u_gewi/geschichte/gym/bp2016/fb6/8_fenster/9_u_lsg/seide/ (abgerufen 22.12.2023).
5Https://de.wikipedia.org/wiki/Kos (abgerufen 22.12.2023).
6 KLOFT aaO (FN 3) S. 50; https://de.wikipedia.org/wiki/Koische_Seide (22.12.2023).
7 KLOFT, aaO (FN 3), S. 78. Die Zollsätze werden dort allerdings nicht genannt.
8 KLOFT, aaO (FN 3), S. 110.
9 KLOFT, aaO (FN 3), S. 50; STECKLINA, http://www.stecklina-net.de/~oliver/download/schifffahrt.pdf, S. 8 (22.12.2023).
10 HOFMANN, https://www.die-apostelgeschichte.de/einzelthemen/PaulusRomreise.pdf, S. 31; STECKLINA aaO (FN 9), S. 8 f.; https://de.wikipedia.org/wiki/Praefectus_annonae; https://de.wikipedia.org/wiki/Cura_annonae (alle abgerufen 22.12.2023).
11 HÖCKMANN, antike Seefahrt, München 1985, S. 75 f.
12 HUISSEN, https://www.romanports.org/en/articles/human-interest/657-the-roman-shipowners.html, „Dominus navis“ (25.01.2024).
13 AaO (FN 11), S. 76.
14 AaO (FN 9), S. 8.
15 Dies dürfte schon recht hoch gegriffen sein. Denn während einer Hungersnot(!) gewährte Kaiser Claudius besondere Steuervorteile für den Bau von Frachtern über 10.000 modii Tragfähigkeit (5 modii Korn sind etwa 45 kg, 10.000 modii entsprechen also etwa 90 Tonnen Korn) und für die Durchführung von Annona-Reisen auch im Winter anbot (HOFMANN, aaO [FN 10], S. 31). HOFMANN hält bereits 450 Tonnen Korn pro Schiff für sehr viel und fügt an: „Rechnet man mit 10.000 modii Korn pro Schiff, so ergibt sich eine Zahl von 4000 Schiffsladungen, also machten sich mit den Verlusten eingerechnet jährlich 4800 Annona-Frachter auf die Reise. Welche der Zahlen nun der Wahrheit am nächsten kommen, wage ich jedoch nicht allein aufgrund dieser einen Quelle (gemeint ist HÖCKMANN [FN 11], Anm. d. Verf.) mit Zahlenangeben zu entscheiden.“ 16 HOFMANN, aaO (FN 10), S. 32.
17 AaO (FN 10), S. 32.
18 Hierzu HOFMANN, aaO (FN 10), S. 26. DEMAROLLE, Reisen im Imperium Romanum, 2010, S. 19, re., meint allerdings, Geschäftsreisen seien zahlreich gewesen, bezieht sich hierfür allerdings lediglich auf die Ladungen von Schiffswracks, also auf geschäftlich veranlasste Transporte. Allerdings wurden die Warentransporte häufig von einem Sklaven des Befrachters begleitet.
19 STECKLINA, aaO (FN 9), S. 12.
20 Zur Bedeutung des Seehandels s.a. RINCKENS, BRZ 2023, 121/2.
§ 2 Die lex Rhodia de iactu
1.) Zusammenfassung
[4] Sedes materiae ist D. 14, 2.
Der Grundsatz findet sich in D. 14, 2, 1, wonach wenn zur Erleichterung eines Schiffs, um dies aus der Seenot zu retten, Waren ausgeworfen worden sind, der Verlust durch Beiträge aller ersetzt werden muss.
[5] Anspruchsinhalt und Anspruchsgegner: Dabei haben die Eigentümer der aufgeopferten Waren gegen den magister navis einen Ersatzanspruch aus dem Transportvertrag, dessen Inhalt strittig ist. Teils soll er auf ein Zurückbehaltungsrecht gegen die Ersatzverpflichteten gehen, deren Waren geschont worden waren, so Servius, teils auf Zahlung, so Paulus, der jedoch das Zurückbehaltungsrecht für den Fall, dass Waren gerettet wurden, anerkennt und auch für zweckmäßig hält.
[6] Anspruchsberechtigt sind v.a. die, deren Waren geopfert wurden. Aber auch wenn jemandes Waren infolge des Seewurfs bloßgelegt und infolgedessen beschädigt wurden, hat er Anspruch auf Entschädigung. Denn der Jurist Papirius Fronto sieht keinen Unterschied darin, ob man die Waren (oder auch Perlen und Edelsteine oder kostbare Gewänder) durch den Wurf verloren, oder ob sie, weil sie dadurch bloßgelegt worden sind, an Wert eingebüßt haben. Wurden aber die Waren nicht infolge des Seewurfs, wenn auch evtl. zeitgleich mit diesem, sondern dadurch beschädigt, dass durch ein Leck Wasser eingedrungen ist, so besteht kein Anspruch, aber eine Beitragspflicht. IF eines non liquet bzgl. der Ursache des Schadens an den im Schiff verbliebenen Waren besteht kein Ausgleichsanspruch, aber die Beitragspflicht richtet sich nach dem nach der Beschädigung verbliebenen Restwert, nicht nach dem sonst anwendbaren Wert im Bestimmungshafen.
Sonderfall Piraterie: Wer Geld opfert, um das Schiff aus der Gewalt von Piraten freizukaufen, hat dieselben Ansprüche wie der, dessen Waren beim Seewurf geopfert wurden, nicht aber der, der einen individuellen Schaden ausgleicht (Freikaufen geraubter Sklavinnen bspw.).
[7] Wirtschaftlich Verpflichtete: Auch solche Personen sind zur anteiligen Tragung der Aufwendungen des Seewurfs verpflichtet, die keine Waren geladen haben, an denen ein Zurückbehaltungsrecht ausgeübt werden könnte, wie z.B. der Schiffscharterer und Passagiere, die keine Waren begleiten, sondern als reine Fahrgäste an Bord sind.
[8] Regress: Jedenfalls aber hat der magister navis seinerseits gegen die übrigen Eigentümer, deren Waren durch den Seewurf gerettet worden sind, aus dem Transportvertrag einen Regressanspruch, was mE voraussetzt, dass er entweder denjenigen, der seine Waren aufgeopfert hat, befriedigt hat oder ihm den Regressanspruch abtritt.
[9] Handeln zur Rettung des Schiffes und der Ladung ist Dreh- und Angelpunkt des Entschädigungsanspruchs. Sie müssen geglückt sein: Das Seewurfrecht der lex Rhodia de iactu setzt Erhaltung des Schiffes voraus. Weshalb, wenn das Schiff zu Vermeidung gemeinsamer Gefahr beschädigt wird, der Schaden von Befrachtern und Passagieren gemeinsam getragen werden muss. Nicht aber, wenn das Schiff in einem Sturm beschädigt wird, ohne dass der Kapitän ein Manöver zur Rettung der Waren gefahren hat, u.zw. auch dann nicht, wenn sämtliche Waren wohlbehalten im Zielhafen ankommen.
[10] Berechnung des Beitrags: Bei der Verteilung des Schadens sind die geretteten und die geworfenen Waren wertmäßig zu addieren. Die geretteten sind mit ihrem Verkaufswert im Bestimmungshafen anzusetzen, die geworfenen mit dem Wert im Ausgangshafen. Die Eigentümer der geretteten Waren müssen im Verhältnis ihrer Werte die Schäden der Eigentümer der aufgeopferten im Verhältnis deren Werte ersetzen.
Zur Entschädigung beizutragen haben aber nicht nur die, die schwergewichtige Waren an Bord gebracht hatten, die gerettet wurden, sondern auch diejenigen, die Waren in das Schiff gebracht hatten, wodurch es nicht belastet wurde, wie Edelsteine und Perlen, sowie der Eigentümer des Schiffs; einzige Ausnahme: Lebensmittel.
[11] Mankohaftung: Auch wenn sich der Anspruch gegen den magister navis richtet, so trifft diesen doch keine Mankohaftung. Das Manko ist vielmehr unter den übrigen genauso zu verteilen wie der Entschädigungsanspruch, also im Verhältnis des Wertes ihrer Waren im Bestimmungshafen.
[12] Wieder aufgefundener Seewurf verringert den Anspruch, ggf. bis auf Null, bzw. verpflichtet zur Rückzahlung geleisteter Entschädigungen.
Ein sog. Strandrecht ist nicht anerkannt: Vielmehr bleibt eine ausgeworfene Sache im Eigentum ihres Herrn und gehört nicht dem Finder, da sie nicht für verlassen erachtet wird.
[13] Umladung: Es macht keinen Unterschied, ob Waren zur Erleichterung des Schiffs geworfen oder auf ein anderes Schiff umgeladen werden, das sinkt. Die Ansprüche aus dem Seewurf bestehen in gleicher Weise. Hingegen wenn das Boot mit einem Teile der Waren geborgen, das Schiff aber untergegangen ist, so können die, die im Schiff etwas verloren haben, nichts berechnen, weil der Seewurf nur dann verteilt wird, wenn das Schiff gerettet wird.
2.) Bedeutung und Ursprünge
[14] Dass das Meer kein sicherer Ort ist, war schon dem Apostel Paulus klar, schreibt er doch: „dreimal habe ich Schiffbruch erlitten, einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer“21. Natürlich waren die Reisen oft lang22 und gefahrvoll23. Es lag nahe, dass man hier bestimmte Regelungen schuf, wie man sich in Gefahr zu verhalten hatte und welche Folgen dies nach sich zog.
[15] Zu diesen gehört das rhodische Seerecht. Es war so bedeutend, dass selbst der Kaiser sich nicht darüber stellte. So hatte ein Eudämon aus Nikomedien24 eine Bittschrift an den Kaiser Antoninus25 gerichtet, in der er ihm sein Maleur berichtete und um eine kaiserliche Entscheidung zu seinen Gunsten bat: „Herr Kaiser Antoninus, wir sind, nachdem wir bei Italien [oder Ikaria] Schiffbruch gelitten, von den Zollpächtern, die auf den Kykladischen Inseln wohnen, geplündert worden.“ Man würde jetzt eine Entscheidung des Kaisers, sei es zusprechend oder abschlägig, erwarten. Doch der antwortete nur: „Ich bin wohl Herr der Erde, Herr über das Meer aber ist das Gesetz. Nach diesem rhodischen Gesetz über nautische Angelegenheiten soll die Sache entschieden werden, soweit nicht eine unserer Bestimmungen entgegensteht“26. Wie dieser Fall nach rhodischem Seerecht zu entscheiden war, wissen wir nicht. Was uns hier beschäftigt, ist das rhodische Gesetz über den Seewurf, die lex Rhodia de iactu, die ein Ausschnitt aus dem rhodischen Seerecht war27. Ihr Ursprung liegt, daher der Name, auf Rhodos28. Ende des 3. vorchristlichen Jahrhunderts hatte Rhodos eine dominante Stellung im Seehandel im östlichen Mittelmeer und der Ägäis. Es wird vermutet, beim rhodischen Seerecht habe es sich um kodifiziertes Gewohnheitsrecht gehandelt, eine im Handelsverkehr des Mittelmeeres anerkannte Usance, die zum regelmäßigen Inhalt der Seefrachtverträge wurde und die Anerkennung der römischen Juristen und Justinians gefunden habe29.
3.) Grundsatz, Parteien
[16] Der Inhalt der lex Rhodia de iactu lässt sich kurz zusammenfassen: Durch das Rhodische Gesetz ist bestimmt: Wenn zu Erleichterung eines Schiffs Waren ausgeworfen worden sind, muss der Verlust durch Beiträge aller ersetzt werden, weil er für alle hingegeben worden ist30.
[17] Die Regel scheint simpel und einleuchtend. Doch so einfach sind die Dinge nicht. Es ergibt sich daraus vielmehr eine Fülle von Problemen, denen im Folgenden nachgegangen werden soll. Zunächst verhält es sich so, dass die Eigentümer der aufgeopferten Waren gegen den magister navis31 einen Ersatzanspruch aus dem Transportvertrag haben32, dessen Inhalt strittig ist. So meint Servius, er sei darauf gerichtet, dass er die Waren der übrigen Reisenden zurückhält, bis sie ihren Anteil zur Entschädigung leisten33. Paulus, der Verfasser des Fragments, hält dies jedoch nicht für notwendig34, weil es nur begrenzt zielführend ist. Denn es gibt auch Passagiere, die keine Waren transportieren, bei denen die Zurückbehaltung also ins Leere läuft35, er anerkennt sie aber als zweckdienlich36. Dennoch soll auch gegen sie ein Regressanspruch bestehen37. Dies gilt namentlich für Schiffscharterer38 und solche Passagiere, die nicht, wie in der Antike üblich, ihre oder ihres Herrn Waren begleiten, sondern lediglich als Fahrgäste an Bord sind39.
[18] Jedenfalls aber hat der magister navis seinerseits gegen die übrigen Eigentümer, deren Waren durch den Seewurf gerettet worden sind, aus dem Transportvertrag einen Regressanspruch40, was mE voraussetzt, dass er entweder denjenigen, der seine Waren aufgeopfert hat, befriedigt hat oder ihm den Regressanspruch abtritt. Die ratio dieser Regelung findet sich in D. 14, 2, 2 pr. i.f., wonach es höchst angemessen (aequissimum) ist, dass der Schaden von denen gemeinsam getragen werde, die durch Aufopferung des Eigentums anderer die Rettung ihrer eigenen Waren erreicht haben.
[19]Problem: Ein Schiff, in welchem viele Kaufleute verschiedene Arten von Waren verladen hatten und zugleich viele Passagiere, Sklaven sowohl als Freie, fuhren, hatte bei einem schweren Sturme notgedrungen Waren über Bord geworfen41.
Problemstellung: Darauf wurde gefragt, ob sich alle an dem Seewurf beteiligen müssten, auch diejenigen, die Waren in das Schiff gebracht, wodurch es nicht belastet wurde, wie Edelsteine und Perlen42 und welcher Anteil zu tragen sei und ob auch für die freien Menschen etwas gegeben werden müsse43. Die
[20]Lösung folgt aus D. 14, 2, 2, 2 ab Satz 3: Man fand für gut, dass alle, zu deren Vorteil der Seewurf gereicht, beitragen müssten, weil sie zu solchem Beitrag wegen Rettung ihrer Sachen verpflichtet seien. Daher sei auch der Eigentümer des Schiffes anteilig dazu verpflichtet. Der Betrag des Verlustes muss nach dem Werte der Sachen verteilt werden. Freie Menschen können nicht geschätzt werden. Die Eigentümer der über Bord geworfenen Sachen werden gegen den magister navis die Klage aus dem Transportvertrag haben44. So ist auch in Anregung gebracht worden, ob auch die Kleider und die Fingerringe eines jeden mit zu berechnen seien? Und man hat erachtet, es sei alles zu berechnen, es wäre denn dies und jenes geladen worden, um verzehrt zu werden, wohin Lebensmittel gehören, um so mehr, weil, wenn diese auf der Fahrt einmal mangelten, jeder soviel, wie er hätte, zum gemeinsamen Gebrauch hergeben würde.
[21]§ 591 Abs. 1 HGB weicht hier vom römischen Recht ab und nimmt die Fahrgäste und die Schiffsbesatzung von der Erstattung der Kosten des Seewurfs aus.
[22]Problem: In Minturnae45 ist der Liris46 über die Ufer getreten und drückt mit Macht die Schiffe, die vom Mittelmeer her kommen, aufs Meer zurück. Dadurch gerät die „Minerva“ in Bedrängnis. Doch statt des Seewurfs entscheidet der magister navis Naufragius, die Waren auf eine navis oneraria47umzuladen. Diese sinkt. Können die Eigentümer der umgeladenen Waren nach D. 14, 2, 1 Umlegung ihres Schadens fordern?
Problemstellung: Bei wörtlicher Auslegung des Fragments nicht. Denn es ist ja kein Seewurf, sondern eine geordnete Umladung geschehen. Allerdings geschah diese zur Vermeidung eines Seewurfs, maW: Wäre es zu einem Seewurf gekommen, wäre dies vom wirtschaftlichen Ergebnis her gleich. Wirkt sich dies auf die Erstattungsansprüche des Eigentümers der verlorenen Waren aus? Die
[23]Lösung ergibt sich aus D. 14, 2, 4 pr.: Wenn Waren zu Erleichterung eines beladenen Schiffes, weil es mit der Ladung nicht in einen Fluss oder Hafen einlaufen konnte, in ein Boot gebracht werden, damit das Schiff nicht, entweder außerhalb des Flusses48 oder in der Mündung oder dem Hafen, selbst in Gefahr komme, und nun dieses Boot untergeht, so müssen die, deren Waren auf dem Schiffe geborgen sind, den Verlust derer, welche die ihrigen im Boote verloren haben, ebenso anteilig übernehmen, wie wenn dieselben über Bord geworfen worden wären.
Im Originaltext handelte es sich nicht um eine navis oneraria, sondern eine scapha49(si quaedam merces in scapham traiectae sunt), die kleiner gewesen sein dürfte.
[24]Abw. 1: Die navis oneraria erreicht wohlbehalten den Hafen von Minturnae, aber die „Minerva“ geht unter.
Problemstellung: Eigentlich müsste doch nach dem Prinzip manus manum lavat nun denjenigen, deren Waren auf der „Minerva“ untergegangen sind, das gleiche Recht auf Übernahme ihrer Verluste zustehen wie im Ausgangsfall den anderen. Andererseits ist es das Ziel der lex Rhodia de iactu, das Schiff mit dem Großteil der Fracht zu retten. Hier ist es genau umgekehrt.
Lösung: So sieht es auch D. 14, 2, 4 pr. i.f.: Hingegen wenn das Boot mit einem Teile der Waren geborgen, das Schiff aber untergegangen ist, so können die, die im Schiff etwas verloren haben, nichts berechnen, weil der Seewurf [nur] dann verteilt wird, wenn das Schiff gerettet ist50.
[25]Abw. 2: Im Ausgangsfall wurden die Waren auch deshalb auf eine navis oneraria und kein anderes Schiff umgeladen, weil es eine Stunde später sowieso auf eine navis oneraria hätte umgeladen werden müssen, um den Liris hinaufzufahren, wo Gaius Aeppeltschus, der Eigentümer der ausgelagerten Waren, einen Kunden in Fregellae51 besuchen wollte, dem er die Ladung, schwarze Oliven aus Lilybaion52, verkaufen wollte. Zwei Stunden später sinkt die navis oneraria.
Problemstellung: Wäre das Boot innerhalb der ersten Stunde gesunken, wäre die Sache klar und gem. D. 14, 2, 4 pr. zu entscheiden: Die Eigentümer der auf der „Minerva“ verbliebenen Waren wären anteilig ersatzpflichtig gewesen, weil die Umladung erfolgte, „damit das Schiff nicht, entweder außerhalb des Flusses oder in der Mündung oder dem Hafen selbst, in Gefahr komme“. Die weitere Entscheidung, die Waren des Aeppeltschus auch nach einer Stunde noch auf dem Boot zu lassen, erfolgte jedoch nicht deshalb, sondern weil sie zu diesem Zeitpunkt ohnehin darauf hätten umgeladen werden müssen, dieses fiktive Umladen durch die Seenot lediglich vorgezogen worden war. Ändert das etwas?
[26]Lösung: Ich meine ja. Es greift hier die Rechtsfigur des rechtmäßigen Alternativverhaltens mit der Maßgabe, dass es sich um gedachtes ebenso rechtmäßiges Alternativverhalten handelt.
Hierzu die „unsterbliche lex“53 D. 14, 2, 10, 1: Wenn du ein Schiff unter der Bedingung gemietet hast, dass deine Waren damit verschifft werden sollten, der Schiffer aber diese Waren, ohne dazu genötigt zu sein, und da er wusste, du wollest dies nicht, auf ein schlechteres Schiff umgeladen hat, und deine Waren mit diesem Schiffe untergegangen sind, mit welchem sie zuletzt gingen, so hast du gegen den ersten Schiffer die Klage aus dem Transportvertrag. Paulus: Das Gegenteil aber gilt, wenn beide Schiffe auf dieser Fahrt untergegangen sind, sofern dies ohne bösen Willen und Fahrlässigkeit des Schiffsvolks geschehen ist. Folgt man hier der Auffassung des Paulus, so heißt dies, dass ein gedachtes rechtmäßiges Alternativverhalten insoweit Beachtung findet, als es zum selben Schaden geführt hätte, so dass derjenige, der dessen Ersatz fordert, sich zur Begründung nicht auf die Verletzung der verabredeten Pflicht berufen kann. Dies muss mE aber erst recht dann gelten, wenn das tatsächliche Geschehen, wie hier der Seewurf in Form der Umladung gar nicht rechtswidrig, sondern von D. 14, 2, 1; eod. 4 pr. gedeckt ist. Der Umstand allein, dass die Umladung auch aus Zweckmäßigkeitsgründen erfolgte, darf mE keine Rolle spielen. Denn im Vordergrund stand die Rettung des Schiffs. Diese ist gelungen.
Ergebnis: ME können die Eigentümer der auf die navis oneraria umgeladenen und dort untergegangenen Waren deshalb nicht nach D. 14, 2, 1 Umlegung ihres Schadens fordern.
4.) Ersatzfähiger Schaden
[27]Problem: Lucius Naufragius ist magister navis der „STELLA MARIS“. In der Straße von Messana54, zwischen Scylla und Charybdis55, gerät das Schiff in schwere See, dabei muss der Mast gekappt werden, auch das Takelwerk gerät in Mitleidenschaft. Der Schaden beträgt 12.000 aurei56. Die Ladung kann gerettet werden. Kann Naufragius von den Befrachtern anteilige Reparaturkosten verlangen?
Problemstellung: Wäre Naufragius Befrachter57 und hätte bei dem Unglück einen Teil der von ihm eingebrachten Ladung verloren, wäre die Sache einfach: Nach D. 14, 2, 1 müssten alle anteilig ihren Teil zum Schaden des Naufragius beitragen. Hier ist aber nicht geladene Ware beschädigt worden, sondern das Schiff, das Transportmittel selbst. Ist es denn hier nicht ebenso, wie wenn ein Schmied seinen Amboss oder Hammer zerschlägt? Dann kann dies doch auch nicht dem angerechnet werden, der das Werk in Auftrag gegeben hat.
[28]Lösung: Dies ist strittig. Zunächst D. 14, 2, 2, 1, wo Julius Paulus mit der o.a. Begründung schreibt: Wenn die Güterladung erhalten, das Schiff aber beschädigt worden ist oder vom Takelwerk etwas verloren hat, so ist kein Beitrag zu geben, weil es sich mit den Sachen, die des Schiffes wegen angeschafft werden, ganz anders verhält, als mit denen, wofür Fracht bezahlt worden ist. Naufragius geht danach also leer aus. - AA Aemilianus Papinianus in D. 14, 2, 3: Wenn der Mast oder sonst etwas vom Takelwerk zu Vermeidung gemeinsamer Gefahr gekappt wird, so muss der Schaden von Befrachtern und Passagieren gemeinsam getragen werden. Ebenso Hermogenian in D. 14, 2, 5, 1.
Ergebnis: Nach Auffassung von Papinianus und Hermogenianus kann Naufragius diese Personen zum Ausgleich der am Schiff eingetretenen Schäden heranziehen, aA Paulus, der einen Anspruch verneint.
[29] Die exakte Denkweise des Papinian überzeugt. Denn er erkennt, dass der Werkunternehmer, in casu der Reeder bzw. sein magister navis, zur Ausführung eines Auftrags taugliches Gerät, hier ein seetüchtiges Schiff, zur Verfügung einsetzen muss und deshalb Schäden an diesem bei Erfüllung des Werkvertrags, mögen sie auf sachgemäßer oder unsachgemäßer Handhabung beruhen, zu seinen Lasten gehen. Dies ist die Parallele zu dem Schmied aus D. 14, 2, 1. Wer einen Auftrag übernimmt, muss dafür sorgen, dass er nicht nur die erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten dafür hat58, sondern auch die erforderlichen Gerätschaften in gebrauchstauglichem Zustand. Fehlt es daran, so geht dies zu Lasten des Unternehmers, indem er Schäden seiner Kunden ersetzen muss und eigene ihnen nicht in Rechnung stellen kann. Doch Papinian wurde nicht umsonst die entscheidende Stimme im Zitiergesetz des Kaisers Valentinian III. eingeräumt59





























