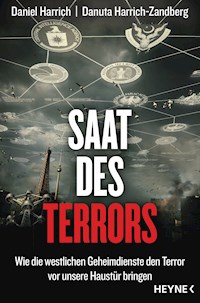
11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
In einer noch nicht da gewesenen Spurensuche deckt das mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Autorenteam die Hintergründe der Entwicklung des internationalen Terrorismus auf. Wie sind die westlichen Geheimdienste in die Strukturen der Terrornetzwerke verstrickt? Warum werden Strategien aus dem Kalten Krieg stur weiterverfolgt – mit dramatischen Konsequenzen? Wie profitieren terroristische Vereinigungen von Fehlern in der Zusammenarbeit der Geheimdienste? Wie kann der Terror wieder und wieder unter den Augen der Sicherheitsbehörden in europäischen Städten zuschlagen?
Ein scharfsichtiger Report aus einer Welt jenseits der Nachrichten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
In einer noch nicht da gewesenen Spurensuche deckt das mit dem Grimme-Preis ausgezeichnete Autorenteam die Hintergründe der Entwicklung des internationalen Terrorismus auf. Wie sind die westlichen Geheimdienste in die Strukturen der Terrornetzwerke verstrickt? Warum werden Strategien aus dem Kalten Krieg stur weiterverfolgt – mit dramatischen Konsequenzen? Wie profitieren terroristische Vereinigungen von Fehlern in der Zusammenarbeit der Geheimdienste? Wie kann der Terror wieder und wieder unter den Augen der Sicherheitsbehörden in europäischen Städten zuschlagen?
Ein scharfsichtiger Report aus einer Welt jenseits der Nachrichten.
Daniel Harrich studierte Betriebswirtschaft in London und Atlanta und anschließend Film am American Film Institute (AFI). 2013 entstand unter seiner Regie der Spielfilm »Der blinde Fleck – das Oktoberfestattentat« Es folgte 2015 der Spielfilm »Meister des Todes«, Teil des ARD-Themenabends »Tödliche Exporte« für den er mit dem Grimme-Preis ausgezeichnet wurde.
Danuta Harrich-Zandberg studierte Kunstgeschichte und Psychologie. 1983 folgte die Gründung der Film- und Fernsehproduktionsfirma diwafilm GmbH. Zusammen mit ihrem Ehemann Walter Harrich realisierte die Fernsehautorin und Produzentin zahlreiche Dokumentarfilme und -serien.
Daniel Harrich
Danuta Harrich-Zandberg
SAATDESTERRORS
Wie die westlichen Geheimdienste den Terrorvor unsere Haustür bringen
WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Originalausgabe 10/2019
Copyright © 2019 by Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Verlagsgruppe Random House GmbH,Neumarkter Straße 28, 81673 München
Begleitendes Lektorat undkonzeptionelle Unterstützung: Kerstin Lücker
Redaktion: Isabella Kortz
Umschlaggestaltung: Hauptmann und Kompanie, Zürich,unter Verwendung eines Motives von © diwafilm
Satz: Schaber Datentechnik, Austria
ISBN: 978-3-641-23992-3V001
www.heyne.de
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die drei Säulen des Terrors
Die Spur des modernen Terrors führt nach Pakistan
Anmerkungen zu den Recherchen und den verwendeten Quellen
Warum ist das Buch heute so wichtig?
Der Feind meines Feindes Teil 1
Armut, Korruption, Terrorismus
Die Teilung Indiens: Pakistan entsteht
Die Sowjets in Afghanistan
Die Sowjets verlieren den Krieg in Afghanistan
Erste Folge der 1980er: Die Taliban in Afghanistan
Zweite Folge der 1980er: Al-Qaida entsteht
Dritte Folge: Der pakistanische Geheimdienst ISI fördert Terror
Nuklearisierung Pakistans
Der Feind meines Feindes Teil 2
Nine-Eleven
Das neue Bündnis der USA mit Pakistan
2001–2011: Pakistan hilft dem Westen …
Pakistan schützt Osama bin Laden
Die Spuren von Anschlägen auf der ganzen Welt führen nach Pakistan …
Pakistan unterstützt Terroristen gegen das eigene Bündnis in Afghanistan
Auf welcher Seite steht der pakistanische Geheimdienst ISI?
Der Mord an Benazir Bhutto
Keep the fire burning
Die Geister, die ich rief …
Pakistan heute
Kehrtwende
2011 – Osama bin Laden wird in Pakistan getötet
Von Osama bin Laden zu David Headley
David Coleman Headley
Eine spektakuläre Verhaftung
Daood Gilanis Kindheit
Daood wird Drogendealer
Nine-Eleven: Gilani wird Agent in Pakistan
Ausbildung zum Terroristen
Der pakistanische Geheimdienst ISI kommt ins Spiel
Headley plant den Anschlag in Mumbai
Vorbereitungen
Diskussionen über die Ziele des Anschlags
Die Vorbereitungen des Anschlags von Mumbai werden konkret
Alle Warnungen verhallen ungehört
Der Anschlag: Protokoll der Ereignisse
Nach den Anschlägen
Welche Rolle spielen die amerikanischen Behörden? Und wie tief ist Pakistans Geheimdienst in die Anschläge verstrickt?
Die Bedeutung der Ereignisse
Headley wechselt zu al-Qaida
Headley wird gefasst
Das neue Geschäft von ISI und LeT: Anschläge in Europa
Die Welt verändert sich
Der Irak zerfällt
Der Arabische Frühling
Die Geschichte wiederholt sich
Mumbai in Europa
Paris
Ansbach
Manchester
Schluss
Nachwort und Danksagung
Register
Vorwort
Die drei Säulen des Terrors
Zehn Terroristen, bewaffnet mit Kalaschnikows, Handgranaten und Sprengstoff, fielen am 26. November 2008 gegen 21.30 Uhr in die indische Millionenmetropole Mumbai ein. Sie zogen in Zweiergruppen quer durch die Stadt, griffen fast zeitgleich das Hotel Oberoi-Trident, das Leopold Cafe, das nahe gelegene Hotel Taj Mahal Palace, den Bahnhof Victoria Terminus und ein amerikanisch-jüdisches Zentrum an. Fast drei Tage hielten sie die Stadt gefangen, deponierten Bomben, warfen Handgranaten und erschossen unschuldige Menschen. »Wir wollten schon zahlen, da hörte ich einen riesigen Knall und dann ging es los. Bam, bam, bam. Schüsse fielen – minutenlang«, erinnert sich Desirée Baumann, eine der Überlebenden. Am Ende wurden mehr als 170 Tote und mehr als 230 Verletzte gezählt.
Der Anschlag von Mumbai 2008, nach dem Vorbild von 9/11 auch 26/11 genannt, war für uns, die Autoren dieses Buches, der Einstieg in eine mehr als zehn Jahre dauernde Recherche. Was wir damals nicht ahnten: Unsere Nachforschungen führten uns nicht etwa in die ideologisch-politisch motivierten Kreise von al-Qaida und anderen Terrornetzwerken. Stattdessen zeichnete sich immer deutlicher ab, wie tief Geheimdienste und Regierungen durch den sogenannten »Krieg gegen den Terror« selbst in den Terror verstrickt sind.
Das Thema Terror ist nicht neu. Es ist jedoch noch nie so allgegenwärtig gewesen wie in den letzten Jahren, seit der internationale islamistische Terrorismus mit den Anschlägen von Brüssel und Paris Europa erreicht hat. Terror begegnet uns an den Sicherheitsschleusen von Flughäfen, Museen und praktisch jedem öffentlichen Gebäude, er beherrscht die Medien, von den Nachrichtenkanälen bis zu Spielfilmen und Serien, er durchzieht politische und gesellschaftliche Diskurse. Die Angst vor Terror hat überall in Europa politische Kräfte salonfähig gemacht, die bis dahin als die eigentliche Bedrohung der freiheitlichen Grundordnung und der Demokratie galten. Und natürlich gibt es eine unendliche Zahl von wissenschaftlichen Studien und Büchern zum Thema. Umso überraschter waren wir, als wir neben den erwartbaren politischen, ideologischen und religiösen Beweggründen auf einen Aspekt stießen, der selbst in der Fachliteratur kaum beleuchtet wird: Terror ist ein Geschäftsmodell, bei dem es um Geld, Waffen, politischen Einfluss und Macht geht, und zwar für alle Beteiligten.
Ganz gleich, ob rechts, links, fundamental-religiös oder anders motiviert und auf welcher Ebene, vom General an der Spitze einer Militärmacht bis zum Selbstmordattentäter – es lassen sich immer dieselben drei Säulen des Terrors identifizieren: 1. Ideologie, 2. Politik, 3. Geld und Macht.
Ideologie
Politik
Geld & Macht
Religion, politische Ideologien (rechts, links) etc.
Politische Verflechtungen, strategische Interessen von Staaten, etc.
Das Geschäftsmodell Terror.
Während Ideologie und Politik ausführlich und intensiv analysiert und diskutiert werden, bleibt das Geschäftsmodell Terror fast immer unter dem Radar der öffentlichen und politischen Wahrnehmung. Kaum jemand spricht darüber, dass im »Kampf gegen den Terror« Strukturen entstehen, von denen nicht nur Terrororganisationen profitieren, sondern auch Geheimdienste und Regierungen. Unsere Recherchen zeigen, dass durch die Bemühungen von – meist westlichen – Regierungen, Terror zu bekämpfen, ganze Länder von den damit verbundenen Geldflüssen und Hilfsleistungen abhängig werden. Dazu ein Beispiel: In den 1970er-Jahren hofften mehrere europäische Regierungen und sogar Unternehmen (Fluggesellschaften und Ölkonzerne), palästinensische Terrororganisationen durch Millionenzahlungen davon abhalten zu können, Anschläge auf ihrem Hoheitsgebiet durchzuführen bzw. ihre Flugzeuge zu entführen. Das Ergebnis dieser heimlichen Strategie führte keineswegs zum gewünschten Ziel. Im Gegenteil: Immer wieder gab es Anschläge, weil die palästinensischen Organisationen wussten, dass sie genauso lange Geld bekamen, wie es den Terror gab, der mit diesem Geld bekämpft werden sollte.
Im Kampf gegen den islamistischen Terror, wie wir ihn seit etwa Ende der 1990er-Jahre erleben, kooperieren westliche Geheimdienste mit Partnern – beispielsweise den Geheimdiensten von Ländern wie Pakistan, dem Irak, Iran, Saudi-Arabien oder Libyen –, deren Interessenlage nicht immer klar ist. Sicher aber kann man sagen: Je mehr Parteien involviert sind und je komplexer die Gemengelage ist, desto undurchsichtiger wird das Geschäftsmodell Terror. Und ähnlich wie die palästinensischen Terrororganisationen in den 1970er-Jahren lernen auch heute viele der Partner, mit denen westliche Regierungen Bündnisse schließen, dass Konflikte ihnen Geld, Waffen, politischen Einfluss und Relevanz bringen. Inzwischen ist es ein offenes Geheimnis, dass genau diese angeblichen Bündnispartner allenfalls nach außen hin auf der Seite des Westens stehen, dass sie oft jedoch gleichzeitig unsere Feinde unterstützen. Und das passiert nicht von ungefähr. Den Geheimdiensten und Sicherheitsapparaten in Pakistan, Tunesien, Libyen oder dem Irak ist bewusst, dass die westlichen Regierungen nur so lange an den für sie einträglichen Kooperationen interessiert sind, solange es die Konflikte gibt. Ist die Lage einigermaßen stabil, erhalten sie keine Unterstützung mehr. Warum also sollten sie daran interessiert sein, Konflikte wirklich zu befrieden?
In einem der zahlreichen Interviews, die wir im Zuge unserer Recherchen mit hochrangigen Akteuren geführt haben, bringt Richard Kemp, ehemaliger Offizier der britischen Armee und Geheimdienstkoordinator der britischen Regierung, den verhängnisvollen Zusammenhang überraschend offen auf den Punkt: »Es ist ein sehr dreckiges Geschäft. Riesige Geldsummen werden von den USA, Großbritannien, Deutschland und der EU gezahlt. Und damit werden Terroristen finanziert, die Anschläge gegen uns verüben.«
Die Spur des modernen Terrors führt nach Pakistan
Der Anschlag auf Mumbai war einer von vielen traurigen Höhepunkten in einem Dauerkrieg, der seit mehr als einem halben Jahrhundert zwischen Indien und Pakistan herrscht. Doch die Bedeutung von Mumbai 26/11 reicht über den Konflikt zwischen Indien und Pakistan hinaus. Hier gingen die Terroristen nach einer neuen Strategie vor, der Angriff auf Mumbai wurde zur Blaupause für Anschläge ähnlicher Art, die später in Kopenhagen, Paris und Berlin verübt werden sollten. Pakistan wurde zu einem Ausgangspunkt für den weltweiten islamistischen Dschihad gegen den Westen. Wieder einmal. Denn die Spuren des Terrors führten schon früher nach Pakistan. Die Wurzeln dessen, was in Mumbai geschah und sich später in Paris, Kopenhagen und Berlin wiederholte, reichen fast 40 Jahre zurück. Damals, in den 1980er-Jahren, wurde in Pakistan die Saat des Terrors gesät, die jetzt aufgegangen ist.
Als Reaktion auf die Invasion sowjetischer Truppen in Afghanistan schlossen westliche Geheimdienste – CIA, BND und andere – Ende der 1970er-Jahre zusammen mit der Regierung Pakistans und dem pakistanischen Geheimdienst ISI eine unheilvolle Allianz mit religiös-fundamentalistisch indoktrinierten Terroristen. Doch schon bald sollte sich dieses Bündnis gegen den Westen selbst richten. Lange wollte man es nicht wahrhaben, aber inzwischen ist auch den westlichen Regierungen und Geheimdiensten klar, dass Mitarbeiter des ISI und der pakistanischen Regierung zahlreiche Terrororganisationen decken, offen unterstützen und sogar gegründet haben. Pakistan spielt ein doppeltes Spiel: Offiziell ist das Land Partner der westlichen Allianz im Kampf gegen den Terror, doch hinter den Kulissen ist es zugleich Pate des Terrors.
Angehörige des ISI und des pakistanischen Sicherheitsapparates betätigen sich als Hauptsponsor und Unterstützer zahlreicher Terrororganisationen. Dabei nutzen sie ausgerechnet jene Ressourcen, die ihnen das Bündnis mit den westlichen Partnern einbringt, denn von ihnen werden sie finanziert, ausgebildet und ausgerüstet. So hat sich im Lauf der Jahrzehnte ein perfides Geschäftsmodell entwickelt, das vereinfacht bedeutet: Je mehr Geld, desto mehr Terror. Oder umgekehrt: Je mehr Terror, desto mehr Geld.
Über die fragwürdige Kooperation, die westliche Geheimdienste über Jahrzehnte mit Pakistan eingegangen sind, macht sich heute niemand mehr Illusionen; zu groß ist die Zahl der Beweise dafür, dass Pakistan seine westlichen Partner hintergeht. Daher lässt sich das »Geschäftsmodell Terror« am Beispiel dieses Landes besonders gut beschreiben. Dabei sticht ein Fall besonders hervor: Die Geschichte des amerikanisch-pakistanischen Doppelagenten David Coleman Headley.
Headley ist in vielerlei Hinsicht eine Schlüsselfigur des weltweiten Terrors. Vor allem aber ist sein Fall – anders als viele andere – außergewöhnlich gut dokumentiert. Als bekannt wurde, dass Headley nicht nur für mehrere amerikanische Dienste, sondern auch für den ISI und mehrere pakistanische Terrororganisationen aktiv war und dass er mit Mumbai 26/11 einen der schwersten Anschläge pakistanischer Terroristen auf Indien vorbereitet hatte, waren der Skandal und die Angst vor ähnlich grauenvollen Anschlägen in Europa und insbesondere in den USA so groß, dass der damalige Präsident Barack Obama seine Verhaftung persönlich anordnete. Sogar Osama bin Laden verfolgte aus seinem Versteck im pakistanischen Abbottabad intensiv den Prozess, der Headley gemacht wurde – wie schriftliche Aufzeichnungen des Terroristenführers beweisen.
Obwohl die amerikanischen Behörden versucht haben, die Einzelheiten der Akte Headley unter Verschluss zu halten, gelangten relativ viele Informationen an die Öffentlichkeit. Zum einen wurden viele Details während des strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens und des Prozesses in Chicago öffentlich, zum anderen tauchte der Fall in den von Edward Snowden geleakten Dokumenten auf, und schließlich machten indische Ermittlungsbehörden eigentlich geheime Hintergrundinformationen öffentlich, weil sie darüber enttäuscht waren, dass die Amerikaner einen der Drahtzieher des Attentats auf Mumbai nicht an Indien auslieferten. Bei Weitem nicht alle Dokumente wurden veröffentlicht. Dank stunden-, in einigen Fällen auch tagelanger Gespräche in Geheimdienstkreisen kann ein Teil der Informationen in dieses Buch einfließen.
Headleys Geschichte ist auch deshalb wichtig, weil er maßgeblich daran beteiligt war, die Attentate nach dem sogenannten Mumbai-Stil zu entwickeln. Die Anschläge vom 26. November 2008 waren auf schockierende Art und Weise neu und wurden zum Vorbild für vergleichbare Anschläge in Europa. Damit wurde Headley zum Mastermind des modernen Terrorismus, den wir heute in vielen Ländern erleben.
Headley nutzte die Verflechtungen mehrerer der einflussreichsten und mächtigsten Ermittlungsbehörden der Welt, um seine wahren Absichten zu verheimlichen. Die westlichen Dienste glaubten, mit ihm eine unverzichtbare Quelle zu haben, einen Agenten, mit dem sie das für sie ebenso undurchschaubare wie undurchdringbare Terrain der islamistischen Gotteskrieger infiltrieren konnten. Headley aber spielte zur gleichen Zeit eine strategisch führende Rolle innerhalb der pakistanischen Terrororganisation Lashkar-e-Taiba (LeT). Dabei wurde er von seinen originären Auftraggebern – den westlichen Diensten – mutmaßlich gedeckt und finanziert. Und nicht nur das: Gerade, als er sich nach den Anschlägen von Mumbai von Lashkar-e-Taiba abwandte, Kontakte zu al-Qaida knüpfte und die ersten Attentate in europäischen Städten plante, wurde er in Amerika verhaftet. Er hat also selbst noch erste Schritte unternommen, um den Terror nach Europa zu tragen. Insofern kann man an Headley in vielfacher Hinsicht beispielhaft sehen, wie die Globalisierung des Terrors funktioniert und wie leicht den Geheimdiensten die Kontrolle über ihre eigenen Ressourcen aus den Händen gleitet.
Anmerkungen zu den Recherchen und den verwendeten Quellen
Der Großteil der Recherche für dieses Buch führt in die Welt der Geheimdienste. Diese sind nicht gerade für ihre Öffentlichkeitsarbeit bekannt. Darum ist es wichtig, zu hinterfragen, welche Informationen uns zugänglich gemacht wurden und warum. Wir haben uns bei jedem Schritt unserer Recherchen mit diesen Fragen auseinandergesetzt.
Die Community der Geheimdienste befindet sich in einer Zeit drastischen Umbruchs. Die Digitalisierung des Informationsaustauschs und die Vernetzung der Welt bedeuten – neben großem Potenzial zur Informationsgewinnung – auch, dass Geheimnisse schwerer zu schützen sind und sich rasend schnell verbreiten können. Für die amerikanischen Geheimdienste, die lange Zeit große Unterstützung und das Vertrauen der Bevölkerung in den USA genossen, kommt hinzu, dass die Regierung unter Donald Trump in bis dahin ungekannter Opposition und Offenheit ihre Glaubwürdigkeit infrage stellt. Zum Beispiel, indem der Präsident wiederholt behauptete, die CIA habe ihn im Wahlkampf abgehört. Die Snowden-Dokumente und der durch sie ausgelöste NSA-Skandal haben auch in anderen Ländern das Vertrauen in die Geheimdienste erschüttert. Angesichts dieser veränderten Situation sehen viele Dienste sich offenbar dazu veranlasst, sich zu rechtfertigen und, entgegen ihrer üblichen Strategie des Schweigens, offener zu kommunizieren. Dabei kam uns im Falle unserer Recherchen zugute, dass die Geheimdienste in Bezug auf ihre Zusammenarbeit mit Pakistan nicht mehr viel zu verlieren haben. Da längst außergewöhnlich viel außergewöhnlich gut dokumentiert ist, redeten Geheimdienstvertreter ungewöhnlich offen mit uns – über die Fehler der ehemaligen Partner, aber auch über die eigenen Fehltritte.
Für Saat des Terrors konnten wir eine Vielzahl exklusiver Interviewpartner gewinnen, die sich zum Teil zum ersten Mal äußerten. Hier eine Auswahl:
Jean-Louis Bruguière – ehem. oberster französischer Ermittlungsrichter
Daniel Collins – Bundesstaatsanwalt Illinois
General Asad Durrani – ehem. Chef des pakistanischen Geheimdienstes ISI
Dr. Sajjan Gohel – International Security Director der Asia Pacific Foundation
»Sam« Charles Faddis – ehem. CIA-Agent in Pakistan
General Michael Vincent Hayden – langjähriger Direktor der CIA & zuvor NSA
Colonel Richard Justin Kemp – Geheimdienstkoordinator COBR, britisches Kabinett
Claude Moniquet – ehem. Agent des französischen Geheimdienstes
General Pervez Musharraf – langjähriger Staatspräsident Pakistans
Shuja Nawaz – Atlantic Council, South Asia Center
Markus Potzel – Sonderbeauftragter der Bundesregierung für Afghanistan und Pakistan
Gerhard Schindler – ehem. Präsident des Bundesnachrichtendiensts BND
Vikram Sood – ehem. Chef des indischen Geheimdiensts RAW
Sanjeev Tripathi – ehem. Chef des indischen Geheimdiensts RAW
Ernst Uhrlau – ehem. Präsident des Bundesnachrichtendiensts BND
Direkte Zitate sind, wo nicht anders gekennzeichnet, den von uns geführten und per Videoaufnahme dokumentierten Interviews entnommen.
Darüber hinaus haben wir eine riesige Zahl diplomatischer Depeschen und Nachrichten ausgewertet, die beispielsweise von der Whistleblower-Plattform WikiLeaks veröffentlicht worden sind.
Warum ist das Buch heute so wichtig?
Seit es ähnliche Anschläge in Kopenhagen, Paris, Brüssel usw. gab, sind Attentate im Mumbai-Stil für uns zu einer allgegenwärtigen Bedrohung geworden. Allerdings hat sich die weltpolitische Lage stark verändert. Durch die Destabilisierung des arabischen Raumes, vom Irak und Syrien bis nach Marokko, ist Europa unter den wachsenden Druck von Migrationsströmen geraten. Dass mit ihnen auf dem Höhepunkt der Ereignisse im Sommer 2015 auch Terroristen unkontrolliert in europäische Länder einreisten, machte die Lage noch schwieriger, und so begannen die westlichen Geheimdienste, neue Allianzen zu schließen, mit Geheimdiensten und Sicherheitsapparaten von Ländern, mit denen eine Kooperation aufgrund der politischen Situation und der Menschenrechtslage bis vor Kurzem noch undenkbar war. Auf einmal suchen europäische Regierungen den Schulterschluss mit den nordafrikanischen Mittelmeeranrainern und Transitstaaten oder weiten die bestehenden Bündnisse zu Kooperationen aus. Sie sollen helfen, die unkontrollierte Zuwanderung von Flüchtlingen nach Europa zu stoppen. Dafür erhalten sie Unterstützung bei Ausbildung und Ausrüstung. Und viel Geld. Was daraus folgt, sollte nicht überraschen: Die neuen »Partner« spielen dasselbe doppelte Spiel, das wir schon aus Pakistan kennen. Mal betätigen sie sich als Schleuser, mal unterstützen sie Terroristen, die Anschläge in Europa verüben. Geschichte wiederholt sich, und wir sind mittendrin.
Der Feind meines Feindes Teil 1
Armut, Korruption, Terrorismus
Im Norden der Hindukusch, der Karakorum und der Himalaja, die drei höchsten Gebirgsketten der Welt. Im Süden das Delta des Indus, eine der ältesten Kulturlandschaften der Menschheit. Schier endlose Wüsten, eine Tausende Kilometer lange Küste zum Arabischen Meer. So vielversprechend wird Pakistan in Reiseberichten beschrieben. Pakistan, doppelt so groß wie Deutschland und Österreich zusammen, ist ein atemberaubend schönes Land. Wenn man nicht an die Politik, den Terrorismus und die bittere Armut denkt, heißt es in einem Artikel in Die Welt vom 8. Mai 2011 mit dem Titel »Das gefährlichste Land der Welt«. Wenige Tage zuvor, am 2. Mai, war der meistgesuchte Terrorist, al-Qaida-Chef Osama bin Laden, in seinem Versteck in der pakistanischen Garnisonsstadt Abbottabad von einer amerikanischen Eliteeinheit gefasst worden.
In Pakistan, das zu den ärmsten und am wenigsten entwickelten Ländern der Welt gehört, zahlt nur etwa ein Prozent der Bevölkerung Steuern. Zudem leidet das hoch verschuldete Land mit rund 200 Millionen Einwohnern (laut einer UN-Schätzung von 2017) – ähnlich wie Indien – an Überbevölkerung und hat dabei mit einer jährlichen Bevölkerungszunahme von mehr als zwei Prozent eine der höchsten Wachstumsraten in Asien. Dazu kommen gigantische Naturkatastrophen, mit denen das Land in den vergangenen Jahrzehnten fertig werden musste; Erdbeben und Überschwemmungen, bei denen Hunderttausende ums Leben kamen.
Laut einer Volkszählung von 1998 waren 96,3 Prozent der damals über 130 Millionen Einwohner Muslime. Religiöse Minderheiten sind starken Repressionen ausgesetzt und dürfen ihren Glauben in der Öffentlichkeit nicht zeigen. Übergriffe auf Hindus und Christen sind keine Seltenheit. Auch kommt es laut Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International und Human Rights Watch immer wieder zu Lynchmorden und Selbstjustiz gegen die Anhänger nicht muslimischer Religionen, beispielsweise wegen des Vorwands der Gotteslästerung. Und obwohl Ehrenmorde dem pakistanischen Gesetz nach verboten sind, bezeichnen Menschenrechtsorganisationen Pakistan als das Land mit den meisten Ehrenmorden weltweit.
Doch nicht nur Extremismus und religiöse Intoleranz prägen das Klima in Pakistan. Die Staatsgewalt liegt in den Händen weniger Familien. Korruption ist laut Transparency International allgegenwärtig und die politische Lage chronisch instabil, sodass es immer wieder zu Militärputschen und politischen Morden kommt, wie dem an der ehemaligen Premierministerin Benazir Bhutto. Die Infrastruktur ist mangelhaft, und der Schmuggel mit Drogen, Waffen und Unterhaltungselektronik, der seine Basis hauptsächlich in den Stammesgebieten hat, gilt – man möchte es kaum glauben – als »Rückgrat der gesamten pakistanischen Wirtschaft«. All das wirkt auf ausländische Investoren wenig attraktiv. Im Gegensatz zum verfeindeten Nachbarland Indien, das in den 1990er-Jahren seine Märkte der Welt öffnete und zu den Globalisierungsgewinnern zählt, scheint in Pakistan eine wirtschaftliche Entwicklung kaum möglich. Auch deshalb nicht, weil das Militär und der Geheimdienst ISI Pakistan eisern in ihrem Griff halten, und die verfolgen andere Interessen: Das von ethnisch-religiösen Konflikten und Terror zerrissene, verarmte und vollkommen instabile Land besitzt die sechstgrößte Armee der Welt und verfügt über Atomwaffen.
Für Deutschland ist das Land am Hindukusch, trotz dieser Probleme, in erster Linie ein wichtiger Handelspartner. Die Bundesrepublik exportiert Maschinen, Chemieerzeugnisse, Elektroware und Fahrzeuge nach Pakistan und importiert Textilien und Lederwaren. Allein im Jahr 2018 belief sich das bilaterale Handelsvolumen der beiden Länder auf 3 Milliarden Euro. Mit Frankreich gehört Deutschland zu den wichtigsten bilateralen Partnern Pakistans. Nach dem Ausstieg Großbritanniens aus der EU rechnet man in Berlin mit einer noch wichtigeren Position Deutschlands in Pakistan. Außerdem ist Deutschland der weltweit viertgrößte Geldgeber Pakistans – mit einem 39-Millionen-Euro-Kredit für Verbesserungen in Pakistans Energiesektor. Auch darum betreibt die Bundesregierung zusammen mit anderen internationalen Geldgebern hinter den Kulissen Lobbyarbeit und lädt zweimal im Jahr zum strategischen Dialog nach Deutschland ein.
Die Teilung Indiens: Pakistan entsteht
Pakistan ist ein junger Staat, der im Nordwesten des indischen Subkontinents entstand, nachdem Konflikte zwischen der hinduistischen und der muslimischen Bevölkerung 1947 zur Teilung Indiens geführt hatten. »Mit der Freiheit kam das Morden« betitelt Die Welt einen Bericht vom 15. August 2017, der sich der Teilung des ehemals britischen Kolonialreichs widmet, der Partition. Die Grenzen Pakistans und Indiens wurden am Kartentisch festgelegt, heißt es darin. Ein Blutbad war die Folge. Ein nicht enden wollendes Blutbad. Die pakistanische Historikerin Ayesha Jalal bezeichnet die Partition als »das wohl dramatischste Ereignis in der Entkolonialisierung nach dem Zweiten Weltkrieg«. Paranoia und Hass vergiften noch immer das Verhältnis der beiden Staaten, die einmal eine Einheit waren.
Der Teilung ging eine lange gemeinsame Geschichte voraus: Die ersten Muslime waren schon im achten Jahrhundert mit Turkvölkern nach Indien gekommen. Bis zum 13. Jahrhundert eroberten sie Delhi und die Gangesebene. Sie führten die Scharia ein, das islamische Recht. Zwar mussten Nichtmuslime fortan Schutzgelder zahlen, doch die Sultane veränderten nichts an der hinduistischen Sozialordnung. Dann wurde Nordindien, einschließlich Bengalen, durch die muslimische Dynastie der Ghuriden erobert. 1352 gründete Shamsuddin Ilyas Shah das Sultanat von Bengalen, das bis 1576 bestand. Es folgte eine weitere Eroberungswelle durch Muslime Anfang des 16. Jahrhunderts. Diese aus Zentralasien stammenden Moguln brachten eine tolerante, freiheitliche Form des Islam, die zunächst im Norden des Subkontinents Fuß fasste und später mit Hilfe ihrer technisch überlegenen Armee über weite Teile Indiens die Macht übernahm. Einige der bis heute bekanntesten Prachtbauten des Subkontinents entstanden während der Herrschaft der Moguln, beispielsweise das Grabmal Taj Mahal in Agra und die Moschee Jama Masjid in Delhi.
Die Niederlassung der ersten europäischen Handelskompanien, insbesondere die East India Company, im 17. Jahrhundert bestimmten das weitere Schicksal der gesamten Region. Mit der Unterwerfung des indischen Subkontinents wuchs Großbritannien mit seinem nunmehr weltumspannenden Kolonialreich zu einer Weltmacht heran. Die Folgen dieser dramatischen Wende sollten die Zukunft politisch wie gesellschaftlich bis ins Hier und Heute entscheidend prägen. 1877 wurde Königin Victoria zur Kaiserin von Indien, Englisch zur Amtssprache. Die Machtübernahme durch die Briten brachte durchaus positive Entwicklungen: Indien erhielt ein Telegrafie- und ein Eisenbahnnetz. Der Hinduismus wurde reformiert, das indische Recht nach britischem Muster modifiziert, gegen die Menschenwürde verstoßende Praktiken wie Witwenverbrennung und Ritualmorde verboten. Doch die neuen Herrscher sahen in Indien, dem »Kronjuwel« ihres Imperiums, wie sie es nannten, vor allem einen Rohstofflieferanten, den sie hemmungslos ausbeuteten. Während sich Europa im Zuge der Aufklärung reformierte, galten die Menschenrechte mitnichten für die Einwohner der Kolonien in Asien, Afrika, Australien und Amerika.
Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Ruf nach Freiheit laut. Was zur Folge hatte, dass sich mehrere Parteien formierten, die nach Unabhängigkeit von den britischen Kolonialherren strebten, vor allem der Indische Nationalkongress, dem Mahatma Gandhi und der erste indische Ministerpräsident Jawaharlal Nehru angehörten. Wenig später sammelten sich die Muslime in der 1906 gegründeten Partei der Muslimliga. Wegen der zunehmenden Konflikte mit den Hindus arbeitete sie auf einen eigenen, von Indien unabhängigen Staat hin.
Es zeichnete sich ab, dass die ehemaligen Königreiche und Provinzen Indiens sich nach dem Ende der britischen Kolonialherrschaft in einem Staat vereinen würden. Doch genau das wollte die Muslimliga nicht. Sie fürchtete, dass die indischen Muslime, die etwa ein Viertel der Gesamtbevölkerung ausmachten, von den Hindus dominiert und um ihre Bürgerrechte gebracht werden würden. »Hindus und Moslems sind zwei Nationen, die sich in allen wesentlichen Dingen des Lebens grundsätzlich voneinander unterscheiden«, so der Wortlaut der »Zwei-Nationen-Theorie« des Führers der Muslimliga, Mohammed Ali Jinnah, mit der er die Forderung nach einem eigenen Staat begründete. Er wurde Gründervater und erster Staatspräsident des muslimischen Pakistans – nachdem die Muslimliga 1946 in den muslimisch dominierten Regionen Punjab, Bengalen und Sindh die Wahlen gewonnen und die britischen Kolonialherren der Teilung ihrer indischen Kolonie zugestimmt hatten.
Am 14. August 1947 erfolgte die offizielle Verkündung der Teilung von Britisch-Indien in zwei unabhängige Staaten: Indien und Pakistan. Das Ereignis markierte eine Zäsur in der Weltpolitik. Die sogenannte »Partition« bedeutete das Ende der britischen Weltmachtstellung und zugleich das Ende des Kolonialzeitalters. In den darauffolgenden Jahren traten überall selbstständige Staaten an die Stelle von ehemals europäischen Kolonien.
Als Indien und Pakistan in den Tagen um den 14./15. August 1947 voneinander getrennt wurden, entflammte jedoch auch einer der größten Konfliktherde der Weltpolitik. Bereits vor 1947 hatte es blutige Kämpfe zwischen den Glaubensgemeinschaften gegeben. Unter der schwindenden Autorität der ehemaligen Kolonialmacht hatte eine von politischen, sozialen und religiösen Spannungen geprägte Stimmung geherrscht. Die Hindus empfanden den Rindfleischverzehr von Muslimen als Sünde, Muslime fühlten sich durch die laute Musik der an Moscheen vorbeiziehenden Hindu-Prozessionen provoziert. Nun aber, infolge des Machtvakuums, das die Briten mit ihrem überstürzten Rückzug zurückließen, kam es zu schwersten Auseinandersetzungen zwischen Hindus und Muslimen, mit Tausenden Toten. Historiker sprechen von einem Blutrausch auf beiden Seiten der Grenze. Die Brutalität des Sommers 1947 erreichte eine neue Dimension, und sie vergiftete das Verhältnis der beiden Staaten dauerhaft. Pakistans ehemaliger Regierungschef General Pervez Musharraf erinnert sich in unserem Interview im Oktober 2018: »Ich kam 1947 mit meinen Eltern und meinen beiden Brüdern am Bahnhof von Karatschi an. Ich war drei Jahre alt. Auf dem Bahnsteig sah ich tote Menschen. Es waren Muslime.« Musharraf und seine Familie stammten aus Delhi; im Zuge der Teilung flüchteten sie in den westlichen Landesteil, das heutige Pakistan. »Die Partition war äußerst brutal. Hindus brachten Moslems um, Moslems töteten Hindus. Wir mögen einander nicht, und zwar gar nicht.« Musharraf schlug eine militärische Laufbahn ein und nahm nach eigenem Bekunden Rache am Todfeind. In zwei Kriegen, 1965 und 1971, kämpfte er gegen die verhassten Inder und stieg in den Rang eines Generals auf. Später wurde er oberster Befehlshaber der pakistanischen Armee, nach einem Militärputsch übernahm er 1999 die Macht im Land. Von 2001 bis 2008 war er Präsident Pakistans.
»Mit der Unabhängigkeit kam die Spaltung, mit der Spaltung kam der Hass«, so beschreibt der Weser-Kurier in dem Artikel »Pakistan und Indien – Erzrivalen seit 70 Jahren« vom 14. August 2017 die Gefühle »in den Herzen der Menschen und in der Politik« der verfeindeten Nachbarn treffend. Hass und Paranoia führten bereits zu drei Kriegen der Atommächte gegeneinander. In deren beider Fokus: der ewige Zankapfel Kaschmir, das malerische Bergtal im Himalaja.
Das britische Empire, das Indiens Selbstständigkeit so lange verhindert hatte, vollzog die Trennung des Subkontinents völlig überhastet, und so geriet die Partition zur Katastrophe. Selbst in Regionen und an Orten, wo Nachbarn mit unterschiedlichen Religionen jahrhundertelang friedlich zusammengelebt hatten, herrschten über Nacht Mord und Totschlag. Bis zu zwölf Millionen Menschen wurden auf beiden Seiten in die Flucht getrieben und mussten binnen weniger Monate ihre Heimat verlassen. Muslime zogen nach Pakistan, Hindus und Sikhs zogen nach Indien. Zur menschlichen Tragödie kam eine geografische Fehlentscheidung hinzu. Der Grenzverlauf zog sich in einer Zickzacklinie durch Dörfer und Felder, und so wurden bis 1950 im Zuge eines weltweit nie da gewesenen Bevölkerungsaustauschs Wohnviertel entvölkert und ganze Dörfer ausgelöscht.
Konservative Schätzungen sprechen von Hunderttausenden Toten, andere von fast einer Million Menschen, die ihr Leben verloren. Und doch konnte die Teilung das Problem der Religionskonflikte für die Zukunft nicht lösen, da ein Drittel der Muslime in Indien verblieb. Gandhi, der sich für eine faire Behandlung Pakistans bei der Teilung der kolonialen Erbmasse eingesetzt hatte, wurde am 30. Januar 1948 von einem Hindu-Fanatiker erschossen. Der Mörder, ein Brahmane, gab bei seiner Vernehmung an, er habe Gandhi getötet, weil er der muslimischen Minderheit in Indien die gleichen Rechte wie den Hindus zugebilligt habe.
Historisch gesehen war die Gebietstrennung eine der großen Tragödien des 20. Jahrhunderts, verbunden mit einem Trauma, das immer noch nachwirkt und zu einer tief sitzenden Feindschaft geführt hat. Sie belastet bis heute die Weltpolitik.
1956 rief sich Pakistan zur ersten Islamischen Republik der Welt aus. Pakistan, übersetzt »Land der Reinen«, bestand bis 1971 aus zwei Landesteilen: dem Nordwesten mit Punjab und Sindh als Kern und dem über 1500 Kilometer östlich gelegenen Ostbengalen. Dann – mit militärischer Unterstützung des verhassten Indiens – spaltete sich der Osten in einem blutigen Bürgerkrieg von Pakistan ab und nannte sich Bangladesch. Ein zweiter Streit um die Provinzen Jammu und Kaschmir entwickelte sich zum Dauerkonflikt. Die sogenannten »Northern Territories« gehörten damals nicht zu Indien, sondern zu Pakistan. Doch Lord Mountbatten, der letzte Vizekönig Britisch-Indiens, wollte für eine Übergangszeit Generalgouverneur beider Nachfolgestaaten werden. Nach einigem Hin und Her blieb ungeklärt, zu welchem der beiden Länder Kaschmir tatsächlich gehört, die indisch-pakistanische Grenze wurde im Nordwesten nicht eindeutig definiert. Damit begann der Kaschmir-Konflikt, in dem auch China Territorien beansprucht, das 1962 sogar einen Grenzkrieg mit Indien führte und seither einen Teil des Gebiets mit einer für China wichtigen Handelsstraße besetzt hält. Zweimal führten Pakistan und Indien Krieg um Kaschmir: 1947 und 1965. Beide beharren in dem bis heute ungelösten Grenzstreit an der 776 Kilometer langen »Line of Control«, jener provisorischen Grenze, die Kaschmir trennt, auf ihre Hoheitsansprüche über das Gebiet.
Die Sowjets in Afghanistan
Die neuen, nach der Teilung Indiens von den ehemaligen Kolonialherren unabhängigen, Staaten gerieten schon bald zwischen die Fronten des Kalten Krieges. Während das bündnisfreie Indien sich zur Sowjetunion wandte, orientierte sich Pakistan seit 1954 Richtung Westen. Um sich gegenüber dem Erzrivalen Indien abzusichern, suchte das Land starke Bündnispartner. Die sah man vor allem in den USA und der Volksrepublik China – beide Länder hatte Indien mit seiner an die Sowjetunion angelehnten Politik verärgert. Die USA ließen Pakistan seit den 1950er-Jahren umfangreiche finanzielle Unterstützung zukommen und belieferten das Land auch mit Waffen. Pervez Musharraf wirft den Amerikanern jedoch vor, sich damals ungerecht verhalten zu haben: »Sie lieferten uns Waffen und als wir die Waffen 1965 gegen die Inder einsetzten, bestraften [sie] uns […] mit Sanktionen. Es war ein ständiges Auf und Ab mit den Amerikanern«, sagt Musharraf. »Mal brauchten sie uns, mal brauchten sie uns nicht.«
Anfang der 1980er-Jahre brauchten die USA Pakistan – wegen eines Konflikts, der sich im Nachbarland Afghanistan zuspitzte. Hier hatte 1978 die kommunistische Partei die Macht ergriffen und begonnen, sich an die Sowjetunion anzunähern. Dagegen wehrten sich religiös motivierte Gruppen unterschiedlicher Strömungen. Sie riefen zum Widerstand gegen die angestrebte Säkularisierung auf, und so geriet Afghanistan in einen Bürgerkrieg. Ein Jahr später, 1979, griffen sowjetische Truppen in das Geschehen ein. Offiziell begründete die Regierung in Moskau den Einmarsch damit, sie wolle verhindern, dass die muslimische Bevölkerung der südlichen Sowjetrepubliken sich von dem Aufstand der islamistischen Widerstandsgruppen anstecken ließ. Wahrscheinlicher ist, dass die Sowjets fürchteten, die USA könnten ihren Einfluss in der Region ausdehnen. »Der Krieg, der nicht zu gewinnen war«, lautet der Titel eines ZEIT-Artikels vom 23. Dezember 2009. Er beleuchtet »das totale Desaster«, das der Intervention der Sowjets in Afghanistan folgte – angeführt von berüchtigten Einheiten des Geheimdienstes KGB –, am Weihnachtsabend 1979 seinen Lauf nahm und erst neun Jahre später mit einem schmachvollen Rückzug der Sowjetarmee endete.
Nach der Logik des Kalten Krieges fürchteten die USA umgekehrt den Einfluss der Sowjets. Weil sie verhindern wollten, dass Russland in Asien an Stärke gewann, unterstützten die Amerikaner den afghanischen Widerstand gegen die Kommunisten. Zu diesem Zweck gingen sie ein folgenschweres Bündnis ein, das aber einem jahrhunderte-, vielleicht jahrtausendealten militärischen Prinzip folgte: Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Der amerikanische Journalist Steve Coll, der damals für die Washington Post berichtete, beschreibt die verhängnisvolle Kooperation in seinem 2005 mit dem Pulitzer Preis ausgezeichneten Buch: Ghost Wars: The Secret History of the CIA, Afghanistan and bin Laden, from the Soviet Invasion to September 10, 2001. In dem Buch stellt Coll unter anderem die entscheidende Frage: Inwieweit waren die amerikanischen Geheimdienste bereit, im Kampf gegen den Kommunismus die wachsende Gefahr des radikalen Islamismus in Kauf zu nehmen? Die Antwort: Um diesen Kampf zu gewinnen, legten die Agenten der CIA die Saat des Terrors, indem sie Extremisten, darunter Osama bin Laden, die Macht an die Hand gaben und den verheerenden Krieg in Afghanistan gegen die sowjetischen Truppen befeuerten. Damit legten die Amerikaner die Saat für den Terror, der im September 2001 ihr eigenes Land treffen sollte, so der Journalist Steve Coll.
Nach der Invasion der Sowjets in Afghanistan versprachen die Amerikaner ihren neuen Partnern eine dauerhafte Freundschaft. Man wollte Pakistan stets zur Seite stehen, beim Aufbau der Wirtschaft helfen und den Einfluss und die Bedeutung des Landes in der Region stärken.
Welche Dimensionen diese zunächst regionale Kooperation entfalten würde, schien damals niemand zu erfassen. Bei den Millionen Afghanen, die nach Pakistan flohen, um sich von hier aus für den Kampf zu rüsten, handelte es sich um die erste Generation von wachsenden, religiös motivierten Gruppierungen, die nur ein Jahrzehnt später der gesamten westlichen Welt den Krieg erklärten. Damals wurden sie zunächst in Pakistan in Madrasen aufgenommen, Koranschulen, in denen sie sich zu »Mudschaheddin« genannten Gotteskriegern ausbilden ließen, um in einen »Heiligen Krieg«, einen »Dschihad« gegen die Sowjets zu ziehen. Pakistans Militärmachthaber General Mohammed Zia-ul-Haq ließ eigens zu diesem Zweck neue Koranschulen im Land und an der Grenze zu Afghanistan einrichten.
So begann mit dem Widerstand gegen die von den Sowjets unterstützten Kommunisten in Afghanistan der weltweit erste organisierte Dschihad der Moderne, im Zeichen einer Ideologie, die später als islamistischer Fundamentalismus bekannt wurde – finanziert und mit aufgebaut von der CIA. Pakistan, das zwischen Afghanistan und Indien in eine Nussknackerposition geraten war, bot die notwendige operationelle Basis, und so wurde das Land zur Wiege eines unheilvollen Bündnisses, das bald weit über die Unterstützung von ein paar afghanischen Widerständlern hinausreichen sollte.
Gegen die Supermacht Sowjetunion reichte eine Streitmacht aus afghanischen Flüchtlingen nicht aus. Deshalb begann der pakistanische Geheimdienst ISI, Muslime aus der ganzen Welt zu rekrutieren, die den Mudschaheddin Hilfe leisten sollten. Wie der pakistanische Journalist Ahmed Rashid in seinem Buch Taliban. Afghanistans Gotteskrieger und der Dschihad, erschienen bei Droemer 2001 (im Folgenden als »Rashid« zitiert) berichtet, wies die Regierung alle Botschaften im Ausland an, jedem, der sich den Gotteskriegern anschließen wollte, ohne große Fragen Visa auszustellen. Damit begann eine Welle der muslimischen Solidarisierung. Die Muslimbruderschaft half im Mittleren Osten bei der Rekrutierung von Freiwilligen, in Saudi-Arabien die Weltmuslimliga, im Nahen Osten die palästinensischen Radikalen. In Pakistan begrüßten Empfangskomitees des ISI und die islamistische Organisation Jamaat-e-Islami (JI





























