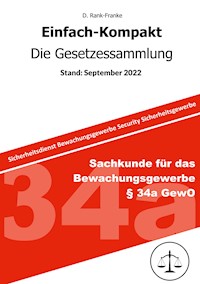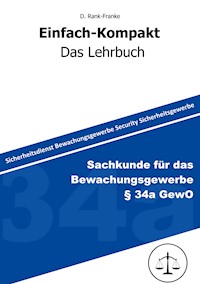
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Einfach und Kompakt ... so bestehen sie die Sachkundeprüfung gem. § 34a GewO. Mit diesem Exemplar halten Sie alles in Ihren Händen, was sie zum Bestehen der Sachkundeprüfung benötigen: Gesetzestexte, leichtverständliche Erklärungen, Kompakte Zusammenfassungen, Grafiken und Fotos. Zudem bekommen Sie zusätzliche Informationen, die Ihnen das Lernen erleichtern. Aktuelles Stand: August 2022
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Vielen Dank für den Kauf dieses Buches und Ihr damit verbundenes Interesse an der Sachkundeprüfung gem. § 34a GewO.
Das Buch entstand aus Liebe zur Sicherheitsbranche und ist die optimale Hilfe zum Erlangen der Sachkunde und zur Durchführung des 40-stündigen Unterrichtungsverfahrens bei Ihrer IHK. Zudem ist es sehr gut geeignet, um Ihr Wissen auf den aktuellen Stand zu bringen.
Zum leichteren Verständnis wurde nur eine Geschlechtsform verwendet. In allen Fällen sind jedoch m/w/d gleichermaßen angesprochen und bedacht.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Lernen!
Denis Rank-Franke
Kenntnisstand
Dokumentieren Sie hier ihren Lernerfolg. Nehmen Sie sich für jedes Themengebiet ausreichend Zeit.
Auch wenn Sie sich im Thema sicher fühlen, sollten Sie dieses nicht vernachlässigen.
Weiß ich!
1.
Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
………………
4 Fragen/8 Punkte in der schriftlichen Prüfung
2.
Gewerberecht
……………………………………………………………………
4 Fragen/4 Punkte in der schriftlichen Prüfung
3.
Datenschutzrecht
……………………………………………………………..
4 Fragen/4 Punkte in der schriftlichen Prüfung
4.
Privatrecht / Bürgerliches Gesetzbuch
…………………………….
12 Fragen/24 Punkte in der schriftlichen Prüfung
5.
Straf- und Strafverfahrensrecht / Strafgesetzbuch
…………
12 Fragen/24 Punkte in der schriftlichen Prüfung
6.
Waffenrecht / Umgang mit Waffen
………………………………….
4 Fragen/4 Punkte in der schriftlichen Prüfung
7.
UVV Wach- und Sicherungsgewerbe/ DGUV Vorschriften
8 Fragen/8 Punkte in der schriftlichen Prüfung
8.
Umgang mit Menschen
……………………………………………………..
16 Fragen/16 Punkte in der schriftlichen Prüfung
9.
Sicherheitstechnik
…………………………………………………………….
8 Fragen/8 Punkte in der schriftlichen Prüfung
Nachdem Sie alle Themen sorgfältig bearbeitet haben, erstellen Sie sich selbständig Lernkarten. Somit haben Sie eine weitere Möglichkeit, durch Schreiben und Lesen Ihr erlangtes Wissen zu vertiefen.
Inhaltsverzeichnis
Einleitung
Informationen zum Aufbau des Buches
Der Rahmenplan für die Sachkundeprüfung
1.
Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1.1 Recht
1.2 Aufteilung des Rechts
1.3 Rechtssätze, Beispiele und Abkürzungen
1.4 Rangfolge der Gesetze
1.5 Der Staat BRD - Bundesrepublik Deutschland
1.6 Verfassungsprinzipien Art. 20 GG
1.7 Opportunitäts- und Legalitätsprinzip
1.8 Folgen von Gesetzen
1.9 Gewaltmonopol
1.10 Jedermannsrechte
1.11 Zuständigkeiten Polizei und private Sicherheitsunternehmen
1.12 Public Privat Partnership/ Öffentlich Private Partnerschaft
1.13 Das Grundgesetz (GG)
1.14 Die Grundrechte
1.15 Relevante Artikel aus dem Grundgesetz
1.16 Übungsaufgaben
2.
Gewerberecht
2.1 Begriffserläuterungen
2.2 Die Gewerbeordnung - GewO
2.3 Relevante Paragrafen (§§) der Gewerbeordnung
2.4 Bewachungsverordnung
2.5 Übungsaufgaben
3.
Datenschutzrecht
3.1 Anwendungsbereiche
3.2 Begriffsbestimmungen Artikel 4 DSGVO
3.3 Besondere Kategorien personenbezogener Daten
3.4 Grundsätze für die Verarbeitung
3.5 Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
3.6 Technische und organisatorische Maßnahmen
3.7 Vertraulichkeit bei der Datenverarbeitung
3.8 Meldung und Benachrichtigung bei Verletzungen des Schutzes von personenbezogenen Daten
3.9 Datenschutz-Folgenabschätzung
3.10 Vorherige Konsultation
3.11 Rechte der betroffenen Personen
3.12 Videoüberwachung
3.13 Sanktionen und Haftung
3.14 Datenschutz und Strafrecht
3.15 Übungsaufgaben
4.
Privatrecht
4.1 Das BGB – Bürgerliches Gesetzbuch
4.2 Beginn der Rechtsfähigkeit
4.3 Sachen und Tiere
4.4 Schadensersatzpflicht/ Haftung bei unerlaubter Handlung
4.5 Minderjährige
4.6 Tierhalterhaftung
4.7 Schikaneverbot
4.8 Jedermannsrechte
4.9 Fundsachen
4.10 Übungsaufgaben
5.
Straf- und Strafverfahrensrecht
5.1 Erläuterungen relevanter Begriffe
5.2 Delikte
5.3 Tatbestandsmerkmale
5.4 Voraussetzungen der Strafbarkeit
5.5 Das StGB - Strafgesetzbuch
5.6 Relevante §§ des Allgemeinen Teils
5.7 Rechtfertigungsgründe im Strafrecht
5.8 Entschuldigungsgründe/ Schuldaufhebungsgründe
5.9 Relevante §§ des Besonderen Teils
5.10 Betäubungsmittelgesetz (Nebenstrafrecht)
5.11 Übungsaufgaben
6.
Umgang mit Waffen
6.1 Begriffserklärungen
6.2 Waffenrechtliche Erlaubnisse
6.3 Bewachungsunternehmer, Bewachungspersonal und Waffen
6.4 Aufbewahrung von Schusswaffen und Munition
6.5 Verstöße gegen das Waffenrecht
6.6 Waffen und Betäubungsmittel - analoge Verfahrensweise
6.7 Übungsaufgaben
7.
Unfallverhütungsvorschriften
7.1 DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention
7.2 DGUV Vorschrift 23 inkl. Durchführungsanweisung
7.3 DGUV Vorschrift 9 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichen am Arbeitsplatz
7.4 Übungsaufgaben
8.
Umgang mit Menschen
8.1 Menschenkenntnis
8.2 Verhalten des Menschen
8.3 Erster Eindruck
8.4 Vorurteile
8.5 Selbstbild und Fremdbild
8.6 Konflikte
8.7 Kommunikation
8.8 Situationsgerechtes Verhalten
8.9 Deeskalation und Eskalation
8.10 Führen von Personal
9.
Grundzüge der Sicherheitstechnik
9.1 Mechanische Sicherheitseinrichtungen
9.2 Elektronische Sicherheitstechnik
9.3 Wächterkontrollsysteme
9.4 Gefahrenmeldeanlagen
9.5 Kommunikationstechnik
9.6 Brandschutz
9.7 Übungsaufgaben
Abkürzungsverzeichnis
Einleitung
Die Sicherheitsbranche befindet sich im ständigen im Wandel. Täglich ergeben sich neue Herausforderungen und Aufgaben, für die ein festgelegtes Grundwissen im Bereich der Sicherheitstechnik, im Umgang mit Menschen und relevanten Rechtsvorschriften unerlässlich ist. Dieses Grundwissen ist im Rahmenplan des Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) festgelegt und wird von der jeweils zuständigen Industrie- und Handelskammer (IHK) geprüft.
Die Sachkundeprüfung teilt sich in einen schriftlichen und einen mündlichen Bereich. Nachdem der schriftliche Teil mit mindestens 50 % bestanden wurde, bekommen Sie die Zulassung zur mündlichen Prüfung. Auch in dieser werden mindestens 50 % zum Bestehen der Prüfung gefordert.
Die 120-minütige schriftliche Prüfung besteht aus 72 Multiple Choice Fragen (Mehrfachauswahl vorgegebener Antworten), welche alle Themengebiete abdecken. Durchgeführt wird die Prüfung je nach IHK in Papierform oder Digital. In der 15-minütigen mündlichen Prüfung werden Ihnen Fragen gestellt. Hier unterscheiden sich die Industrie- und Handelskammern in der Art der Fragestellung. Stellen Sie sich daher auf Fallbeispiele ein. In der mündlichen Prüfung werden nicht alle Themengebiete abgefragt. Da Sie jedoch für die schriftliche Prüfung und die spätere Praxis das gesamte Wissen benötigen, ist es ratsam sich mit allen vorgegebenen Themen zu befassen.
Sollten Sie eine Prüfung nicht bestehen, können Sie diese nach der Anmeldung bei Ihrer zuständigen IHK beliebig oft wiederholen. Wurde der schriftliche Teil bestanden, der mündlich jedoch nicht, so muss der bestandene schriftliche Teil nicht wiederholt werden.
Mit dem vorliegenden Buch haben Sie eine optimale Unterstützung für die 40-stündige Unterrichtung und Sachkundeprüfung gem. § 34a GewO und können sich bestens auf Ihren neuen Wirkungskreis vorbereiten.
Hierfür ist das Buch in neun Kapitel gegliedert, welche sich aus den folgenden Themen zusammensetzen:
Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Gewerberecht
Datenschutz
Privatrecht
Straf- und Strafverfahrensrecht
Umgang mit Waffen
Unfallverhütungsvorschriften
Umgang mit Menschen
Grundzüge der Sicherheitstechnik
Informationen zum Aufbau des Buches
Für die erfolgreiche Vorbereitung auf die Sachkundeprüfung nutzen Sie die Struktur dieses Buches.
Nach dem fettgedruckten Gesetzestext folgt jeweils eine Erläuterung, gefolgt von einer kompakten Zusammenfassung. Stellen Sie sich alles bildlich vor und transferieren Sie Ihr erlangtes Wissen in diese Vorstellung. Sprechen Sie mit Kollegen, Kursteilnehmern, Freunden und Familie. Lernen Sie jeden Tag ein bisschen und fertigen Sie ihr Lernmaterial selbständig an.
1. Gesetzestext
Zu Beginn eines Lernbereichs befindet sich der jeweilige Artikel oder Paragraf (Auszug). Dieser Gesetzestext dient zum Sammeln von Informationen und muss nicht auswendig gelernt werden.
2. Erklärung
Nach jedem Artikel oder Paragrafen folgt die Erklärung, welche in einfacher Sprache den benötigten sachkunderelevanten Inhalt widerspiegelt. Zudem gibt es kleine Zusatzinformationen und Definitionen zur Förderung des Verständnisses.
3. Beispiel
Beispiel:
In Beispielen treffen Sie immer wieder auf Willi und Antonia, Figuren die frei gewählt wurden. Die beiden Figuren verdeutlichen uns das benötigte Wissen und ermöglichen auf diese Weise den Wissenstransfer.
4. Kompakte Zusammenfassung
5. Übungsaufgaben und Notizen
Nach den Übungsaufgaben folgt ausreichend freier Platz zum notieren Ihrer Gedanken.
Nehmen Sie die Möglichkeit wahr und schreiben sie hier alles auf, was sie noch lernen müssen.
Notieren sie sich Themen, über die sie mehr erfahren möchten.
6. (Gut zu wissen…)
Gut zu wissen…
Kleine Informationen oder hilfreiche Tipps, welche das Lernen und Vertiefen von Wissen erleichtern.
Der Rahmenplan für die Sachkundeprüfung
Sie finden den gesamten Rahmenplan für die Sachkundeprüfung unter:www.dihk.de//de/themen-und-positionen/wirtschaftspolitik/gruendung-und-nachfolge-unternehmensfinanzierung/bewachungsgewerbe-2632
Kapitel 1
Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
1. Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
Dieses Kapitel handelt vom Thema RECHT in Deutschland. Es wird erläutert, in welcher Beziehung Bürger und Staat zueinanderstehen, zudem wird die Beziehung der Bürger untereinander aufgezeigt. Des Weiteren werden die Aufgaben und Befugnisse des Staates und seiner Organe mit denen der privaten Sicherheitsunternehmen verglichen. Hierbei wird deutlich, dass der Generalauftrag für beide Vergleichsseiten gleich lautet, sich jedoch z. B. in den Befugnissen und Zuständigkeitsbereichen unterscheidet.
Generalauftrag …
Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten, Gefahren und Schäden abwenden!
In Rechtsbeziehungen stehen jeder Partei gesetzlich festgelegte Rechte zu, welche durch weitere Gesetze geschützt und geregelt sind. Auf die einzelnen relevanten Gesetze wird in den folgenden Kapiteln näher eingegangen.
Beispiel:
Jede Person hat das Recht auf Freiheit gem. Artikel 2 des Grundgesetzes. Das Grundgesetz selbst erwähnt in Artikel 19, dass eine Einschränkung nur Kraft eines Gesetzes möglich ist. Diese Einschränkung wird im Strafgesetzbuch zu jeder einzelnen Straftat erwähnt und wird Freiheitsstrafe genannt. Somit kann auf Grund des Strafgesetzes die Freiheit einer Person eingeschränkt werden.
Öffentliche Sicherheit und Ordnung wird durch den Staat aufrechterhalten. So liegt es in der Hand des Staates, Verstöße gegen geltendes Recht zu verfolgen und mit Sanktionen zu belegen. In einzelnen und individuellen Fällen stehen jedoch auch den einzelnen Personen gesetzlich festgelegte Ausnahmerechte zu. Dies sind die sogenannten Jedermannsrechte (Seite →).
1.1 Recht
Der Begriff „Recht“ beinhaltet ALLE deutschen Rechtsvorschriften, wie zum Beispiel das Grundgesetz, Strafgesetzbuch, Bürgerliche Gesetzbuch, Verordnungen, richterliche Urteile, Gewohnheits- und Hausrecht usw.
Rechtsvorschriften bewirken einen friedlichen Umgang der Bürger untereinander, aber auch einen geregelten Umgang zwischen dem Staat und den Bürgern.
Demnach bedeutet Recht:
„Recht ist die Gesamtheit aller Rechtsvorschriften, die sich eine Gesellschaft gibt, um friedlich miteinander zu leben.“
Gut zu wissen …
Änderungen oder Ergänzungen von Gesetzen finden nur mit einer 2/3 Mehrheit des Bundesrates und des Bundestages statt und werden gültig mit der Unterschrift des Bundespräsidenten. (Artikel 79 GG)
1.2 Aufteilung des Rechts
Das Recht teilt sich in zwei Bereiche:
öffentliches Recht und privates Recht
Öffentliches Recht
Im öffentlichen Recht stehen Staat und Bürger in einem Rechtsverhältnis durch Über- und Unterordnung zueinander.
Dem Staat sind stärkere Rechte eingeräumt, deshalb steht dieser über dem einzelnen Bürger. Somit kann der Staat durch Richter Urteile fällen lassen, die die Rechte des betroffenen Bürgers einschränken, wenn dieser z. B. eine Straftat begeht.
Des Weiteren kann der Staat durch eingesetzte Personen (Beamte, auch Obrigkeit genannt) bestimmte Aufgaben ausführen, die nur Kraft öffentlichen Amtes ausgeführt werden dürfen. Dies sind hoheitliche Aufgaben der Beamten. Während dieser Tätigkeit verfügt der Beamte durch besondere Befugnisse über mehr Rechte und kann diese einseitig durchsetzen. Handelt der Beamte nicht im Rahmen seiner hoheitlichen Aufgaben, ist sein Handeln dem einer privaten Person gleichgestellt.
Ist mindestens einer der Beteiligten einer Rechtsbeziehung Träger hoheitlicher Rechte, wird von einem öffentlich-rechtlichen Rechtsverhältnis gesprochen.
Klassisches Beispiel für Träger hoheitlicher Rechte ist die Staatsanwaltschaft.
Sie hat die Aufgaben und Befugnisse, in Strafangelegenheiten die Strafverfolgung aufzunehmen, die Ermittlungen zu leiten und die Klage zu erheben. Sie vertritt in Gerichtsprozessen die staatlichen Interessen.
Es gibt Ausnahmen und somit die Möglichkeit, dass private Unternehmen und Personen hoheitliche Aufgaben übertragen bekommen. Dies nennt sich „Beleihung“.
Die Aufgaben bei der Beleihung sind begrenzt. Wesentliche Kernaufgaben der Polizei oder Finanzverwaltung werden Beliehenen nicht übertragen.
Typische Beispiele für Beliehene sind:
Gepäckkontrolle am Flughafen
Unternehmen, die im Auftrag der Bundespolizei an Flughäfen die Gepäckkontrollen durchführen
Überwachungsvereine wie TÜV für Hauptuntersuchungen von Fahrzeugen
Fleischbeschauer für die gesetzlich geregelte Untersuchung von Schlachttieren.
Verkehrskontrolle durch Polizei
Beispiele hoheitlicher Aufgaben:
Festsetzen von Gebühren
Erheben von Steuern
Strafverfolgung
Ordnungsbußen
Verhalten im Straßenverkehr
Beispiele privatrechtlicher Aufgaben:
Einkauf von Büromaterial
Verkauf von Eigentum
Vereinfacht lässt sich sagen, dass alle vom Staat erlassenen Verwaltungsakte hoheitliches Handeln darstellen. Hierbei ist die Aufgabe in Kombination mit dem eingesetzten Mittel (Befugnisse) zum Erreichen der Aufgabe charakterisierend.
Privates Recht
Im privaten Recht stehen sich Bürger und Bürger in einem Rechtsverhältnis durch Gleichstellung gegenüber. Bürger sind einzelne Personen (natürliche Personen) oder private Unternehmen (juristische Personen). Ein privates Sicherheitsunternehmen ist eine juristische Person und somit wie ein Bürger vor dem Gesetz zu behandeln.
Der Staat kann im privaten Recht ebenfalls wie ein Bürger auftreten. Dies geschieht während der Ausführung privatrechtlicher Handlungen, z. B. ein Beamter tätigt Einkäufe für eine Behörde.
Es ist wichtig, privates und öffentliches Recht unterscheiden zu können, da es Rechtsbeziehungen gibt, in denen beide Rechtsarten vorkommen.
1.3 Rechtssätze, Beispiele und Abkürzungen
Hinter jedem Artikel (Art.) oder Paragraphen (§) befindet sich die Angabe der Rechtsvorschrift, in der sich dieser Artikel oder Paragraph befindet.
Beispiele:
§ 242 StGB
→
Strafgesetzbuch
Art. 1 GG
→
Grundgesetz
Rechtssatz
Beispiel
Abkürzung
Gesetze
Grundgesetz
GG
Bürgerliches Gesetzbuch
BGB
Strafgesetzbuch
StGB
Strafprozessordnung
StPO
Gewerbeordnung
GewO
Datenschutz-Grundverordnung
DSGVO
Bundesdatenschutzgesetz
BDSG
Verordnungen
Bewachungsverordnung
BewachV
Satzungen
von Gemeinden oder Landratsämtern
Rechtsprechung
Gerichtsurteile
Gewohnheitsrecht
Das Gewohnheitsrecht ist ein ungeschriebenes Recht und kann somit nicht unter Strafe gestellt werden.
Es setzt voraus: langjährige, tatsächliche Ausübung der Beteiligten und die Überzeugung der Beteiligten, dass dies rechtsbindend ist.
z. B. Nur ein Mitarbeiter wird bei Schichtwechsel bezahlt.
1.4 Rangfolge der Gesetze
Das Grundgesetz ist die höchste Rechtsvorschrift in Deutschland.
Keine Rechtsvorschrift darf gegen eine höhere Rechtsvorschrift verstoßen.
Ist eine Rechtsvorschrift nicht mit dem Grundgesetz vereinbar, ist diese automatisch nichtig.
Nicht vereinbar in diesem Sinne bedeutet, dass eine Rechtsvorschrift nicht gegen das Grundgesetz verstoßen darf. Grundrechte dürfen nicht verletzt werden.
Beispiel:
Die Bewachungsverordnung darf nicht gegen die Gewerbeordnung verstoßen, da die Gewerbeordnung höherwertig ist. Die Gewerbeordnung darf wiederum nicht gegen das Grundgesetz verstoßen, da das Grundgesetz höherwertig ist.
1.5 Der Staat BRD – Bundesrepublik Deutschland
Der Staat bildet sich aus Staatsvolk, Staatsgebiet und Staatsgewalt.
Die Farben der deutschen Flagge sind Schwarz, Rot und Gold. Das Bundeswappen ist der Bundesadler auf einem Wappenschild. Es ist in denselben Farben wie die deutsche Flagge gestaltet.
Die Flagge kennzeichnet das Hoheitsgebiet eines Landes. Unter deutscher Flagge steht das Staatsgebiet (Grund und Boden des Landes), seine Konsulate, Botschaften und militärischen Liegenschaften, seine Flugzeuge und Schiffe, usw.
Somit findet das Grundgesetz Anwendung auf den oben genannten Gebieten, welche unter deutscher Flagge stehen.
Oft wird die (nichtoffizielle) Abkürzung „BRD“ verwendet. Dies stellt den Namen „Bundesrepublik Deutschland“ dar.
Bei genauer Betrachtung der Worte „BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND“ ergeben sich folgende Begriffe:
BUND
Deutschland ist ein föderaler Staat, d.h. 16 Bundesländer bilden einen Bund (siehe Seite
→
Bundesstaat).
REPUBLIK
Das Volk oder seine Vertreter wählen Personen, die für eine bestimmte Zeit die oberste Gewalt des Staates ausüben. Dadurch ist gewährleistet, dass niemand Ansprüche auf die oberste Gewalt ein Leben lang oder durch Geburt hat.
DEUTSCHLAND
Eigenname des 1949 gegründeten Landes
1.6 Verfassungsprinzipien
Die Verfassungsprinzipien gem. Artikel 20 GG sind die Grundsätze und Regeln des Aufbaus der Bundesrepublik Deutschland. Diese Prinzipien spiegeln die Merkmale der Staats-/Herrschaftsform wider, wie z. B. Diktatur, Demokratie oder Monarchie.
Art. 20 GG Verfassungsprinzipien
Demokratie: Alle Macht geht vom Volke aus. Die Staatsgewalt muss vom Volke ausgehen, damit die Selbstbestimmung des Volkes gewährleistet ist.
Sozialstaat: Soziale Gerechtigkeit und Sicherheit für die Bürger Deutschlands wird angestrebt. Daher gibt es verschiedene Unterstützungen, um die Lebensbedingungen der Bürger nicht zu weit auseinander driften zu lassen.
Rechtsstaat: Das Handeln des Staates und seiner Verwaltungen werden von Gesetzen beschränkt (z. B. keine Strafe ohne Gesetz) und gelenkt. Dadurch wird staatlicher Willkür vorgebeugt.
Republik: Das Volk oder seine Vertreter wählen Personen, die für eine bestimmte Zeit (Legislaturperiode) die oberste Gewalt des Staates ausüben. Es wird gewährleistet, dass niemand Ansprüche auf die oberste Gewalt ein Leben lang oder durch Geburt hat.
Gewaltenteilung: Die Gewalt darf grundsätzlich nur vom Staat ausgeführt werden. Für diesen Zweck wird die Gewalt in drei Bereich aufgeteilt, welche sich gegenseitig kontrollieren (horizontale Gewaltenteilung). Diese Bereiche sind Legislative (gesetzgebende Gewalt), Exekutive (ausführende Gewalt) und Judikative (rechtsprechende Gewalt).
Gesetzgebende Gewalt
Ausführende Gewalt
Rechtsprechende Gewalt
Legislative
Exekutive
Judikative
Bundestag, Bundesrat, Landtage, Senate
Polizei, Staatsanwaltschaft, Ministerien
Gerichte, Richter
1.7 Opportunitäts- und Legalitätsprinzip
Opportunitätsprinzip und Legalitätsprinzip sind relevante Begriffe im Strafrecht. Diese Prinzipien (Grundsätze) gelten für Träger hoheitlicher Rechte, wie z. B. Polizei und Staatsanwaltschaft.
Das Legalitätsprinzip besagt, dass Strafverfolgungsbehörden (Polizei und Staatsanwaltschaft) tätig werden müssen, wenn sie von Straftaten erfahren. Es ergeht aus diesem Grundsatz die Verpflichtung zum Handeln bei Kenntnisnahme von Straftaten für die Strafverfolgungsbehörde. Die Straftat muss nicht vollendet sein, allein die Möglichkeit einer Straftat reicht für die Handlungsverpflichtung aus.
Die Polizei unterliegt der Verpflichtung nach dem Legalitätsprinzip in strafrechtlichen Angelegenheiten immer. Sie muss bei einem Anfangsverdacht die Ermittlungen aufnehmen und dies der Staatsanwaltschaft mitteilen. Auch die Staatsanwaltschaft muss nach dem Legalitätsprinzip handeln. Jedoch hat sie besondere Befugnisse zum Einstellen der Strafverfolgung, wenn die Straftaten z. B. geringfügig sind oder schwerwiegendere Straftaten verfolgt werden müssen. Dies ist das Opportunitätsprinzip. Es besagt, dass Entscheidungen nach pflichtgemäßem Ermessen getroffen werden dürfen.
Durch das Opportunitätsprinzip kann somit das Legalitätsprinzip im Rahmen des gegebenen Entscheidungsspielraums außer Kraft gesetzt werden.
Die Polizei kann das Opportunitätsprinzip im Bereich von Ordnungswidrigkeiten anwenden. Sie kann unter mehreren möglichen Entscheidungen wählen, wie z. B. eine Verwarnung aussprechen oder ein kleines Bußgeld verhängen.
1.8 Folgen von Gesetzen
Jeder Verstoß gegen ein Gesetz hat Folgen:
Verstoß gegen Strafgesetzbuch (StGB) hat Strafe zur Folge
Verstoß gegen Bürgerliches Gesetzbuch hat Schadensersatz, Schmerzensgeld und Herausgabe zur Folge
Verstoß gegen Ordnungswidrigkeitengesetz hat Bußgeld zur Folge
Werden die Gesetze eingehalten, schützen diese vor den jeweiligen Folgen.
Wird ein Recht aus dem Grundgesetz verbotener Weise verletzt, wird die zur Verletzung führende Handlung bestraft. Dazu werden die Einzelheiten der Handlung mit dem Gesetzestext verglichen. Im Gesetzestext finden sich Merkmale wieder, welche komplett durch die Einzelheiten der Handlung erfüllt werden müssen. Dies nennt sich Tatbestandmäßigkeit.
Beispiel:
Willi schlägt Antonia unerlaubt mit der Faust auf die Nase, wodurch die Nase stark blutet.
Die Straftat Körperverletzung gem. § 223 StGB lautet:
(1) Wer eine andere Person körperlich mißhandelt oder an der Gesundheit schädigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) Der Versuch ist strafbar.
Nun wird Wille seine Tat mit dem Gesetzestext verglichen. Decken sich alle Tatbestände (Merkmale) aus dem Gesetzestext mit den Merkmalen aus Willis Tathandlung, wird dies „Tatbestandsmäßig“ genannt.
Merkmale Willis Tathandlung
Tatbestände aus dem Gesetz
Antonia ----------------------------
→
einen anderen
Schlag auf die Nase -------------
→
körperlich misshandeln / an der Gesundheit schädigen
Willi verstößt gegen das Gesetz und hat keinen Grund, der dies rechtfertigt ------------------------------
→
rechtswidrig
Erfüllt Willi alle Tatbestände aus dem Gesetz, kann er eine Strafe bekommen. In diesem Fall eine Strafe gemäß § 223 StGB Körperverletzung.
1.9 Gewaltmonopol
Das Monopol der Gewalt hat der Staat.
Somit kann grundsätzlich nur der Staat Gewalt anwenden. Dies ist wichtig, damit die einzelnen Bürger nicht mit Faustrecht und Selbstjustiz um ihre Rechte kämpfen.
Will ein Bürger seine Rechte ausüben oder durchsetzen, muss er sich an den Staat wenden. Stehen sich Bürger in einem Rechtsstreit gegenüber und finden keine Lösung, wenden sie sich an das entsprechende Gericht (z. B. Arbeitgeber und Arbeitnehmer an das zuständige Arbeitsgericht).
Grundsätzlich bedeutet, es gibt Ausnahmen. Im Fall des Gewaltmonopols sind dies die Jedermannsrechte. Hierbei wird ein Bürger gegenüber einem anderen Bürger tätig. Klassisches Beispiel ist die Notwehr.
Eine weitere Ausnahme bildet das Hausrecht. Hierbei hat der Inhaber des Hausrechts höhere Rechte als sein Gegenüber. Das Hausrecht hat seine Wurzeln in den Artikeln 13 und 14 Grundgesetz. Aus den §§ „903 BGB Eigentümer“ und „859 BGB Selbsthilfe des Besitzers“ ergeben sich die Befugnisse des Hausrechtsinhabers.
Gut zu wissen…
Niemand hat in Deutschland das Sicherheitsmonopol. Jeder ist für seine eigene Sicherheit verantwortlich und deshalb stehen jeder Person die Jedermannsrechte zur Verfügung.
1.10 Jedermannsrechte
Rechte, welche jeder auf Grund bestehender Gesetze ausüben darf, werden Jedermannsrechte genannt. Diese erlauben es, ein Rechtsgut einer anderen Person zu verletzen, gleichzeitig schützen sie vor den Folgen des jeweiligen Gesetzes. Folgen wären beispielsweise Strafe, Schadensersatz, Schmerzensgeld oder Geldbuße, aber auch Handlungen, Duldungen und Unterlassungen.
Sachkunderelevante Jedermannsrechte befinden sich in folgenden Gesetzen:
Jedermannsrechte sind die Rechtsgrundlagen für das Eingreifen in Rechte anderer durch private Sicherheitskräfte und sind zudem der Grund für die erlaubte Durchführung eines normalerweise verbotenen Tuns.
Durch diese gesetzliche Erlaubnis entfallen bei einer Tat entweder die Rechtswidrigkeit oder die Schuld.
Wird durch ein Jedermannsrecht die Rechtswidrigkeit ausgeschlossen, stellt dieses Jedermannsrecht einen Rechtfertigungsgrund dar. Die Schuld bleibt erhalten, die Rechtswidrigkeit entfällt. Somit bekommt der Täter keine Strafe.
Ein Jedermannsrecht, welches den Täter entschuldigt, wird Entschuldigungsgrund genannt. In diesem Fall bleibt die Rechtswidrigkeit erhalten, die Schuld entfällt und der Täter bekommt keine Strafe.
Jedermannsrechte teilen sich auf in Rechtfertigungsgründe und Entschuldigungsgründe.
Rechtfertigungsgrund
Entschuldigungsgrund
§ 227 BGB Notwehr
§ 35 StGB Entschuldigender Notstand
§ 228 BGB Notstand
§ 229 BGB Selbsthilfe
§ 859 BGB Selbsthilfe des Besitzers
§ 860 BGB Selbsthilfe des Besitzdieners
§ 904 BGB Notstand
§ 32 StGB Notwehr
§ 34 StGB Rechtfertigender Notstand
§ 127 Abs. 1 StGB vorläufige Festnahme
§ 15 OwiG Notwehr
Gut zu wissen …
Weitere Entschuldigungsgründe sind der § 33 StGB Überschreiten der Notwehr und Putativnotwehr.
Diese können die Tat des Täters ebenfalls entschuldigen. Die Rechtswidrigkeit bleibt erhalten und die Schuld wird ausgegrenzt.
Für die Überschreitung der Notwehr und Putativnotwehr entsteht eine Schadensersatzpflicht, der der Nothandelnde unterliegt.
1.11 Zuständigkeiten Polizei und privater Sicherheitsunternehmen
Der Zuständigkeitsbereich, die Befugnisse und Rechtsgrundlagen der Sicherheitsunternehmen sind eindeutig von denen der Polizei abzugrenzen.
Der Generalauftrag für Polizei und private Sicherheitsunternehmen lautet:
„Sicherheit und Ordnung aufrechterhalten, Gefahren und Schäden abwenden!“
Jedoch müssen die Zuständigkeiten klar unterschieden werden.
Polizei
Private Sicherheitsunternehmen
durch die ihr vom Staat übertragenen Aufgaben und Befugnisse übt sie
hoheitliche Rechte
aus
grundsätzlich im öffentlichen Bereich tätig
Ländersache
auf Grund von Polizeigesetzen der Länder als ausführendes Organ des Staates tätig
KEINE hoheitlichen Rechte
grundsätzlich im privaten Hausrechtsbereich oder privaten Hausrechtsbereich mit tatsächlich öffentlichem Verkehr tätig
Jedermannsrechte und ihm übertragenden Selbsthilferechte
Rechtsgrundlage ist ein zivilrechtlicher Dienstleistungsvertrag
gesetzlich übertragene Befugnisse
Beispielgesetze: die Zuständigkeiten der Polizei und Behörden befinden sich, je nach Bundesland in Polizeigesetzen, im Landesverwaltungsgesetz oder Gesetz über die Sicherheit und Ordnung (z.B. NdsSOG)
Beispielgesetze: StGB, BGB und OwiG enthalten Jedermannsrecht „Notwehr“
1.12 Public-Private-Partnership / Öffentlich-Private-Partnerschaft
Es entsteht ein Vertrag zwischen einer öffentlichen Stelle und einem privaten Unternehmen. Die privaten Unternehmen übernehmen die Dienstleistung und die öffentlichen Stellen die Obhut der Ziele dieser Zusammenarbeit.
Während dieser Zusammenarbeit profitieren beide Parteien von den Erfahrungen des Vertragspartners.
Durch eine PPP/ÖPP werden die Haushalte entlastet und neue Märkte für private Unternehmen erschlossen.
1.13 Das Grundgesetz (GG)
Das Grundgesetz ist die Verfassung der Bundesrepublik Deutschland. Diese trat am 23. Mai 1949 in Kraft.
Die Aufgabe des Grundgesetzes ist es, den einzelnen Bürger vor der Willkür des Staates zu schützen und starke Eingriffe in die Grundrechte des Bürgers zu vermeiden. Die Grundrechte sind Abwehrrechte des Bürgers gegenüber dem Staat.
Das Grundgesetz besitzt eine sogenannte Drittwirkung, welche den mittelbaren (indirekten) Umgang der Bürger untereinander regelt. Der Ausgangspunkt der bürgerlichen Rechtsbeziehung befindet sich im Grundgesetz. Die unmittelbare (direkte) Regelung der Rechtsbeziehung befindet sich im jeweiligen Gesetz. Handelt es sich bei der Rechtsbeziehung, z. B. um Schadensersatz, so ist das Bürgerliche Gesetzbuch zu beachten.
Die Artikel 1 bis 19 des Grundgesetzes führen Bürger- und Menschenrechte auf.
Bürgerrechte sind Rechte von Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit.
Menschenrechte sind Rechte aller Personen, egal welcher Nationalität.
Andere Artikel (z.B. Art. 20 GG Verfassungsprinzipien) beschäftigen sich mit dem Aufbau und der Organisation des Staates. Rechte und Pflichten der Bundesländer, Aufbau der Regierung und Organisation der Rechtsprechung, Parlamente usw.
1.14 Die Grundrechte
Grundrechte werden auch Rechtsgüter oder Rechte genannt. Sie stammen aus den Artikeln des Grundgesetzes. Eine Einschränkung der Grundrechte oder der Eingriff in Grundrechte ist nur aufgrund eines Gesetzes und mit ausdrücklicher Genehmigung des Grundgesetzes erlaubt.
Gegenüber dem Staat dienen die Grundrechte als Abwehrrechte. Sie verkörpern eine Ordnung der Werte für alle Rechtsbereiche und binden die Staatsgewalt als unmittelbar geltendes Recht.
Die Grundrechte teilen sich in Rechtsgüter für einzelne Personen, welche Individualrechtsgüter genannt werden. Des Weiteren gibt es Universalrechtsgüter. Dies sind Rechtsgüter, die der Allgemeinheit zustehen.
Gut zu wissen …
Rechtsgüter haben eine festgelegte Reihenfolge, an der die Wertigkeit zu erkennen ist. Die nachfolgend genannten 5 Rechtsgüter sollten Sachkundeprüflinge kennen.
LEBENLEIBFREIHEITEIGENTUMEHRE1.15 Relevante Artikel aus dem Grundgesetz
Art. 1 GG Menschenwürde – Menschenrechte – Rechtsverbindlichkeit der Grundrechte
(1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
(2) Das deutsche Volk bekennt sich darum zu unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt.
(3) Die nachfolgenden Grundrechte binden Gesetzgebung, vollziehende Gewalt und Rechtsprechung als unmittelbar geltendes Recht.
Die Menschenwürde ist ein Recht, welches jedem Menschen von Geburt an zusteht. Sie darf weder vom Staat, noch durch einen anderen Menschen verletzt werden.
Niemand darf auf Grund seiner Rasse, Hautfarbe, Religion, Herkunft, seines Körperstatus, Geschlechts o. ä. eine Benachteiligung erleiden.
Jeder hat einen Anspruch auf Achtung seiner Werte und Anspruch auf Achtung voreinander. Dieser Anspruch ist absolut und kann nicht eingeschränkt werden.
Für Sicherheitsmitarbeiter bedeutet dies, dass z. B. ausschließlich homogene (gleichgeschlechtliche) Kontrollen durchzuführen sind.
Beispiele:
Willi ist Warenhausdetektiv und beobachtet Antonia bei einem Diebstahl. Nachdem er sie angesprochen hat, ruft er lautstark durch das Warenhaus zu einem Mitarbeiter: „Schau mal, die Tante hier hat geklaut!“ Danach führt er direkt im Kassenbereich bei Antonia eine körperliche Kontrolle durch, wobei er alle Körperstellen berührt.
Art. 2 GG Persönliche Freiheitsrechte
(1) Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.
(2) Jeder hat das Recht auf Leben und körperliche Unversehrtheit. Die Freiheit der Person ist unverletzliche. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes eingegriffen werden.
Der Artikel 2 GG enthält mehrere Grundrechte, wie z. B. Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit (Leib), Recht auf Freiheit.
Von der „freien Entfaltung der Persönlichkeit“ lassen sich weitere Rechte ableiten, wie z. B. die Ehre und der Schutz der personenbezogenen Daten.
Art. 3 GG Gleichheit vor dem Gesetz
(1) Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich.
(2) Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männer und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.
(3) Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen und politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden.
Alle Menschen sind gem. Art. 3 GG gleich, gleichberechtigt und sind gleich zu behandeln. Dies zählt für Frauen und Männer, Menschen anderer Herkunft, Rasse und für Menschen mit einer Behinderung.
Art. 5 GG Freiheit der Meinung, Kunst und Wissenschaft
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
(3) Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.
Jeder hat das Recht, seine Meinung frei zu äußern, solange keine Rechte Dritter verletzt werden und nicht gegen das Gesetz verstoßen wird.
Wird das Recht der Ehre (Persönlichkeitsrecht aus Artikel 2 GG) eines anderen durch die Meinung einer Person verletzt, so wird das Recht der sich äußernden Person eingeschränkt.
Art. 10 GG Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis
(1) Das Briefgeheimnis sowie das Post- und Fernmeldegeheimnis sind unverletzlich.
(2) Beschränkungen dürfen nur auf Grund eines Gesetzes angeordnet werden. Dient die Beschränkung dem Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung oder des Bestandes oder der Sicherung des Bundes oder eines Landes, so kann das Gesetz bestimmen, dass sie dem Betroffenen nicht mitteilen wird und dass an die Stelle des Rechtsweges die Nachprüfung durch von der Volksvertretung bestellte Organe und Hilfsorgane tritt.
Schriftstücke, Telefongespräche, Telegramme, E-Mails usw., deren Inhalt für eine bestimmte Person ist, darf grundsätzlich weder der Staat noch eine andere private Person lesen oder sich anders vom Inhalt Kenntnis verschaffen (z.B. Abhören von Telefonaten oder Durchleuchten von Briefen).
Wird das Grundrecht eingeschränkt, so darf dies nur auf Grund eines Gesetzes erfolgen.
Art. 12 GG Berufsfreiheit
(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.
(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht.
(3) Zwangsarbeit ist nur bei einer gerichtlich angeordneten Freiheitsentziehung zulässig.
Jeder Deutsche kann seinen Beruf frei wählen, wobei der Staat die Voraussetzungen für den Beruf festlegen kann. So z. B. die Sachkundeprüfung für Citystreifen, Warenhausdetektive, Türsteher usw.
Art. 13 GG Unverletzlichkeit der Wohnung (Auszug)
(1) Die Wohnung ist unverletzlich.
(2) Durchsuchungen dürfen nur durch den Richter, bei Gefahr im Verzuge auch durch die in den Gesetzen vorgesehenen anderen Organen angeordnet und nur in der dort vorgeschriebenen Form durchgeführt werden.
Jeder hat das Recht, frei zu bestimmen, wer seine Wohnung betritt oder darin verweilen darf. Das Hausrecht ist in den Artikeln 13 und 14 GG verankert.
Bei Gefahr im Verzuge oder durch richterliche Anordnung dürfen entsprechende staatliche Organe die Wohnung betreten. Die Vorgaben der richterlichen Anordnung sind einzuhalten.
Art. 14 GG Eigentum – Erbrecht – Enteignung
(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.
(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.
(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.
Jeder hat das Recht auf Eigentum. Mit dem Eigentum dürfen nicht die Gesetze oder Rechte anderer Menschen verletzt werden.
Steht das Wohl der Allgemeinheit im Vordergrund, kann eine Enteignung durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes stattfinden.
Hausrecht ist in Artikel 13 und 14 GG verankert.
Art. 19 GG Einschränkung von Grundrechten – Rechtsweg (Auszug)
(1) Soweit nach diesem Grundgesetz ein Grundrecht durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes eingeschränkt werden kann, muss das Gesetz allgemein und nicht nur für den Einzelfall gelten …
(2) In keinem Fall darf ein Grundrecht in seinem Wesensgehalt angetastet werden…
(4) Wird jemand durch die öffentliche Gewalt in seinen Rechten verletzt, so steht ihm der Rechtsweg offen …
Eine Einschränkung der Grundrechte darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes stattfinden.
Art. 104 GG Freiheitsentziehung
(1) Die Freiheit der Person kann nur auf Grund eines förmlichen Gesetzes und nur unter Beachtung der darin vorgeschriebenen Formen beschränkt werden. Festgehaltene Personen dürfen weder seelisch noch körperlich misshandelt werden.
(2) Über die Zulässigkeit und Fortdauer einer Freiheitsentziehung hat nur der Richter zu entscheiden. Bei jeder nicht auf richterliche Anordnung beruhenden Freiheitsentziehung ist unverzüglich eine richterliche Entscheidung herbeizuführen. Die Polizei darf aus eigener Machtvollkommenheit niemanden länger als bis zum Ende des Tages nach der Ergreifung in eigenem Gewahrsam halten. Das Nähere ist gesetzlich zu regeln.
(3) Jeder wegen des Verdachtes einer strafbaren Handlung vorläufig Festgenommene ist spätestens am Tag nach der Festnahme dem Richter vorzuführen, der ihm die Gründe der Festnahme mitzuteilen, ihn zu vernehmen und ihm Gelegenheit zu Einwendungen zu geben hat. Die Richter hat unverzüglich entweder einen mit Gründen versehenen schriftlichen Haftbefehl zu erlassen oder die Freilassung anzuordnen.
(4) Von jeder richterlichen Entscheidung über die Anordnung oder Fortdauer einer Freiheitsentziehung ist unverzüglich ein Angehöriger des Festgehaltenen oder eine Person seines Vertrauens zu benachrichtigen.
Schutz vor unberechtigtem Freiheitsentzug und vor psychischer und physischer Misshandlung während des Festhaltens. Ein Richter muss unverzüglich eine Entscheidung über die Fortdauer oder Entlassung herbeiführen.
1.16 Übungsaufgaben