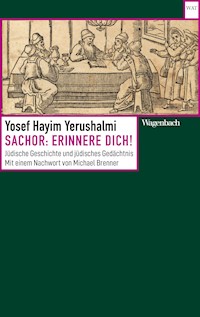
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Verlag Klaus Wagenbach
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Von den Festen Pessach, Chanukka oder Purim bis hin zum Gedenken an die großen Wellen der Vernichtung: Das Judentum ist geprägt von der Erinnerung. So bildet der biblische Imperativ »Sachor: Erinnere Dich!« die Grundlage für die gemeinsame Identität und das Überleben der Juden als Gemeinschaft. Umso erstaunlicher ist, dass sich im Gegensatz zu vielen anderen zeitgenössischen Kulturen in der jüdischen Tradition seit der Zerstörung des Tempels und dem Beginn der Diaspora bis zur Moderne praktisch kaum eine Geschichtsschreibung findet. In seiner wegweisenden Untersuchung geht Yosef Hayim Yerushalmi dem Paradox einer Geschichtsbetrachtung nach, die nicht auf die Vergangenheit ausgerichtet ist, und beleuchtet das Konkurrenzverhältnis von exakter, wissenschaftlicher Historiografie und identitätsstiftender, lebendiger Tradition. Dahinter steht die fundamentale Frage nach dem richtigen Gebrauch der Geschichte, der den Zusammenhalt der Gesellschaft ebenso betrifft wie die umkämpfte Erinnerung an den Holocaust.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 222
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Judentum ist geprägt von der Erinnerung. So bildet der biblische Imperativ »Sachor: Erinnere Dich!« die Grundlage für die gemeinsame Identität und das Überleben der Juden als Gemeinschaft trotz Vertreibung, Verstreuung und Verfolgung. In seiner wegweisenden Untersuchung geht Yosef Hayim Yerushalmi dem Paradox einer Geschichtsbetrachtung nach, die nicht auf die Vergangenheit ausgerichtet ist. Dahinter steht die fundamentale Frage nach dem richtigen Gebrauch der Geschichte, der den Zusammenhalt der Gesellschaft ebenso betrifft wie die umkämpfte Erinnerung an den Holocaust. Ein Klassiker nicht nur jüdischer Geschichtsschreibung, mit einem neuen Nachwort von Michael Brenner.
Yosef Hayim Yerushalmi
SACHOR: ERINNERE DICH!
Jüdische Geschichte und jüdisches Gedächtnis
Aus dem amerikanischen Englisch von Wolfgang Heuss und mit einem Nachwort von Michael Brenner
Aktualisierte Ausgabe
Verlag Klaus Wagenbach Berlin
Dem Gedenken meines Vaters
Yehuda Yerushalmi
zum Dank für das Geschenk
einer lebendigen Vergangenheit
Und meinem Sohn Ariel
der Freude in die Gegenwart und
Vergangenheit in der Zukunft bringt
Inhalt
Vorwort
Biblische und rabbinische Grundlagen
Das Mittelalter
Nach der Vertreibung aus Spanien
Das Unbehagen in der modernen Geschichtsschreibung
Nachwort: Yosef Hayim Yerushalmi. Eine persönliche Würdigung
Anmerkungen
Vorwort
Denn frage doch ein frühes Geschlecht,
merke aufs Forschen ihrer Väter
– denn von gestern sind wir und wissen nicht,
denn ein Schatten sind unsre Tage auf Erden –,
unterweisen sie dich nicht, sprechen zu dir,
bringen Worte aus ihrem Herzen hervor?
Hiob 8,8
da wir so gut dies unser Schicksal erkannten
Irrende zwischen zerbrochenen Steinen seit drei-
oder sechstausend Jahren
Stocherer in geborstenem Bauwerk das leicht
unser eigenes Haus wär
gelehrige Schüler von Jahreszahlen und heroischen Taten:
gelingt es uns noch?
Giorgos Seferis, Mythischer Lebensbericht, 22. Stück (Übersetzung von Christian Enzensberger)
Das vorliegende Buch – historische Betrachtung, Bekenntnis und Glaubensbekenntnis in einem – hat bei seiner Entstehung mehrere Stadien durchlaufen. Die jeweils nächste Stufe war bei diesem Entwicklungsprozess nie vorhersehbar. Als ich 1977 ein Freisemester in Jerusalem verbrachte, hielt ich am Institut für Jüdische Studien der Hebräischen Universität einen Vortrag über jüdische Geschichtsschreibung im 16. Jahrhundert. Dieses an sich schon faszinierende Thema wählte ich vor allem, weil ich meine, dass ein richtiges Verständnis dieses Einzelphänomens zum Ausgangspunkt für eine Reihe von Fragen nach dem Stellenwert der Historiografie in der jüdischen Kultur überhaupt werden kann. Nach meiner Rückkehr in die Vereinigten Staaten wurde ich um einen Beitrag zu der damals in Vorbereitung befindlichen Festschrift der American Academy for Jewish Research gebeten. Ich steuerte eine etwas ausführlichere englische Fassung meines hebräischen Vortrags bei, die dann unter dem Titel »Clio and the Jews. Reflections on Jewish Historiography in the Sixteenth Century« im Herbst 1980 in besagtem Band erschien. Wie schon im ursprünglichen Vortrag hielt ich mich auch in diesem Aufsatz eng an das titelgebende Thema; gelegentliche Hinweise auf den größeren Zusammenhang gab es aber schon damals.
Dabei hätte es sein Bewenden haben können, wäre nicht die freundliche Einladung der University of Washington an mich ergangen, im April 1980 die Stroum Lectures zu übernehmen. Die Gelegenheit schien günstig für eine umfassendere, nicht mehr auf eine einzelne Epoche beschränkte Darstellung der Fragen, die mich bewegten. Dennoch formulierte ich das Thema – »Jüdische Geschichte und jüdisches Gedächtnis« – nicht ohne Bedenken. Im Rahmen von vier Vorträgen war es offensichtlich ausgeschlossen, die Fragen, um die es geht, in der gebotenen Ausführlichkeit und Detailgenauigkeit zu untersuchen. Trotz dieser Zweifel machte ich mich aber an die Arbeit und hielt schließlich auch die Vorträge. Dieses Buch ist das Ergebnis.
Soviel zu den äußeren Umständen, unter denen das Buch zustande kam. In einem tieferen Sinne verdankt es seine Entstehung aber meinem Ringen um mein Selbstverständnis als jüdischer Historiker, nicht etwa im objektiven Kontext dieser weltweiten Wissenschaft, sondern vielmehr im engeren Rahmen der jüdischen Geschichte selbst. Mit der jüdischen Geschichtswissenschaft an sich habe ich keine Probleme – oder doch nur solche, wie sie Historiker anderer Fächer auch kennen. Wenn einer schon den Großteil seiner Arbeitskraft dem Studium der Vergangenheit widmen will, steht außer Frage, dass die jüdische Geschichtswissenschaft, was ihre Bedeutung und Leistungen angeht, es mit jeder anderen aufnehmen kann. Aus dem Blickwinkel der jüdischen Geschichte aber sieht die Sache anders aus. Der eigentliche Kern dieses Buches ist nämlich der Versuch, ein Phänomen zu verstehen, welches mir lange als ein Paradox erschien – die Tatsache, dass zwar die Frage nach dem Sinn der Geschichte bei den Juden zu allen Zeiten eine entscheidende Rolle spielte, die Geschichtsschreibung dagegen entweder gar keine oder bestenfalls eine untergeordnete. Hand in Hand damit geht die Feststellung, dass Erinnerung an die Vergangenheit zwar immer ein zentraler Aspekt der jüdischen Erfahrung, aber nicht in erster Linie dem Historiker anvertraut war.
Flotte Formulierungen und mangelnde semantische Präzision haben diese bedeutsame Dualität oft verborgen. Schließlich haben die Juden den Ruf, eines der am stärksten historisch orientierten Völker zu sein, mit dem längsten und hartnäckigsten Gedächtnis. Je nachdem, was man unter ›Gedächtnis‹ und ›Geschichte‹ versteht, kann solches Lob durchaus zutreffend oder auch völlig falsch sein; es bedeutet gar nichts, solange man nicht dazu sagt, welche Art der Geschichte die Juden geschätzt, was sie aus ihrer Vergangenheit als erinnernswert ausgewählt und wie sie das Erinnerte bewahrt, überliefert und mit neuem Leben erfüllt haben. Diese Frage will ich untersuchen und hoffe dabei deutlich machen zu können, dass das Interesse der Juden an der Geschichte früher völlig anders gelagert war als heute. Richtig verstehen wird man dieses Buch also, wenn man es unter anderem als einen Versuch der historischen Distanzgewinnung begreift.
Die Begriffe, deren ich mich bediene, bedürfen keiner besonderen Definition, da ihre Bedeutung sich aus dem jeweiligen Kontext ohne weiteres erschließt. Meine Auffassung von ›Geschichtsschreibung‹ habe ich in meinem obengenannten Aufsatz über »Clio and the Jews« ausführlich dargelegt; dort finden sich auch Belege für die Unsitte, den entscheidenden Unterschied zwischen historischen Schriften und allen möglichen anderen Genres der jüdischen Literatur zu verwischen, die an Geschichte zwar durchaus ein tiefes, am Aufzeichnen historischer Ereignisse aber nicht das geringste Interesse verraten. Das alles braucht hier nicht wiederholt zu werden.
Ich lege Wert auf die Feststellung, dass es mir weder um etwas irgendwie Vererbtes noch um eine den Jungschen Archetypen analoge angeborene psychische Struktur geht, wenn ich gelegentlich von »Kollektivgedächtnis« oder »Gruppengedächtnis« spreche. Die Theorie, die noch im 17. Jahrhundert zahllose Anhänger hatte, dass ein allein im Wald ausgesetztes Kind spontan Hebräisch zu sprechen beginne, stimmt für ein jüdisches enfant sauvage ebenso wenig wie die Vermutung, so ein Kind »erinnere« sich an Abrahams Zug von Ur nach Kanaan. Sprache und überpersönliche Erinnerung kann nur die Gruppe weitergeben. Vor über fünfzig Jahren hat sich Maurice Halbwachs bleibende Verdienste erworben, als er im Gegensatz zu Psychologen und Philosophen entschieden die Auffassung vertrat, selbst das Gedächtnis des Einzelnen sei durch gesellschaftliche Bedingungen strukturiert, wie ja auch ›Kollektivgedächtnis‹ nicht etwa eine Metapher sei, sondern eine durch Institutionen und bewusste Leistungen der Gruppe vermittelte und aufrechterhaltene gesellschaftliche Realität (vgl. Das Gedächtnis und seine sozialen Bedingungen, Frankfurt/Main 1985, und den posthumen Band Das kollektive Gedächtnis, Frankfurt/Main 1991). Den Begriff Kollektivgedächtnis verdanke ich diesen Werken, auch wenn ich das Wort nicht genau in dem Sinne wie Halbwachs verwende. Wo es allerdings darum ging, die Dynamik des jüdischen Kollektivgedächtnisses im Besonderen zu untersuchen, konnte ich mich kaum auf Vorarbeiten stützen. Die Kategorien, die man üblicherweise heranzieht, geben im Fall des Judentums meist nichts her. Erkenntnisse aus der Untersuchung mündlicher Überlieferung lassen sich z. B. auf ein dermaßen lesekundiges und extrem buchorientiertes Volk wie die Juden nur teilweise übertragen. Auch Vorstellungen vom Kollektivgedächtnis, die anhand der Folklore und Mythologie bäuerlicher oder primitiver Gesellschaften entwickelt wurden, führen nicht viel weiter, wenn man sich klarmacht, wie sehr Kultur und Gesellschaft bei den Juden vor der Neuzeit von Führungseliten geprägt wurden. Es ist wohl kein Zufall, dass Halbwachs selbst im ersten seiner obengenannten Bücher im Kapitel »Das Kollektivgedächtnis der religiösen Gruppen« ausschließlich vom Christentum spricht, während es in dem späteren Werk bei »Kollektives und historisches Gedächtnis« um das historische Gedächtnis einer Nation geht. Die Juden dagegen stellen seit Anbeginn ihrer Geschichte eine einzigartige Verschmelzung einer Religion und eines Volkes dar und sind mit nur einer dieser beiden Kategorien nicht zu begreifen. Die Geschichte des jüdischen Kollektivgedächtnisses gilt es erst noch zu erforschen. Ich zeichne lediglich hier und da die Richtung vor, die man dabei einschlagen könnte.
Als ich mich nach über einem Jahr wieder mit den Vorträgen befasste, um sie zur Veröffentlichung vorzubereiten, war ich mehr als einmal versucht, sie völlig umzuschreiben bzw. ganz beiseite zu legen und zu den gleichen Themen ein umfassendes, sehr viel umfangreicheres Werk zu verfassen. Doch letzten Endes tat ich nichts dergleichen. Ich entschloss mich, die ursprüngliche Form und damit auch den Tonfall der Vorträge beizubehalten. Bei dem wenigen, das ich doch überarbeitet habe, ging es fast nur um bessere Formulierungen. Für den Verlust an Ausführlichkeit und Differenziertheit entschädigt vielleicht der unmittelbarere Tonfall des gesprochenen Wortes. Allerdings habe ich trotz ursprünglicher Bedenken den Rat guter Freunde und Kollegen befolgt und jeden Vortrag mit ausführlichen Anmerkungen versehen. Manche Leser werden davon profitieren, und ich kann auf diesem Wege das eine oder andere, das im Vortrag selbst naturgemäß etwas pauschal dargestellt wurde, modifizieren und nuancieren.
Lasse ich das Ganze Revue passieren, so ist mir völlig klar, dass dieses Buch sein Thema nur in einer Reihe tastender Ansätze umkreist. Letzten Endes beruht die Position, die ich hier vertrete, auf der klaren Einsicht, dass es mehrere durchaus gangbare und in sich ehrliche, voneinander aber ganz verschiedene Wege gibt, wie Menschen die Wahrnehmung ihrer kollektiven Vergangenheit strukturieren. Die moderne Geschichtsschreibung ist dabei zwar die neueste, aber eben doch nur eine Methode, den anderen einerseits deutlich überlegen, andererseits auch nicht ohne Mängel, vielleicht sogar unterlegen – Gewinn und Verlust zugleich. Für mich ist demnach das Auftauchen der modernen jüdischen Geschichtswissenschaft im frühen 19. Jahrhundert nicht etwa ein absoluter Triumph des Fortschritts, sondern eine historische Tatsache, die ihrerseits historisch bedingt ist – ernst zu nehmen, aber kein Anlass zum Jubeln. Der Leser würde mich aber missverstehen, wenn er aus meinen Zweifeln und Bedenken gegenüber der modernen Geschichtswissenschaft schlösse, ich plädierte für eine Rückkehr zu früheren Denkweisen. Es ist nun einmal so, dass unsere Art, Zeit und Geschichte zu erleben, einmalig und noch nie dagewesen ist; es gilt, sie zu reflektieren, vielleicht auch, eine neue Richtung einzuschlagen. Zuversichtlich sind meine Schlussfolgerungen zwar nicht, aber wohl auch nicht ohne Hoffnung.
Yosef Hayim Yerushalmi Wellfleet, Cape Cod 30. Aw 5741/ 30. August 1981
Biblische und rabbinische Grundlagen
Der Sinn von Geschichte, Gedächtnis und Geschichtsschreibung
Denn frage doch an bei den vergangenen Tagen, die vor dir gewesen, von dem Tage an, da Gott einen Menschen geschaffen hat auf der Erde, und von einem Ende des Himmels bis an das andere Ende des Himmels, ob etwas, wie diese große Sache, sich begeben, oder ob dergleichen gehört worden.
Deuteronomium 4,32
R. Eleazar b. Azarja sprach: Ich bin bereits wie ein Siebzigjähriger, dennoch konnte ich (meine Ansicht) nicht durchsetzen, dass man den (Abschnitt vom) Auszug aus Miçrajim auch nachts lese; bis Ben Zoma kam und dies aus der Schrift deutete. Es heisst: (Deut. 16,3) damit du des Tages deines Auszuges aus Miçrajim alle Tage deines Lebens gedenkest; die Tage deines Lebens, das sind die Tage, alle Tage deines Lebens, das sind die Nächte. Die Weisen aber sagen: Die Tage deines Lebens, das ist diese Welt; alle Tage deines Lebens, dies schliesst die messianischen Tage ein.
Mischna Berakhoth 1,5
Der hebräische Imperativ Sachor – erinnere dich – kündigt mein schwer zu fassendes Thema an. Problematisch ist Erinnerung immer, oft trügt sie, manchmal betrügt sie uns. Proust wusste dies, und die »Suche nach der verlorenen Zeit« hat ihre düsteren, beklemmenden Seiten. In der Zauberwelt von Alain Resnais’ Film wird der Heldin bald klar, dass sie nicht sicher wissen kann, was sich »letztes Jahr in Marienbad« ereignete. Und jeder von uns merkt immer wieder einmal, wie unzuverlässig und kapriziös das menschliche Gedächtnis sein kann.
Und doch sieht es so aus, als sei in der hebräischen Bibel das Erinnern ohne Zögern einfach auferlegt. Die Aufforderung, sich zu erinnern, ergeht bedingungslos, und selbst wenn eine ausdrückliche Aufforderung nicht erfolgt, spielt das Erinnern stets eine Schlüsselrolle. Das Verb sachar (erinnern) in all seinen Formen kommt in der Bibel nicht weniger als 169 Mal vor. Angesprochen sind meistens entweder Israel oder Gott, denn Erinnerung obliegt beiden.1 Dem Verb ist sein Gegenteil zugeordnet – vergessen. Israel wird ermahnt zu gedenken, und zugleich wird dem Volk eingeschärft, nicht zu vergessen. Angesichts der ungeheuren Wirkung, welche diese beiden Gebote seit biblischen Zeiten bei den Juden entfaltet haben, möchte ich behaupten: Wer verstehen will, wie ein Volk überleben konnte, welches während des größten Teils seiner Existenz über die ganze Welt verstreut war, kann aus der bislang kaum erforschten und erst noch zu schreibenden Geschichte des Gedächtnisses dieses Volkes vermutlich Wichtiges lernen.
Was war es nun aber, dessen die Juden sich erinnern sollten, und wie sollten sie dabei vorgehen? Mittels welcher Dynamik hat die jüdische Erinnerung funktioniert? Worin besteht der Zusammenhang – wenn es ihn überhaupt gibt – zwischen Geschichtsschreibung und dem Gebot des Erinnerns? Geschichtsschreibung, das Aufzeichnen historischer Ereignisse, war nämlich keineswegs die gängigste Methode, das Kollektivgedächtnis des jüdischen Volkes anzusprechen und wachzurufen – eine scheinbare Ironie, die sich nicht nur bei den Juden findet. Jeder weiß, dass das Erinnerte nicht immer aufgezeichnet und das Aufgezeichnete – Historiker mögen das bedauern – nicht unbedingt erinnert wird.
Ich habe nicht vor, im Rahmen dieses schmalen Buches das Verhältnis zwischen jüdischem Gedächtnis und jüdischer Geschichtsschreibung in seiner ganzen Komplexität darzustellen. Es geht auch nicht um den Versuch einer Geschichte der jüdischen Historiografie, nicht um Geschichtsschreibung an sich, sondern um das Verhältnis der Juden zu ihrer eigenen Vergangenheit und um die Rolle, die der Historiker dabei spielt. Was ich zu sagen habe, hat auch einen ganz persönlichen Aspekt, denn es geht um Fragen nach dem Wesen meiner Wissenschaft, Fragen, die ich mir seit Langem stelle, ohne zu beanspruchen, für die Gesamtheit meiner Zunft zu sprechen. Ich hoffe allerdings, dass am Ende das Persönliche nicht einfach als willkürlich erscheint. Nun zu meiner letzten Vorbemerkung: Ich habe es zwar als Historiker der Juden in erster Linie mit der jüdischen Vergangenheit zu tun, glaube aber nicht, dass unsere Thematik nur für die jüdische Geschichte relevant ist. Aber immerhin ist es denkbar, dass die wesentlichen Fragen hier deutlicher hervortreten als anderswo. Und damit zur Sache.
Einem Menschen, der im modernen Westen aufgewachsen ist und den entsprechenden Bildungsweg durchlaufen hat, ist oft nur schwer begreiflich zu machen, dass Interesse an Geschichte – von Geschichtsschreibung ganz zu schweigen – keineswegs ein Wesensmerkmal aller menschlichen Kultur ist. Es hat schon immer Kulturen gegeben, und gibt sie auch heute noch, die der historischen und zeitlichen Dimension der menschlichen Existenz nichts abgewinnen konnten. Bei der Sichtung großer Mengen völkerkundlichen Materials aus der ganzen Welt haben Ethnologen und Religionswissenschaftler nach und nach geklärt, bis zu welchem Grad in primitiven Gesellschaften statt der historischen eine mythische Zeit als ›wirklich‹ empfunden wird, eine Zeit des Uranfangs und der paradigmatischen ersten Taten, die Traumzeit, als die Welt noch neu war, das Leiden unbekannt und die Menschen mit Göttern Umgang pflegten. In derartigen Kulturen ist der gegenwärtige Augenblick an sich wertlos; Sinn und Wirklichkeit gewinnt er erst, wenn er sich verwandelt, wenn durch die Wiederholung eines Rituals, das Zitieren oder Darstellen eines Mythos die historische Zeit in regelmäßigen Abständen aufgebrochen wird, sodass die Menschen, und sei es auch nur für kurze Zeit, die wahre Zeit des Ursprungs und der Archetypen wiedererleben.2 Mythos und Ritual entfalten solche Wirkungskraft keineswegs nur bei den sogenannten Primitiven. Mindestens seit der Antike findet sich dergleichen auch, samt der zugehörigen Mentalität, in den großen heidnischen Religionen. In der Metaphysik und Erkenntnistheorie einiger fernöstlicher Hochkulturen werden Zeit und Geschichte als illusorisch abgetan; Befreiung von derartigen Täuschungen gilt dort als Voraussetzung für wahres Wissen und endgültige Erlösung. Das alles ist in einer umfangreichen Literatur belegt, sodass ich mir hier jedes weitere Wort ersparen kann. Lassen Sie mich jedoch um der Anschaulichkeit willen ein schlagendes Beispiel aus Indien zitieren. Ein bekannter zeitgenössischer indischer Wissenschaftler schreibt:
»… Tatsache bleibt, dass mit Ausnahme von Kalhanas Rajatarangini, das lediglich eine Geschichte Kaschmirs bietet, die gesamte Sanskrit-Literatur keinen einzigen regelrecht oder auch nur annähernd historischen Text im eigentlichen Sinn des Wortes kennt. Diese Feststellung berührt umso seltsamer, als ansonsten kaum ein Wissensgebiet oder den Menschen interessierendes Thema in dieser Literatur fehlt. Das Fehlen echter historischer Literatur im Sanskrit ist dermaßen ungewöhnlich, dass sogar viele gebildete Inder diese offensichtliche Tatsache nicht wahrhaben wollen und allen Ernstes meinen, es habe viele solche historischen Texte gegeben, sie seien nur allesamt verloren gegangen.«3
Herodot gilt bekanntlich als ›Vater der Geschichtsschreibung‹ (eine Wendung, über die man diskutieren müsste, wozu allerdings hier nicht der Ort ist), und bis vor Kurzem wusste jeder Gebildete, dass die Griechen eine Reihe großer Historiker hervorgebracht haben, die man immer noch mit Genuss und Gewinn lesen kann. Doch weder diese Historiker selber noch die Kultur, der sie entstammten, sahen in der Geschichte insgesamt einen letzten oder transzendenten Sinn. Genau genommen entwickelten die Griechen nicht einmal eine Vorstellung von Universalgeschichte, von Geschichte als Gesamtzusammenhang. Herodot wurde beim Schreiben von etwas sehr Menschlichem inspiriert, die Absicht nämlich, wie er selber sagt, »damit die von Menschen vollbrachten Taten nicht mit der Zeit in Vergessenheit geraten und die großen und bewundernswerten Leistungen, die einerseits von den Griechen, andererseits von den Barbaren erbracht wurden, nicht ohne Nachruhm bleiben«. Für Herodot hieß Geschichte schreiben zunächst und vor allem ein Bollwerk errichten gegen das unaufhaltsame, durch das Verstreichen der Zeit bewirkte Verblassen der Erinnerung. Im Allgemeinen war Geschichtsschreibung bei den Griechen entweder ein Ausdruck der fabelhaften hellenischen Wissbegier, des Erkundungsdranges, der sie uns immer noch verwandt erscheinen lässt, oder sie war ein Mittel, um der Vergangenheit moralische Beispiele oder politische Einsichten abzugewinnen. Weitere Wahrheiten hatte die Geschichte nicht zu bieten, und daher spielte sie in der Religion und Philosophie der Griechen auch keine Rolle. War Herodot der Vater der Geschichtsschreibung, so waren die Juden die Väter des Sinns in der Geschichte.4
Im alten Israel maß man der Geschichte zum ersten Mal eine entscheidende Bedeutung bei; dadurch entstand eine neue Weltanschauung, deren entscheidende Prämissen später vom Christentum und dann auch vom Islam übernommen wurden. Mit den Worten des Psalmisten mochten zwar immer noch »die Himmel die Herrlichkeit Gottes erzählen«, doch sein Wille offenbarte sich jetzt in der Geschichte des Menschen. Diese neue Betrachtungsweise war nicht etwa eine Folge philosophischer Spekulationen, sondern ergab sich aus den Wesensmerkmalen des israelitischen Glaubens. Sie entstand aus einem intuitiven, revolutionären Gottesverständnis und wurde aufgrund tiefempfundener historischer Erfahrungen weiterentwickelt. Im Rückblick sind die Folgen dieser neuen Weltanschauung unübersehbar. Die entscheidende Begegnung zwischen Mensch und Göttlichem verlagerte sich plötzlich vom Reich der Natur und des Kosmos auf die Ebene der Geschichte; und damit ging es nun um die menschliche Reaktion auf göttliche Herausforderung. An die Stelle des heidnischen Kampfes der Götter untereinander oder gegen die Mächte des Chaos trat ein anderer, dramatischerer Konflikt – nämlich der paradoxe Kampf zwischen dem göttlichen Willen eines allmächtigen Schöpfers und dem freien Willen seines Geschöpfs, des Menschen, ausgetragen auf dem Feld der Geschichte, in angespannter Dialektik von Gehorsam und Rebellion. Die in der Bibel nur in der Paradieserzählung der Genesis dargestellte uranfängliche Traumzeit-Welt der Archetypen war damit unwiederbringlich dahin.5 Wenn Adam und Eva den Garten Eden verlassen, beginnt die Geschichte, wird die historische Zeit real und ist der Rückweg auf ewig versperrt. Vor dem Garten Eden macht »die Flamme des Schwertes, des kreisenden«, den Wiedereintritt unmöglich. Nach hebräischer Vorstellung lernt der gegen seinen Willen in die Geschichte geworfene Mensch seine historische Existenz trotz des Leids, das sie mit sich bringt, allmählich bejahen und entdeckt auf diesem mühsamen Wege auch, dass Gott sich im Lauf der Geschichte offenbart. Rituale und Feste sind im alten Israel in erster Linie schon nicht mehr die Wiederholung mythischer Archetypen, die die historische Zeit aufheben sollen. Sofern dabei die Vergangenheit evoziert wird, handelt es sich nicht um die vorgeschichtliche Vergangenheit, sondern um die geschichtliche Zeit, in der sich die entscheidenden großen Augenblicke der Geschichte Israels erfüllten. Die biblische Religion sucht sich keineswegs aus der Geschichte davonzustehlen, im Gegenteil: Sie ist von Geschichte durchdrungen und ohne sie undenkbar.
Die beherrschende Rolle der Geschichte im alten Israel lässt sich durch nichts dramatischer beweisen als durch die Tatsache, dass die Menschen selbst Gott nur kennen, insofern er sich ›historisch‹ offenbart. Wenn Moses ausgeschickt wird, den geknechteten Hebräern die Botschaft von der Befreiung zu bringen, kommt er nicht im Namen des Schöpfers von Himmel und Erde, sondern des »Gottes der Väter«, also des Gottes der Geschichte: »Der Ewige, der Gott euerer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Jizchaks und Jaakobs, mit den Worten: Wahrgenommen hab’ ich euch und das an euch Verübte in Mizrajim« (Exod. 3,16). Wenn Gott sich am Sinai dem ganzen Volk zu erkennen gibt, ist nicht von seinem Wesen oder seinen Eigenschaften die Rede, sondern es heißt: »Ich bin der Ewige, dein Gott, der ich dich geführt aus dem Lande Mizrajim, aus dem Knechthause.« (Exod. 20,2) Das genügt, denn hier wie auch sonst kennt das alte Israel Gott aufgrund seiner Taten in der Geschichte.6 Deshalb ist für Israels Glauben, ja für seine Existenz überhaupt, die Erinnerung von entscheidender Bedeutung.
Nur in Israel, nirgends sonst, empfindet ein ganzes Volk die Aufforderung, sich zu erinnern, als religiösen Imperativ. Wirkung zeigt diese Anordnung allenthalben, besonders stark im Fünften Buch Mose und bei den Propheten: »Gedenke der Tage der Urzeit, erwäget die Jahre vergangener Geschlechter« (Deut. 32,7). »Bedenke dies, Jaakob und Jisrael, denn du bist mein Knecht, gebildet hab’ ich dich mir zum Knechte, du bist es, Jisrael, du wirst von mir nicht vergessen.« (Jes. 44,21) »Gedenke, was dir Amalek getan« (Deut. 25,17) »Mein Volk, bedenke doch, was Balak Moabs König, beschlossen« (Mi. 6,5). Und immer wieder wird dem Volk eingehämmert: »Gedenke, dass du ein Knecht warst in Ägypten …«
Der Befehl, sich zu erinnern, gilt zwar absolut, doch die Sorge um die Erinnerung mutet manchmal fast verzweifelt an; auch die Bibel weiß nur zu gut, wie wenig Verlass ist auf das Gedächtnis der Menschen. Nicht Geschichte, wie häufig angenommen wird, wiederholt sich, sondern die mythische Zeit. Wenn Geschichte wirklich ist, kann das Rote Meer nur einmal durchquert werden, kann Israel nicht zweimal am Sinai stehen – man mag hierin ein hebräisches Pendant zur Weisheit des Heraklit sehen.7 Ewig dauern soll aber der Bund: »Und nicht mit euch allein schließe ich diesen Bund und diesen Vereidigungsfluch;
Sondern so mit dem, der heut hier mit uns ist, stehend vor dem Ewigen, unserm Gotte, als mit dem, der heut hier nicht mit uns ist.« (Deut. 29,13–14) – ein unerhörter Anspruch. Und nach dem Gang durch den Jordan kommt der Befehl, »Steine zum Andenken« aus dem Flussbett zu holen: »wenn eure Söhne künftig fragen und sprechen: Was sollen euch diese Steine?
Und ihr sprecht zu ihnen: daß sich getrennt die Wasser der Jarden vor der Bundeslade des Ewigen; als sie durch den Jarden zog, trennten sich die Wasser des Jarden, und es sollen Steine zum Andenken sein den Kindern Jisrael auf ewig« (Jos. 4,6–7) Wird die an den Stein gebundene Erinnerung für spätere Generationen wieder heraufbeschworen und lebendig, so ist dabei nicht der Stein entscheidend, sondern die von den Vätern überlieferte Erinnerung. Wenn es keine Rückkehr zum Sinai geben kann, müssen die dortigen Ereignisse auf den Bahnen der Erinnerung zu denen gelangen, die an diesem Tage nicht dabei waren.
Die biblische Aufforderung zur Erinnerung hat also mit Neugier auf die Vergangenheit wenig zu tun. Israel wird aufgefordert, ein Reich der Priester und ein heiliges Volk zu werden; von einem Volk von Historikern ist nicht die Rede. Die Forderung, dass Israel sich erinnere, trägt der selektiven Natur des Gedächtnisses durchaus Rechnung. Wir mögen Gefallen finden an Rankes Wort, jede Epoche sei unmittelbar zu Gott, doch dem biblischen Denken ist diese Vorstellung fremd. Dass die Geschichte Bedeutung hat, heißt dort nicht, dass alle Ereignisse der Geschichte bedeutsam und der Erinnerung wert sind. Von Manasse vom Stamme Juda, einem mächtigen König, der in Jerusalem 55 Jahre herrschte, hören wir nur: »Und er tat, was böse ist in den Augen des Ewigen« (2. Kön. 21,2). Und nur von diesen Missetaten erfahren wir Näheres. Israel – keineswegs verpflichtet, sich der gesamten Vergangenheit zu erinnern – verfügt über ein ganz besonderes Auswahlprinzip: Vor allem gilt es, der göttlichen Eingriffe in die Geschichte samt der positiven bzw. negativen Reaktionen der Menschen zu gedenken. Ausgelöst wird das Erinnern auch nicht wie üblich durch das lobenswerte Bedürfnis, die Heldentaten eines Volkes vor dem Vergessen zu bewahren; eine Reihe von biblischen Erzählungen scheinen vielmehr geradezu darauf angelegt, dem Nationalstolz eins auszuwischen. Die große Gefahr ist nämlich weniger, dass ein Ereignis an sich vergessen wird, als dass vergessen wird, wie es sich ereignete. »Und es wird geschehen, wenn dich bringen wird der Ewige dein Gott in das Land, das er geschworen deinen Vätern, Abraham, Jizchak und Jaakob, dir zu geben, – große und schöne Städte, die du nicht gebauet,
Und Häuser, voll alles Gutes, die du nicht gefüllt, und gehauene Brunnen, die du nicht ausgehauen, Weinberge und Ölbäume, die du nicht gepflanzt, und du wirst essen und satt werden;
Hüte dich, daß du nicht vergessest den Weigen,
der dich herausgeführt aus dem Lande Mizrajim,
aus dem Hause der Knechte.« (Deut. 6,10–12; vgl. 8,11–18)
Ritual und Rezitation waren die Hauptbahnen der Erinnerung. Pessach und Laubhüttenfest, die großen Pilgerfeste, behielten zwar ihren natürlich-organischen Bezug zum Erntejahr (Frühling und erste Früchte), wurden aber gleichzeitig zu Gedenkfeiern für den Auszug aus Ägypten und den Aufenthalt in der Wüste. (Auf ähnliche Weise sollte das biblische Wochenfest Schawuot in der Zeit des Zweiten Tempels zur Gedenkfeier für die Verkündigung der Gesetze am Sinai werden.) Vor und manchmal neben der Prosa der Chronisten gab es mündlich überlieferte Dichtung. Für den hebräischen Leser besitzen Texte aus dieser Überlieferung wie Mose Lobgesang (Exod. 15,1–18) oder das Lied der Deborah (Ri. 5) heute noch dank ihrer archaischen Rhythmen und Bilder eine auffällige Macht, eine Ahnung ferner und doch seltsam bewegender Urereignisse heraufzubeschwören, deren Einzelheiten wohl unrettbar verloren sind.
Ein Paradebeispiel für das Wechselspiel von Ritual und Rezitation bietet das Zeremoniell der ersten Früchte im Fünften Buch Mose, Kapitel 26. Die folgende Vorschrift gilt für jeden Israeliten bei der Opferung dieser Früchte im Heiligtum:
»Du sollst anheben und sprechen vor dem Ewigen deinem Gotte: Ein herumirrender Arammi war mein Vater und er ging hinab nach Mizrajim und weilte daselbst mit einem geringen Häuflein, und ward daselbst zu einem Volke, groß, mächtig und zahlreich.
Und es mißhandelten uns die Mizrim und drückten uns und legten uns schwere Lastarbeit auf.
Und
wir schrien zu dem Ewigen, dem Gotte unsrer Väter, und es hörte der Ewige unsere Stimme und sah unser Elend und unser Mühsal und unsern Druck.
Und der Ewige führte uns aus Mizrajim mit starker Hand und ausgestrecktem Arme, und mit großem Schrecken und mit Zeichen und Wundern,
Und brachte uns an diesen Ort, und gab uns dieses Land, ein Land, fließend von Milch und Honig.« (Deut. 26,5–9)8





























