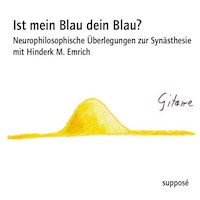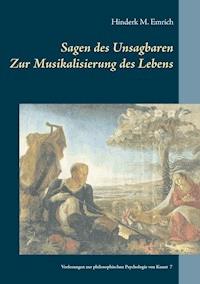
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Vorlesungen zur philosophischen Psychologie von Kunst
- Sprache: Deutsch
Über eine gedankliche und sprachliche Erfassung von Unsagbarem in unserem Leben sprechen zu wollen, bedeutet eine enorme Herausforderung, Selbstkritik und Erweiterung des Rationalismus, der hermeneutischen Erfassung von Sprachwelten und der Selbstinterpretation des Menschen im Hinblick auf die Tiefenstrukturen des eigenen Daseins. Daran auch nur zu rühren, ist bereits ein Wagnis, ein Abenteuer. Das vorliegende Buch stellt eine Zusammenfassung von Versuchen dar, sich diesem Thema von philosophischen, neurobiologischen und künstlerischen Perspektiven aus zu nähern und es in diesem Sinne zu „umkreisen“. Dabei zeigt sich, dass gerade philosophisch orientierte bzw. philosophisch relevante Dichtung wie beispielsweise die „Pindariker“, ausgehend von Pindar über Hölderlin hin zu Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke (in gewissem Sinne auch Franz Kafka und Imre Kertesz) und Ingeborg Bachmann in dieser Richtung umfassend-Großes geleistet haben und dass andererseits Musikphilosophie, wie sie beispielsweise von Arthur Schopenhauer protagonistisch dargestellt worden ist, in der Lage ist, das schwer fassbare Thema des „Unsagbaren“ zu beschreiben. Der vorliegende Band ist eine Synopsis von Vorträgen und Manuskripten zu diesem faszinierenden Bereich unseres Lebens mit dem Ziel, durch eigene Selbstreflexion und Weiterentwicklung dieser Gedanken diesen Daseinsbereich stärker in unser Bewusstsein zu integrieren und zwar in einer Weise, die mit den Thesen philosophischer Psychologie und analytischer Psychologie (C. G. Jung) verwandt ist.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Musikalisierung des Lebens und Synästhesie
Musikalisierung des Lebens und Eroberung von Gegenwart in der Improvisation
Zum sich Aussprechen bei Hugo von Hofmannsthal
Zur Philosophie des Unsagbaren bei Ingeborg Bachmann und Imre Kertesz
Unsagbarkeit des Schönen – Musik und das Unsagbare –
Psychiatrie im Film: Das Unsagbare und die Musikalisierung des Lebens in Sergej Paradjanovs Film Die Farbe der Granatäpfel“
Musik als Sprache des Unsagbaren
Welche Sprache spricht Musik?
Über Musik als das Sagen des Unsagbaren
Unsagbarkeit und Trauma – zum „Todesarten“-Projekt von Ingeborg Bachmann
Nachklänge zum Seminar „Das Unsagbare bei Ingeborg Bachmann, Hugo von Hofmannsthal, Franz Kafka und Rainer Maria Rilke“
Synthesis –Atmosphäre – Schönheit
Präambel
Irgendwo in einem der möglichen und unmöglichen Universen gibt es einen Felsen. Darauf steht geschrieben in allen denkbaren und unsagbaren Sprachen und Nichtsprachen: „WAHRHEIT DES SEINS“. Manche Wesen der vielen Sphären des Seins und des Nichtseins gelingt es tatsächlich durch Phantasie, Leichtsinn – und Ärger über das Leben – in die Nähe des Felsen zu gelangen. Selten ist das wirklich so. Aber die Täuschungen aus Sehnsucht sind auch Wirklichkeiten – und so klopfen die Philosophen und die Dichter – vor allem aber die Musiker mit ihren Taktstöcken und Geigenbögen – jedoch und gottseidank am innigsten die mit den Klängen ihres Gesanges herankommenden Wesen – an diesen möglichen und unfassbaren Solitär an. Und manchmal gelingt es einigen von ihnen wie aus unbestimmbarer Nähe und zugleich Ferne her eine Resonanz zu spüren oder auch sogar zu hören. Und das ist dann der Sinn des Lebens und ein Gottesbeweis.
Vorwort
Über eine gedankliche und sprachliche Erfassung von Unsagbarem in unserem Leben sprechen zu wollen, bedeutet eine enorme Herausforderung, Selbstkritik und Erweiterung des Rationalismus, der hermeneutischen Erfassung von Sprachwelten und der Selbstinterpretation des Menschen im Hinblick auf die Tiefenstrukturen des eigenen Daseins. Daran auch nur zu rühren, ist bereits ein Wagnis, ein Abenteuer.
Das vorliegende Buch stellt eine Zusammenfassung von Versuchen dar, sich diesem Thema von philosophischen, neurobiologischen und künstlerischen Perspektiven aus zu nähern und es in diesem Sinne zu „umkreisen“. Dabei zeigt sich, dass gerade philosophisch orientierte bzw. philosophisch relevante Dichtung wie beispielsweise die der „Pindariker“, ausgehend von Pindar über Hölderlin hin zu Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke (in gewissem Sinne auch Franz Kafka und Imre Kertesz) und Ingeborg Bachmann, in dieser Richtung umfassend-Großes geleistet haben und dass andererseits Musikphilosophie, wie sie beispielsweise von Arthur Schopenhauer protagonistisch dargestellt worden ist, in der Lage ist, das schwer fassbare Thema des „Unsagbaren“ immerhin zu „beschreiben“.
Der vorliegende Band ist eine Synopsis von Vorträgen und Manuskripten zu diesem faszinierenden Bereich unseres Lebens mit dem Ziel, durch eigene Selbstreflexion und Weiterentwicklung derartiger Gedanken diesen Daseinsbereich stärker in unser Bewusstsein zu integrieren und zwar in einer Weise, die mit den Thesen philosophischer Psychologie und analytischer Psychologie (C. G. Jung) verwandt ist.
Der expressionistische Dichter Arno Holz lässt in seinem Drama „Sonnenfinsternis“ seinen Protagonisten, den Maler Hollrieder, sagen, es sei „das, was Kunst zu Kunst erst macht – Das . . . Un sagbare, das . . . Un nennbare, das Unbe greifbare . . . das aus jedem Windhauch weht, das . . . zarte, entzückend . . . rätselhafte . . . immer wieder schillernd wechselnd . . . lebendige . . . Zittern der Seele, das . . . zu tiefst in uns allen Schwingende, das . . . vom höchsten Genie . . . noch kaum erst Geahnte, das Hinter-allen-Dingen . . . so bitter wir auch darum ringen, so schmerzvoll blutend wir uns auch mühen, so grausam elend wir uns auch . . . Tag um Tag, Stunde um Stunde, Sekunde um Sekunde . . . abplacken, abrackern und abmarachen . . . weil sich das Aller-Allerletzte . . . und Aller-Aller-Allereigentlichste . . . von uns aus . . . nicht mehr erreichen läßt?“ Der Germanist Wilhelm Emrich, mein Vater, sagt dazu (in: Arno Holz – sein dichterisches Experiment): „Diese Verzweiflung über die Unmöglichkeit, jemals die volle Wahrheit eines Gegenstandes künstlerisch zu erreichen, hielt den Dichter Arno Holz dennoch nicht davon ab, an einen unendlichen, wenn auch unabschließbaren Entwicklungsprozeß der Kunst zu glauben und selber diesen Prozeß unermüdlich voranzutreiben, in der Hoffnung, wenigstens möglichst nahe an eine künstlerisch wahrhaftige Gestaltung zu gelangen.“
Sommer 2015
Hinderk Emrich
1. Musikalisierung des Lebens und Synästhesie
Sonntagsmatinee Münchner Volkshochschule „Blackbox“, Sonntag den 20.10.02
1.0 Einleitung
Musikalisierung des Lebens: das ist ein absichtlich (wie sollte man sonst erwachen?) ungewöhnlicher, ein eigentümlicher Vortragstitel: „Musikalisierung des Lebens“. Was könnte das bedeuten? Ist denn nicht ohnehin unser ganzes Leben ständig musikalisiert? Man kann nicht mehr telefonieren, ohne Musik aufgezwungen zu bekommen, keine Taxifahrt, kein Flughafen, kein Lift und kein Restaurant, keine Bar und kein Kaufhaus ohne Musik – und zwar eine Musik absoluter Beliebigkeit. Was soll da noch musikalisiert werden?
Forscher und Wissenschaftler sind Wesen, die irgendwann in ihrem Leben nicht nur forschen wollen und Tatsachen aufdecken, Theorien erfinden wollen sondern auch Impulse geben, Impulse geben in eine bestimmte Richtung für unser Leben; und in diesem Sinne meine ich, als Wissenschaftler, mit Musikalisierung des Lebens genau das Gegenteil von dem, was ich oben als grausigen Tatbestand der Überflutung mit akustischem Müll dargestellt habe. Musikalisierung kann auch und vor allem Stille bedeuten, die „Pause“ bedeuten, das Einzigartige und Besondere, das Nicht-Beliebige.
Wir befinden uns hier auf den Münchner Wissenschaftstagen; und insofern würde es auch Sinn machen, den Titel meines Vortrages zu reformulieren: „Wissenschaft und Musikalisierung des Lebens“. Was verstehe ich darunter? Wissenschaft ist ein Bereich unseres Lebens, der versucht, Unerklärtes zu erklären. Letztlich kommt die Wissenschaft aus der Sehnsucht des Menschen nach Absicherung zustande, nach sicheren Prognosen. Wie kann ich mein Leben so gestalten, dass ich nicht ständig von Schrecklichem überrascht werde, wie dies im Menschen- und Tierreich nur allzu sehr der Fall ist? Wie kann ich zu sicheren Prognosen kommen? Insofern ist Wissenschaft ein Bereich unserer Kultur, der darauf abzielt, kognitive Modelle der Wirklichkeit zu erzeugen, welche beinhalten, dass Menschen nicht ständig von Naturgewalten und anderen Gewalten „überrascht“ werden. Dies aber bedeutet, dass Wissenschaft „reduktiv“ vorgehen muss: sie reduziert Komplexes auf Einfacheres und Einfacheres auf noch Fundamentaleres. Reduktionismus ist eine „Erklärungsform, die mit dem Phänomen des „Eigentlichen“ zu tun hat. Eigentlich ist „Musik nichts anderes als eine Zusammenfügung von Schallwellen“. Eigentlich ist Materie nichts anderes als eine Zusammenballung von Atomen, die wiederum eigentlich nichts anderes sind als elektromagnetische Wellen, also gibt es eigentlich Materie gar nicht.“ Dieses Modell der Welt bedeutet, dass wir letztlich alles in Theorien, in Kognitionen übersetzen können. Wir können Verhalten in Verhaltensbiologie und damit letztlich in darwinistische Mechanismen uminterpretieren. Ich erinnere mich an einen schönen amerikanischen Film, ich glaube es war „Frühstück bei Tiffany“, wo ein verliebter junger Unternehmer zur Protagonistin sagt: „Eigentlich gibt es gar keine Liebe, sondern nur Chemie“ – eine besondere Art von Kompliment.
Dieser Vortrag handelt von der Frage nach der Übersetzbarkeit von Phänomenen des Lebens in andere Phänomene. Ist es wirklich richtig, dass alles was ist, in Abstraktionen übersetzbar ist? Ist es nicht in Wirklichkeit genau umgekehrt, dass nämlich nichts in irgendetwas anderes übersetzt werden kann? So sagt der englische Philosoph Joseph Butler „Everything is what it is and not an other thing”, “Alles ist was es ist und nicht etwas anderes“. Dies würde bedeuten: es ist nicht richtig, dass man alles, was in unserem Leben etwas bedeutet, in etwas anderes, einfacheres uminterpretieren und daraus erklären kann. In diesem Sinne wäre der Reduktionismus der Wissenschaft ein scheiterndes Projekt. Die große Dichterin Ingeborg Bachmann spricht von dem „Unsagbaren“. Der Filmemacher Andre Tarkowskij spricht in seinem Film „Nostalghia“ davon, dass man russische Lyrik nicht in eine andere Sprache übersetzen könne.
Das von mir initiierte Projekt der „Musikalisierung des Lebens“ hat genau mit dieser Frage zu tun: gibt es nicht in uns etwas, was letztlich nur durch die Unübersetzbarkeit – z.B. von Musik – metaphorisiert werden kann? Musik ist in merkwürdiger Weise eine geistig-seelische Eigenwelt, die nicht durch eine andere geistig-seelische Welt noch einmal dargestellt werden kann. Die Besonderheit eines Klanges lässt sich nicht dadurch ausdrücken, dass ich ihn versprachliche, verräumliche, verbildliche, etc.
Ingeborg Bachmann war nicht nur Lyrikerin und Dichterin; sie war auch eine große Philosophin und sie hat in vielen Texten immer wieder auf ungelöste Fragen der Philosophie hingewiesen. In diesem Sinne denke ich, dass das, was sie über Musik sagt, einen philosophisch bedeutungsvollen Hintergrund hat. Da führt sie aus: „„Was aber ist Musik? Was ist dieser Klang, der dir Heimweh macht? Wie kommt´s, dass du in deinen Todesstunden wieder nach der Nachtigall rufst und dein Fieber wild aus der Kurve springt, damit du sie noch einmal im Baume sehen kannst, auf dem einzigen hellen Zweig in der Finsternis? Und die Nachtigall sagt: „Tränen haben deine Augen vergossen, als ich das erste Mal sang!“ So dankt sie dir noch, der du zu danken hast, denn sie vergißt es dir nie.“
„Du vernimmst ihr herrliches Wort und trägst ihr dein Herz an dafür. Sie legt es auf ihre Zunge, taucht es ins Naß und schickt es durch das dunkle Tor dem, der es öffnet, entgegen.
Was aber ist diese Musik, die dich freundlich und stark macht an allen Tagen? Wie kommt s, dass du wieder gerne ißt und trinkst wegen ihr und deinen Nächsten zum Freund gewinnst? Und was ist diese Musik, die dich zittern macht und dir den Atem nimmt, als wüßtest du deine Geliebte vor der Tür stehen und hörtest den Schlüssel schon sich drehen?
Was ist sie, über der dein Geist zusammensinkt, ausgebrannt und verascht nach so vielen Feuern, die an ihn gelegt wurden? Was ist dieses Entzücken und dieses Erschrecken, das ihm noch einmal bereitet wird? Der Vorhang brennt, geht auf vor der Stille, und eine menschliche Stimme ertönt: O Freude!
Was ist dieser Akkord, mit dem die wunderliche Musik Ernst macht und dich in die tragische Welt führt, und was ist seine Auflösung, mit der sie dich zurückholt in die Welt heiterer Genüsse? Was ist diese Kadenz, die ins Freie führt?!
Wovon glänzt dein Wesen, wenn die Musik zu Ende geht, und warum rührst du dich nicht? Was hat dich so gebeugt und was hat dich so erhoben?“
Was hier ausgedrückt wird, ist die Radikalität dessen, was es heißt, Subjekt zu sein, in der Innenwelt zu sein. In dem zu sein, was Ingeborg Bachmann das „Innen“ nennt. (Sie sagt an einer Stelle in dem Roman „Franza“: „Denn es ist das Innen, in dem sich alle Tragödien abspielen.“) Diese Radikalität von Subjektivität wurde kürzlich in einer von mir betreuten sog. „Zeitoper“ mit dem Titel „Hirnströme“ der Staatsoper Hannover deutlich gemacht. Hier wird ein Patient dargestellt, ein Musiker, der plötzlich durch einen Hirnprozess seine Kompetenz, Musik zu erleben, verloren hat: er hat eine „musikalische Agnosie“. Er sagt: „Ich habe meine Musik verloren“. Die Geschichte beruht auf einer Patientin von mir, die berichtet, dass sie seit einer Aneurysma-Operation im Gehirn Musik lediglich als unangenehmes Geräusch erlebt, „überdimensional laut und furchtbar“.
Das Spannungsfeld, in dem sich die Zeitoper „Gehirnströme“ bewegt, ist der Reduktionismus, der sagt, Musik ist nichts anderes als eine besondere Form von Nervenzellerregung im Gehirn und der Gegenthese, die zum Schluss der Oper deutlich gemacht wird, dass Musikalität eine seelische Dimension im Menschen beinhaltet, die über die quasi „Hirnströme“ hinauswachsen kann. Abb. 1 zeigt ein Standfoto aus der Zeitoper „Gehirnströme“ von Burkhard Niggemeier und Susanne Chrudina.
Abb. 1: „Gehirnströme (Still)
2.0 Aisthesis und Synaisthesis – Wahrnehmung und Synästhesie
Wie kommt es, dass Menschen überhaupt etwas wahrnehmen können? Ist Wahrnehmung nichts anderes als Auswertung von Sinnesdaten oder gehört hier noch etwas mehr hinzu? Hierzu hat Immanuel Kant ein Konzept vorgetragen, das mit dem Phänomen des „apriori“ zu tun hat. Vor aller Erfahrung gibt es so etwas wie „Wirklichkeitshypothesen“, vorgängige Kategorien in uns, von denen aus Wirklichkeit quasi „geordnet“ werden kann. Sie sehen das in den ersten beiden Dias hinsichtlich des Unterschiedes zwischen dem „naiven Realismus“ und der konstruktivistischen Theorie der vorgängigen Wirklichkeitshypothesen, wie sie beispielsweise auch von dem Psychologen Wolfgang Prinz, München, vertreten wird. „Aisthesis“, Wahrnehmung, beruht also auf der Wechselwirkung zwischen Wirklichkeitshypothesen einerseits und Sinnesdatenlagen, die von der Außenwirklichkeit in das Innen von Subjekten transportiert werden, andererseits. Es gibt einige Wahrnehmungsillusionen, anhand derer man die Diskrepanz zwischen Sinnesdatenlagen einerseits und Wirklichkeitshypothesen andererseits gut sehen kann.
Abb. 2: Darstellung eines Kusses, der nie zum Vollzug gelangen kann.
Abb. 3: Neckerscher Doppelwürfel, der in einer Vielzahl von Varianten wahrgenommen werden kann. (aus H.M. Emrich, Psychiatrische Anthropologie, München 1990)
Wenn auf diese Weise relativ klar ist, worum es sich bei der „Aisthesis“ handelt, dann stellt sich die Frage nach der „Synaisthesis“, der Synästhesie. Was ist hierunter zu verstehen?
Synästhesie ist eine für alle Menschen, die erstmals damit konfrontiert werden, frappierende, ungewöhnliche und beeindruckende Erscheinung der Vermischung von Sinnesqualitäten; beeindruckend deshalb, weil - in ähnlicher Weise wie bei der Wahrnehmung von Illusionen - man sich hierbei des eigenweltlichen, subjektiven Charakters der Wahrnehmung, in gewissem Sinne sogar des hermetischen Charakters von subjektiver Wahrnehmung deutlich bewusst wird. Synästhesie wird auch als „Vermischung der Sinne“ bezeichnet. Darunter versteht man, dass bei Stimulation einer Sinnesqualität beispielsweise des Hörens oder des Riechens es in einer anderen Sinnesqualität wie z.B. dem Sehen von Farben oder von geometrischen Figuren zu einer Sinneswahrnehmung kommt. Am häufigsten ist dabei das sogenannte farbige Hören - auch als Farbenhören, als „Audition coloreé“, „coloured hearing“ bezeichnet - wobei typischerweise Geräusche, Musik, Stimmen und ausgesprochene Buchstaben und Zahlen zur Wahrnehmung bewegter Farben und Formen führen, die in die Außenwelt bzw. auch in das Kopfinnere projiziert werden. Auf einem „inneren Monitor“, der allerdings keine räumliche Begrenzung aufweist, erscheinen dann häufig vorbeilaufende farbige Strukturen, Kugeln bzw. langgestreckte vorüberziehende 3-dimensionale Gebilde mit charakteristischen Oberflächen, beispielsweise samtigen, glitzernden oder auch gläsernen bzw. metallischen Oberflächen, deren Charakter bei den sog. „genuinen Synästhetikern“ in einem direkten korrelativen Verhältnis zu den akustisch wahrgenommenen Sinneseindrücken steht.
Abb. 4: Synästhetische visuelle Wahrnehmung des Wortes „Süß“. Aquarell von Insa Schulz
Berühmt geworden ist ein Proband des amerikanischen Neuropsychologen Cytowic, der anlässlich einer Party dadurch auffiel, dass er einen geschmacklichen Sinneseindruck in geometrischen Strukturen beschrieb. Die Nachfrage des interessiert aufhorchenden Neuropsychologen ergab, dass dieser Proband eine sehr differenzierte geometrische Geschmacks/Geruchs-Synästhesie aufwies. Er konnte reproduzierbar sehr präzise geometrische Figuren beschreiben, die bestimmte Geschmacksstoffe wie Hähnchengeschmack, und andere komplexe Geschmacks-Geruchs- Kombinationen darstellten. Besonders selten sind Probanden, bei denen Gerüche als Farben wahrgenommen werden oder Wörter zu Geschmacksempfindungen führen. Zweifellos am häufigsten ist die Ton-Farbe-Synästhesie, wobei aber auch das gelesene oder sogar das nur gedachte Wort bzw. der Buchstabe oder die Zahl, das damit quasi fest verbundene synästhetische Farberlebnis bzw. das Erlebnis geformter Farbe auslöst. Charakteristisch hierbei ist in der Biographie der Synästhetiker ein frühes Erlebnis von so etwas wie „Einsamkeit“, nämlich die Entdeckung, dass es eine private Wahrnehmungswelt gibt, die andere Menschen nicht haben, andere Menschen nicht kennen und über die man sich nicht verständigen kann, ja über die man am besten nicht spricht, sie geheim hält.
Eine Probandin berichtet: „Es ist eigentlich so, dass ich früher mal davon ausgegangen bin, dass das jeder hat. Und als ich das irgendwann mal gesagt habe, ja, das ist ja klar, das Wort mag ich nicht, weil das hat die und die Farbe und die Farbe mag ich nicht und dann hat meine Freundin erst mal losgelacht und dann machten sie sich eigentlich mehr oder weniger einen Witz daraus und dann sollte ich alle Namen sagen, welche Farben dann die Namen haben und so, also es wissen sehr viele ...“.
Synästhesie hat offensichtlich einen konstitutionellen Hintergrund, denn einerseits ist das Geschlechterverhältnis etwa 7:1 zugunsten der Frauen, zum anderen gibt es familiäre Häufungen von bis zu 3 Synästhesieprobanden in einer Familie über 3 Generationen hinweg, weshalb vermutet wird, dass es sich um einen X-Geschlechtschromosomen-bezogenen Erbgang bei der Auslösung des Phänomens handeln könnte.
Bei der Untersuchung einer großen Anzahl von Synästhetikern - vorwiegend Synästhetikerinnen - die sich aufgrund von Presseberichten zu Untersuchungen gemeldet hatten, stellte meine Arbeitsgruppe in Hannover nun fest, dass es offenbar eine Randgruppe von Probanden gibt, die nicht das charakteristische feste Verhältnis zwischen Farbwahrnehmungen bzw. geformten Farbwahrnehmungen und dem semantischen Gehalt des Gehörten, bzw. auch Gelesenen, aufwiesen, sondern bei denen vielmehr ein lockeres, eher assoziatives Verhältnis zwischen den inneren Bildern und musikalischen und anderen akustischen Erlebnissen vorhanden war. Während diese Probanden üblicherweise von der weiteren Untersuchung ausgeschlossen werden, wurden sie hier als eine Art zweite Kontrollgruppe bzw. Referenzgruppe mit untersucht. Dabei zeigte dann aber gerade die Gruppe der als Randgruppen-Synästhetiker bzw. auch als „metaphorische Synästhetiker“ zu bezeichnenden Personen besonders interessante Eigenschaften, die zu der Hypothese Anlass gaben, diese sog. „Gefühls-Synästhetiker“ bildeten möglicherweise auf dem zweiten inneren Bildschirm nicht den semantischen Gehalt aus einem anderen Sinneskanal ab sondern vielmehr die dabei mitlaufenden emotionellen Gefühlszustände, deren Variabilität und mangelnde Reproduzierbarkeit aber die Untersuchung erheblich erschwert. Eine - zumindest partielle - Legitimation, die metaphorischen Synästhetiker nicht aus der Untersuchung völlig auszuschließen ergab sich dann insbesondere dadurch, dass gefunden wurde, dass eine Subgruppe von Probanden existiert, die eindeutig beiden Kategorien zuzuordnen sind, die also sowohl genuinsynästhetische Eigenschaften als auch gefühls-synästhetische Eigenschaften zeigten.
Die Synästhesieeigenschaft ist grundsätzlich nichts krankhaftes, nicht pathologisch. Eher scheint es so zu sein, dass Menschen, die zur Synästhesie fähig sind, hieraus kognitive und emotionale Vorteile ziehen können, wie die bei Herrn S.., dem Gedächtniskünstler bereits deutlich wurde.
In diesem Sinne lässt sich sagen, dass die Synästhesieeigenschaft, außer wenn sie aufgrund von Drogen (LSD, Psylocibin) oder bei Schizophrenie (selten!) auftritt, auf keinen Fall als „pathologisch“ zu werten ist. Es gibt einige Hinweise darauf, dass eine negative Korrelation mit mathematischer Begabung auftreten kann. Dies könnte aber damit zu tun haben, dass in einigen Fällen die Synästhesie dazu führt, dass ständig Zahlen verwechselt werden, weil sich der Farbton gegenüber der Zahlensymbolik behauptet. Andererseits finden sich aber auch Hinweise darauf, dass die Synästhesiebegabung berufliche Vorteile bringt, wie beispielsweise bei dem von Lurija untersuchten Gedächtniskünstler. So berichtet eine Probandin auf die Frage, ob die Synästhesie auch beruflich für sie von Vorteil sei: „Ja, ganz entschieden. Also es hilft unheimlich bei der Rechtschreibung und man kann sich viel besser Zahlen und Telefonnummern merken. . . wenn ich mir einen Namen z.B. merken soll, dann habe ich normalerweise sagen wir mal die Farbschattierungen, die die Buchstaben hervorrufen, die habe ich als erstes im Kopf. Und anhand dieser Farbschattierungen wird der Name dann sozusagen zusammengesammelt. Das kann leider manchmal auch zu peinlichen Irrtümern führen, weil einige Buchstaben doch recht ähnliche Farben haben. Und da habe ich irgendwann man behauptet, es hätte jemand angerufen, dessen Name müsste unbedingt mit U anfangen, weil U bei mir einen bestimmten Grünton symbolisiert. Er fing aber mit H an, weil H einen sehr ähnlichen aber etwas anderen Grünton hat. Also kann man dabei auch ein bisschen reinfallen, aber im Großen und Ganzen funktioniert es sehr gut. Und es hilft also sehr gut bei der Rechtschreibung. Ich sortiere das nicht nach Lauten sondern nach Buchstaben. Ich weiß nicht warum. Wenn also ein Wort mit ai geschrieben wird wie z.B. das Wort Main, der Fluss, dann hat das eine ganz andere Farbqualität als „mein“ als Possesivpronomen. Das sieht ganz anders aus, das kann man überhaupt nicht verwechseln. Ebenso Wörter die mit f oder mit ph geschrieben werden, das sind völlig verschiedene Farben, das kann man nicht durcheinander bringen. Wenn man das Wort einmal richtig geschrieben gesehen hat, dann kann man es danach eigentlich nicht mehr falsch machen, wenn man die Farben richtig im Kopf hat. Das ordnet sich von selber zu ... das macht sich auch bei Fremdsprachen bemerkbar. Die Rechtschreibung in den Fremdsprachen kann ja manchmal ganz anders sein als die Lautung. Und dadurch, dass ich mir das nicht anhand der Laute merke sondern anhand der Buchstaben macht man da viel viel weniger Fehler.“
2.1 Imagination und Synästhesie
Wesentlich für ein Verständnis imaginativer Phänomene ist das Konzept, dass Sinneswahrnehmung als solche konstruktiv ist, einen wirklichkeit(s)-erzeugenden Aspekt hat, also nicht darin aufgeht, „Abbildung“ von Außenrealität zu sein. In der Verdeutlichung dieses Aspekts – gegen den vor allem angloamerikanischen traditionellen Sensualismus – liegt die Bedeutung des Konstruktivismus, beispielsweise bei Maturana, Varela, Luhmann, von Glasersfeld und anderen.
Dabei – beim konstruktivistischen Generieren von momentaner "Wirklichkeit" – werden nun aber nicht nur je neue Aspekte erzeugt, um komplexe Sinnesdaten-Lagen (Konstellationen von sensualistischen "patterns") auszudeuten; es werden vielmehr im Sinne einer Theorie der Kreativität auch überhaupt neue Wirklichkeitsmodelle erzeugt, es werden neue Wirklichkeiten erfunden; Watzlawick spricht in diesem Zusammenhang von der "erfundenen Wirklichkeit".
Im Hinblick auf die Synästhesieforschungen sind nun zwei Fragen von Interesse:
1. Wie entsteht die innere Einheitlichkeit des Bewusstseins? Hier sind Probleme der sogenannten “intermodalen und intramodalen Integration“ zu bewältigen.
2. Wie wird das Wahrnehmen eines Objekts mit dem stets mitlaufenden Gefühlston korreliert?
Diese beiden Fragen lassen sich anhand eines Hirnmodells schematisch erläutern (Abb.5)
Abb. 5: Schema der Richtungen in Top-down-Prozessen und Bottomup-Prozessen im Zentralnervensystem (nach Desimone u. a. 1995)
Unter Synästhesie versteht man, wie gesagt, das Phänomen, dass eine Sinnesqualität, wie z.B. das Hören eines Wortes, einer Zahl, eines Tones noch auf eine andere Sinnesqualität, wie das Sehen einer Farbe, quasi überspringt, bzw. darin noch einmal, d.h. doppelt repräsentiert ist. Interessanterweise berichten die Synästhetiker, dass die Einheit des Bewusstseins, die Einheitlichkeit des Objektes, hierdurch nicht verletzt ist, d.h. die beiden Sinnesqualitäten werden intermodal vollständig integriert. Dies ist neurobiologisch interessant, weil man versuchen kann, an diesem quasi natürlicherweise zusätzlich auftretenden Bewusstseinsphänomen den neurobiologischen Mechanismus der Bewusstseinsintegration, d.h. der Erzeugung der Einheitlichkeit des Bewusstseins, aufzuklären.
2.2 Reine Wahrnehmungssynästhesie (genuine Synästhesie)
Aus dem vielfältigen und reichhaltigen Material, da wir in Interviews über genuine Synästhetiker gesammelt haben, möchte ich zu Beginn einige Beispiele vortragen: So berichtet beispielsweise Frau U.M.: „Also es ist wirklich so, wenn mir einer eine Telefonnummer nennt, dass ich die Zahlen sehe, also ich kann sagen, meine Telefonnummer, ich sehe sie in den Zahlen und in den Farben gleichzeitig. Und so ist das bei allem, auch meistens bei den Buchstaben. Ja da muss ich jetzt direkt überlegen, eigentlich kommt die Zahl so wie sie gedruckt ist auch in der Farbe, also ich sehe sie zwar in schwarz, grün oder rot aufs Papier gedruckt aber in meinem Kopf ist sie so in der Umrandung wie die Zahl ist auch in der Farbe. Die 3 ist bei mir hellblau und die 3 ist nicht als Block oder als Strich sondern so, wie die 3 geschrieben ist in der Farbe kommt sie dann auch. Ich irre mich oft, und zwar deswegen, weil ich die 4 und die 7, die sind bei mir beide gelb, die 4 ist ein bisschen orangegelb, die 7 ein bisschen heller gelb, das sind genaue Farbunterschiede und diese Farben, wenn ich jetzt z.B. eine Zahl habe, eine Telefonnummer oder irgendeine mathematische Ziffer, die also 4 und 7 beinhaltet, dann kann es sein, dass ich vertausche und statt der 7 eine 4 schreibe und dann kommen halt falsche Resultate oder auch die falsche Telefonnummer. Ich habe mich oft verwählt. Also ich muss sagen, dass ich gemerkt habe, dass ich durch diese Farben in der Mathematik gestört bin, weil ich dauernd Fehler gemacht habe, auch früher in meinen Schularbeiten und ich glaube, das vor einigen Jahren daher gefunden zu haben, dass ich eben die 4 und die 7 vertausche und dass ich also unerklärliche Flüchtigkeitsfehler gemacht habe, die ich glaube daran liegen, dass ich mehr die Farben gesehen habe als die Zahlen.“
Eine interessante Untersuchung hinsichtlich der musikalischen Farbe-Ton-Synästhesie wurde kürzlich publiziert, die einen direkten Bezug zum Problem der Erinnerung aufweist: es wurde gefunden, dass Probanden, die feste Korrelationen zwischen Farberlebnissen und musikalischen Klangeindrücken aufwiesen für neuartige Klänge, die sie noch nie gehört hatten, auch noch keine quasi „geprägten“ visuellen Erlebnisse hatten. Man konnte aber in Konditionierungsexperimenten bestimmte Farbeindrücke mit diesen neuartigen Klängen koppeln. Es zeigte sich dann, dass die auf diese Weise erzeugten fixen Kombinationen von den genuinen Farbe-Ton-Synästhetikern über lange Zeit stabil festgehalten werden konnten, während Vergleichsprobanden ohne Synästhesieeigenschaften diese Zuordnungen nicht erinnern konnten. Ähnliche Versuche werden derzeit in meiner Abteilung bei der Farb-Symbol-Synästhesie durchgeführt.