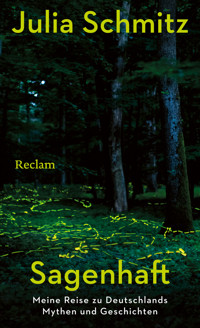
19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Reclam Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine Reise zu Deutschlands Märchen, Mythen und Legenden Den Rattenfänger von Hameln, die Heinzelmännchen oder die Loreley kennen vermutlich alle – aber was ist mit der Barbarine und dem Burgfräulein Agnes? Auf ihrer Reise durch sagenumwobene Gegenden Deutschlands taucht Julia Schmitz ein in die Welt von Hexen, Teufeln und Wassernixen, spürt untergegangenen Städten, Märchen und Legenden nach. Dabei wirft sie nicht nur einen Blick in die Vergangenheit, sondern zeigt uns, warum persönlich erzählte Geschichten in einer digitalisierten Welt umso wichtiger sind. - Eine packende Reise zu den sagenumwobenen Gegenden Deutschlands - Einzigartige Perspektive aus Kulturgeschichte und persönlicher Erfahrung - Deutsche Sagen – auf moderne und kritische Weise dargeboten
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Julia Schmitz
Sagenhaft
Meine Reise zu Deutschlands Mythen und Geschichten
Reclam
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist ausgeschlossen.
Für Papa
Dieser Text ist mit einem Stipendium der VG Wort »Neustart Kultur« entstanden.
RECLAM Nr. 962399
2025 Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Covergestaltung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH
Coverabbildung: Hermann Hirsch
Gesamtherstellung: Philipp Reclam jun. Verlag GmbH, Siemensstraße 32, 71254 Ditzingen
Made in Germany 2025
RECLAM ist eine eingetragene Marke der Philipp Reclam jun. GmbH & Co. KG, Stuttgart
ISBN978-3-15-962399-3
ISBN der Buchausgabe 978-3-15-011521-3
reclam.de | [email protected]
Inhalt
Motto
Einleitung
Berlin: Wie ich nach einer verwunschenen Prinzessin suchte und den Eingang in die Unterwelt fand
Brandenburg: Weshalb sich im Havelland alles um Obst dreht und man im Spreewald die Mittagshitze fürchtet
Harz: Wie ich in der Walpurgisnacht mit den Brockenhexen Bowle trank
Sächsische Schweiz: Warum der Teufel mit Felsen wirft und junge Damen plötzlich versteinern
Fichtelgebirge: Wo Beelzebub zum verhängnisvollen Kartenspiel lädt
Allgäu: Wie ich mit wilden Männle tanzte und ein Unterwasserpferd besuchte
Schwarzwald: Wo ich mit den närrischen Kandelhexen die Fasnacht feierte
Oberes Mittelrheintal: Wie eine Nixe Männer ins Verderben stürzt
Eifel: Wie ein Burgfräulein sich wehrte und ein Schloss im See versank
Köln: Wo Ursula die Knochen der Jungfrauen lagert und nachtaktive Hausgeister Strümpfe stopfen
Hoher Meißner: Warum Frau Holle mehr ist als eine freundliche Märchenfigur
Weserbergland: Weshalb Hameln noch immer nach seinen verschwundenen Kindern sucht
Nordsee: Warum vor Husum Städte untergehen und gespenstische Männer über den Deich reiten
Ostsee: Wieso auf Rügen zwei Frauen in einem Felsen festsitzen und auf ihre Erlösung warten
Zurück in Berlin: Wie uns Sagen dabei helfen, uns in der Welt zu verorten
Literatur
»Ich bekenne, ich brauche Geschichten, um die Welt zu verstehen«
Siegfried Lenz
»By their myths we shall know them«
Rollo May
Einleitung
»Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere häßlich und faul. Sie hatte aber die häßliche und faule, weil sie ihre rechte Tochter war, viel lieber, und die andere mußte alle Arbeit thun und der Aschenputtel im Hause sein.«
Meine Großmutter steckt das aufgeplusterte Federbett, an dessen Ausschütteln Frau Holle ihre wahre Freude hätte, an den Seiten meines Bettes fest. Jeden Abend vor dem Einschlafen erzählt sie mir ein Märchen: von Goldmarie und Pechmarie, Rotkäppchen und dem bösen Wolf oder den mutigen Kindern Hänsel und Gretel. Am Ende, das weiß ich, wird alles gut, das junge Mädchen aus dem Bauch des Wolfes geschnitten und die böse Hexe im Ofen verbrannt.
Noch spannender finde ich allerdings die Geschichten, an deren Ende nicht immer die Guten gelobt und die Schlechten bestraft werden.
Wenn Oma, die in Schlesien aufwuchs und nach dem Zweiten Weltkrieg an den Niederrhein floh, über die Sagen von Rübezahl spricht, ziehe ich die Bettdecke noch enger um mich herum und linse mit leichter Gänsehaut nach den Schatten, die in den Ecken meines Zimmers wabern. Der zottelige Riese, der im – wie passend, denke ich – Riesengebirge sein Unwesen treibt, ist keineswegs freundlich und bringt so manchen Bewohner der Gegend zum Zittern.
Anders verhält es sich mit den putzigen Heinzelmännchen, die vor langer Zeit in Köln gelebt haben sollen, der Stadt, in der ich mit meinen Eltern wohne:
»Wie war zu Köln es doch vordem
Mit Heinzelmännchen so bequem!«
Sie halfen den Kölnern, die lieber fünfe gerade sein ließen, statt hart zu arbeiten: Während Schneider, Bäcker und Schreiner sich im Brauhaus ein Gläschen Kölsch genehmigten, nähten, backten und schreinerten die kleinen Zwerge eifrig vor sich hin.
Weil die überaus neugierige Frau des Schneiders aber unbedingt wissen wollte, welche übersinnlichen Mächte des Nachts in Köln am Werk waren, und die Heinzelmännchen bei ihrer Arbeit überraschte, suchten diese das Weite – ein Hinweis für mich als Kind, manche Dinge lieber im Dunkeln zu lassen:
»O weh! nun sind sie alle fort
Und keines ist mehr hier am Ort!
Man kann nicht mehr wie sonsten ruhn
Man muß nun alles selber tun«
Den arbeitsamen Zwergen hat der Kölner Verschönerungsverein 1899 als Andenken einen Brunnen gebaut, der die Sage mit steinernen Figuren nacherzählt. Er steht in der Nähe des Doms direkt vor dem traditionsreichen Brauhaus Früh, wo die schnauzbärtigen Kölner sich nach wie vor ihr Kölsch vom Köbes servieren lassen und dabei vielleicht noch immer den kleinen Helfern hinterhertrauern. Als Kind zerrte ich an den Händen meiner Eltern, sobald wir in die Nähe des Brunnens kamen: Ich wollte die Heinzelmännchen dazu überreden, zurückzukommen. Vielleicht konnten sie wenigstens einmal das ungeliebte Aufräumen meines Zimmers übernehmen?
Dreißig Jahre später betrachte ich wieder einmal den Brunnen in der Kölner Innenstadt. Wie an jedem Tag stehen viele Menschen vor dem steinernen Denkmal und machen Fotos; ein Stadtführer erklärt den Umstehenden die Geschichte der Heinzelmännchen auf Englisch. Ein kleines Kind klettert an der Hand seiner Mutter auf die Steinbalustrade, um die Zwergenfiguren besser sehen zu können. Ob es die Sage der Heinzelmännchen kennt und genau so faszinierend findet wie ich damals?
Geschichten habe ich schon immer gerne gelesen, doch erst als junge Erwachsene begann ich, mich intensiver mit ihnen auseinanderzusetzen. Ich studierte Literaturwissenschaft an der Universität Bonn und vergrub mich ganze Tage lang in der Bibliothek des Germanistischen Seminars, wo die Regale voller Bücher bis unter die Decke reichten. Durch die hohen Fenster des kurfürstlichen Schlosses fielen Lichtstrahlen, in denen Staubkörner tanzten. Über allem lag der leicht modrige Geruch von alten Büchern, die seit langem von niemandem mehr geöffnet wurden. Während ich für eine Hausarbeit nach Literaturhilfen zu Goethes Texten die Regalreihen absuchte, blieb mein Blick eines Nachmittags bei den Büchern von Jacob und Wilhelm Grimm hängen. Die Gebrüder Grimm! Sofort kamen Erinnerungen an Mädchen mit roten Käppchen, aufgeschnittene Wolfsbäuche und hungrige Hexen in Lebkuchenhäusern in mir hoch. Doch ich hielt gar nicht die Kinder- und Hausmärchen in den Händen, sondern die Deutschen Sagen.
Was ist denn eigentlich genau der Unterschied zwischen Märchen und Sagen, fragte ich mich. Ich wusste es nicht. Eine Weile vertiefte ich mich in die schauderhaften Geschichten, dann kehrte ich gezwungenermaßen zurück zu Goethe. Die übersinnliche Atmosphäre der Sagen aber ließ mich nicht los. Ich kaufte mir die günstige Ausgabe einer Sammlung von deutschen Sagen und verbrachte ganze Abende damit, darin zu blättern.
Wenn man mich heute fragt, worin Märchen und Sagen sich ähneln und worin nicht, kann ich es besser erklären. »Das Märchen ist poetischer, die Sage historischer«, schrieben die Brüder Grimm im Vorwort ihrer 1816 erstmals veröffentlichten Sammlung von Sagen aus dem deutschsprachigen Raum. Die Sage soll für wahr gehalten werden und wird als über Generationen vererbtes »Volkswissen« betrachtet. Ein Märchen hingegen stammt recht deutlich aus dem Reich der Phantasie. Während im Märchen sprechende Bären, Frösche oder Blumen bei niemandem der Beteiligten auch nur eine hochgezogene Augenbraue auslösen, können solche übersinnlichen Erscheinungen den Menschen in den Sagen den Schrecken ihres Lebens einjagen.
Märchen enden oft mit einer ziemlich grobschlächtigen Moral, Sagen sind weniger plakativ – obwohl auch sie große Themen wie Liebe, Verrat, Tod und Trauer behandeln. Der Unterschied, den ich persönlich aber am wichtigsten finde, ist, dass Märchen irgendwo in einem fernen Land spielen. Sagen aber, bis auf wenige Ausnahmen, sind an eine Landschaft, einen Gebirgszug oder eine Stadt gebunden. Oftmals steht der Ortsname schon im Titel. Deshalb wäre es nicht möglich, den Rattenfänger aus Hameln nach Bielefeld zu versetzen, die Loreley aus Bacharach am Rhein in den Harz zu entführen oder die Heinzelmännchen aus Köln nach Mainz überzusiedeln – wobei das ZDF mit den Mainzelmännchen damit ja durchaus Erfolg hatte.
Auch wenn sich die Inhalte von Sagen teilweise überlappen, teilt man sie grob in drei Bereiche ein: Es gibt sogenannte »ätiologische Sagen«, mit denen zum Beispiel die Entstehung eines landschaftlichen Merkmals oder ein Städtename erklärt wird; es gibt »dämonische Sagen«, in denen übersinnliche Erscheinungen und Wesen wie Hexen, Aufhocker und Teufel im Mittelpunkt stehen. Und es gibt zahlreiche historische Sagen, die sich um bekannte Persönlichkeiten wie Kaiser und Könige drehen und deren Schauplätze oft Städte sind.
Die Brüder Grimm, die in Hanau bei Frankfurt geboren wurden und später in Berlin lebten, waren übrigens nicht die Ersten, die Geschichten aus dem »Mund des Volks« sammelten. Bereits Ende des 18. Jahrhunderts hatten sich Schriftsteller der Frühromantik von den lokalen Erzählungen inspirieren lassen und sie in Büchern zusammengestellt oder aus ihnen fein ausgearbeitete Kunstmärchen entwickelt. Mit der Bearbeitung des Undine-Stoffs über einen charismatischen, weiblichen Wassergeist publizierte Friedrich de la Motte Fouqué 1811 das wohl bekannteste Beispiel.
Der Rückgriff auf ein vermeintlich »ursprüngliches« und naturverbundenes Leben im Mittelalter löste Ende des 18. Jahrhunderts einen regelrechten Hype in den oberen Gesellschaftsschichten aus, die sich vor lauter Ennui vorgeblich uralte Ruinen in den weitläufigen Garten bauen ließen und sich gegenseitig bei Kerzenschein Sagen von Teufelspakten und Hexen vorlasen. Die Gebrüder Grimm rannten damals mit ihrer Sagensammlung also offene Türen ein.
Aber die Zeiten haben sich geändert. Lange wurden Märchen und Sagen, Bräuche und Traditionen außerhalb der Literaturwissenschaft als Folklore belächelt. Das hängt auch mit der Tatsache zusammen, dass wir heutzutage fast in jeden Winkel der Welt reisen können – aber oftmals wenig über die Kulturgeschichte unmittelbar vor unserer Haustür wissen. Der Bezug zur Region, in der wir leben, ist nicht mehr so stark wie bei den Menschen vor 100 Jahren. Nur noch selten verbringen wir unser komplettes Leben an dem Ort, an dem wir geboren wurden; wir ziehen aus dem Dorf in die Stadt und nehmen uns in der Hektik des Alltags nicht die Zeit, tiefe Wurzeln zu schlagen und in die Historie und das Wissen des Ortes einzutauchen.
Doch seit einiger Zeit erleben Sagen ein Revival. Und das nicht nur in der Literatur, sondern vor allem im Tourismussektor. Das Obere Mittelrheintal, in dem die Sage von der Loreley angesiedelt ist, lebt von der Anziehungskraft dieser rätselhaften Erzählung: Eine Freilichtbühne, ein Kulturpark und eine Sommerrodelbahn sind nach ihr benannt; im Sommer stehen die Reisebusse in engen Reihen auf dem Besucherparkplatz und bringen die Tourismuskassen in Sankt Goarshausen zum Klingeln. Vermutlich alle, die im Rheintal wohnen, können das vertonte Gedicht von Heinrich Heine über die »Lore-Ley« singen:
»Ich weiß nicht, was soll es bedeuten,
Daß ich so traurig bin;
Ein Mährchen aus alten Zeiten,
Das kommt mir nicht aus dem Sinn.«
Haben Sagen also vor allem eine Bedeutung für die Menschen, die in der Nähe ihrer Schauplätze leben? Tragen diese Geschichten, die tief mit einer Gegend verbunden sind, dazu bei, dass sie sich zugehörig zu einer Stadt oder einem Landstrich fühlen – und lerne ich durch sie vielleicht etwas über die Mentalität eines Ortes?
Ich begann darüber nachzudenken, welche Geschichten, die mir mein Vater und meine Großmutter in meiner Kindheit erzählten, meine Sicht auf die Welt geprägt haben und wie sie mit meiner Heimatstadt Köln verbunden sind. Sicherlich habe ich damals durch die Heinzelmännchen gelernt, dass Faulheit und Undankbarkeit letztendlich bestraft werden, auch wenn das nicht dazu führte, dass ich mein Zimmer besonders häufig aufräumte. Aber spielt das noch eine Rolle in meinem Erwachsenenleben? Was kann ich als 40-Jährige Neues von Frau Holle lernen? Und warum berührt mich das 800 Jahre später noch immer ungeklärte Schicksal der Kinder von Hameln eigentlich so sehr?
Ich entschied mich, die Sagenbücher zur Seite zu legen und stattdessen zu den Orten zu reisen, an denen die Sagen entstanden sind. Ich wollte herausfinden, welche Bedeutung diese Geschichten für mich in unserer globalisierten, rational-wissenschaftlichen und sichtbar entzauberten Gegenwart haben. Können sie mir etwas über mein Leben erzählen, mir Ratschläge geben und vielleicht auch Trost spenden?
Den Schwerpunkt legte ich dabei auf die wirklich »kleinen« Sagen, die, mit ein paar Ausnahmen, nur lokal bekannt sind. Umfangreiche »Heldensagen« wie die Nibelungensage, die von Beginn an in stilisierter, literarischer Form festgehalten und verbreitet wurden, ließ ich außen vor.
Mit einem klapprigen pinken Fahrrad, das ich für ein paar Münzen in der Nachbarschaft kaufte, radelte ich in den kommenden Wochen durch Berlin. In dieser geschichtsversessenen Stadt, in der ich seit fast 20 Jahren lebe und die mir längst zu einer Wahlheimat geworden ist, stieß ich auf eine Fülle an alten Volkssagen. Nach und nach tauchte ich immer tiefer ein in eine verwunschene Welt.
Dann beschloss ich, den Radius deutlich zu erweitern. In meinem Büro hängte ich eine große Deutschlandkarte über den Schreibtisch und stieß auf Ortsnamen, die für sich schon sagenhaft klingen, wie Warzenbach, Todenhausen, Knochenmühle und Siedichum. Mit Stecknadeln markierte ich, welche »Sagenorte« ich unbedingt besuchen wollte, und entwarf eine grobe Route, die mich von Berlin aus im Uhrzeigersinn durch das Land und durch verschiedene Gebirge und Wälder, zu Seen, Flüssen und ans Meer führen würde.
Es ging also los. Ich wanderte durch das Allgäu und traf auf wilde Fräulein und einen Unterwasserhengst, tanzte mit den Hexen auf dem Blocksberg im Harz, suchte eine untergegangene Stadt in der Nordsee und spielte Karten mit einem wütenden Teufel im Fichtelgebirge.
Ich reiste durch ein Land, dessen Grenzen in den vergangenen Jahrzehnten mehrmals verschoben, neu gezogen oder aufgelöst wurden, und stieß dabei – der Geschichte sei Dank – gegen keine Mauer mehr. In den Zeiten, in denen die Sagen entstanden, war diese Gegend hingegen noch ein bunter Flickenteppich aus Königreichen, Herzog- und Fürstentümern und hieß auch nicht Deutschland, sondern Heiliges Römisches Reich. Erst 1815 bekam sie die Bezeichnung »Deutscher Bund«.
Sagen haben ohnehin weder eine Nationalität, noch halten sie sich an Landesgrenzen. Anstatt also in die gleiche Falle wie die Gebrüder Grimm zu tappen und mit den Sagen eine »Heimat« zu propagieren, die manche Personen ein- und andere ausschließt, wollte ich auf meiner Reise herausfinden, was sich für jeden und jede von uns – egal welcher Herkunft – in dieser Erzähltradition verbirgt. Warum faszinieren uns die alten Geschichten bis heute? Was können wir von ihnen lernen?
Um das herauszufinden, sprach ich mit Märchenerzählern, Kuratorinnen und Sagensammlern, also mit Menschen, die sich mit Volkssagen beschäftigen und sie so am Leben halten. Ich begab mich auf die Suche nach unseren Mythen und Geschichten.
Berlin
Wie ich nach einer verwunschenen Prinzessin suchte und den Eingang in die Unterwelt fand
Kann man sich heute angesichts von knapp vier Millionen Einwohnern, zwölf Bezirken, unzähligen Techno-Clubs sowie drei stillgelegten und einem mehr oder weniger funktionierenden Flughafen überhaupt vorstellen, dass hier vor etwas mehr als 800 Jahren noch eine schlammige, unbenannte Ödnis war?
Würde Albrecht der Bär heute durch Berlin spazieren, er würde ziemlich sicher nichts mehr wiedererkennen. Seit er 1157 die Mark Brandenburg und später – glaubt man der Sage – auch Berlin gründete, hat sich die Stadt nicht nur etliche Male neu erfunden, sondern auch in alle Himmelsrichtungen ausgedehnt.
Wo früher Moore das Durchkommen erschwerten, fährt mittlerweile die Straßenbahn bimmelnd durch die Kieze. Die ursprünglichen Siedlungen »Berlin« und »Cölln« sind längst zusammengewachsen, die matschigen Gebiete der Innenstadt trockengelegt. Doch morastige Orte gibt es auch heute noch im Stadtgebiet. Und liegt es nicht nahe, dass dort, wo man mit den Füßen im Schlamm stecken bleibt, wenn man nicht aufpasst, auch noch andere Dinge versunken sind – zum Beispiel ein komplettes Schloss?
Einer dieser mystischen Orte liegt tief im Südosten der Stadt: Der Teufelssee ruht mitten im Wald, nur ein paar Gehminuten entfernt vom erhabenen Müggelsee. Im Vergleich mit dem über sieben Quadratkilometer großen Gewässer, auf dem Sportboote über die Wasseroberfläche lärmen, wirkt der Teufelssee winzig und sehr still. Dabei ist die nächste Straße, der von Bäumen gesäumte Müggeldamm, nicht weit entfernt. Hier steige ich an einem gewöhnlichen Wochentag im April aus dem Bus. Die Station heißt »Rübezahl«, und ich bin kurz verwirrt – was macht Rübezahl am Müggelsee? Gehört er nicht in die Sagenwelt einer anderen Gegend?
Heute lasse ich mich allerdings nicht von einem hutzeligen Waldmännlein führen, sondern von Theodor Fontane. Der Literat mit der scharfen Zunge und der scheinbar unstillbaren Wanderlust war Mitte des 19. Jahrhunderts nicht nur in Brandenburg, sondern auch in Berlin unterwegs. Er ließ sich bereitwillig in die geheimnisvollen Geschichten der Müggelberge hineinziehen.
Ich kehre der Hauptstraße den Rücken und laufe in den Wald. »Teufelssee – Besuchen Sie uns im Lehrkabinett« steht in weißen Lettern auf einem Holzbrett am Ufer. Am Waldrand wachsen Knoblauchsrauke und Bärlauch, beide Pflanzen stülpen dem Wald einen Geruch nach Knoblauch über, der nicht so recht in den malerischen Wald passen will. Eine Gruppe Kindergartenkinder hüpft singend an mir vorbei, als ich den kleinen Weg Richtung Wasser einschlage. Damit Besucher trockenen Fußes dorthin gelangen, hat der Bezirk einen hölzernen Steg über das Moor gezogen; am Rand wachsen vereinzelte Birken und Gräser. Ein paar Sträucher haben bereits Knospen gebildet, doch insgesamt sieht es im Südosten Berlins noch ziemlich winterlich aus.
Auf einer Plattform halte ich an und schaue auf die tiefschwarze Oberfläche des Sees, der in der Eiszeit entstanden ist und an seiner breitesten Stelle gerade einmal 100 Meter misst. Hier herrscht definitiv eine unheimliche Stimmung, obwohl es helllichter Tag ist und ich nicht allein bin. Theodor Fontane fand die passenden Worte für den See: »Er hat den unheimlichen Charakter aller jener stillen Wasser, die sich an Bergabhängen ablagern und ein Stück Moorland als Untergrund haben. Die leuchtend-schwarze Oberfläche ist kaum gekräuselt, und verwaschenes Sternmoos überzieht den Sumpfgürtel, der uns den Zugang zum See zu verwehren scheint. Er will ungestört sein und nichts aufnehmen als das Bild, das die dunkle Bergwand auf seinen Spiegel wirft.« Kein Wunder, dass hier so viele Sagen entstanden sind, denke ich.
Die bekannteste davon erzählt die Geschichte des slawischen Fürsten Jaczo und seiner Frau Wanda. Jaczo von Köpenick gab es wirklich, er wird um 1125 geboren und stirbt 1167. Dazwischen kämpft er mit Albrecht dem Bären darum, wer Herrscher über die Gebiete an Havel und Spree wird. Mehrere Jahre lang dauert der Streit, siebenmal soll Jaczo versucht haben, seinen Gegner zu besiegen. Doch 1157 zieht er endgültig den Kürzeren und geht zurück nach Köpenick, um dort beleidigt seine Wunden zu lecken.
Aber aufgeben will er dennoch nicht. Also ruft er alle Priester und Weisen aus der Umgebung zusammen und fragt sie: »Was soll ich tun, um doch noch die Macht zu erlangen?« Ihr Rat ist grausam: Eine Burg in den sieben Müggelbergen solle er bauen – und damit niemand sie je einnehmen könne, müsse er seine Frau Wanda in die Gewölbe einmauern. Noch verwunderlicher ist aus heutiger Sicht allerdings, dass Jaczos Gattin sogar zustimmt. Also baut er die Burg. Doch hat der Fürst die Rechnung nicht mit übersinnlichen Mächten gemacht: Als man gerade Steine um Wanda herum aufschichtet, bricht auf einmal ein wahrhaft höllisches Gewitter am Himmel los.
Das noch nicht fertig gestellte Gebäude fängt Feuer, brennt vollständig herunter und versinkt dann mit einem letzten schlürfenden Geräusch im Moor. Am nächsten Tag gibt es nur noch sechs Müggelberge, an der Stelle des siebten befindet sich ein See – darin soll die Burg noch heute liegen. Jaczo, heißt es in der Sage, wurde über dieses Ereignis verrückt und zieht noch heute als Wiedergänger durch die Müggelberge. Einmal im Jahr steigt seine Frau aus den Tiefen des Sees an die Oberfläche und versucht, ihn zu finden. Bisher war sie erfolglos. Vielleicht ist sie ja jedes Mal mit den Füßen im Schlick stecken geblieben und hat dann entnervt aufgegeben, denke ich und muss schmunzeln.
Es gibt aber noch mehr Geschichten über den Teufelssee in Köpenick. In einer weiteren Sage steht bereits ein prächtiges Schloss an der Stelle, wo heute der See liegt. Doch auch dies geht unter, mitsamt der darin wohnenden Prinzessin. Ihr Vater hatte sie verwünscht, weil sie sich mit einem Mann eingelassen hatte, der ihm nicht genehm war. Ein großer Stein, der am Fuße der Müggelberge liegt, wird seit jeher »Prinzessinnenstein« genannt: Darauf soll die hübsche Maid gelegentlich sitzen und sich, mit melancholischem Blick, ihr güldenes Haar kämmen. Alle Versuche, die Dame aus ihrer Lage zu erlösen, sind bisher gescheitert.
Ein strammer Köpenicker, so erzählt man sich, soll ihren Geist einst auf dem Rücken um die Köpenicker Kirche getragen haben. Schaffe er es dreimal, so erhalte er den Goldschatz, den sie im See verstecke, hatte sie ihm versprochen. Unter einer Bedingung: Er dürfe sich nicht umschauen. Zwei Runden lang weicht er allen Hindernissen aus, doch als sich bei der dritten Runde plötzlich der Himmel rot färbt, schaut er doch über die Schulter nach hinten – er hat Angst, dass sein Zuhause in Flammen steht. Als Strafe fällt er sofort tot um. Und das war es dann vorerst auch mit der Erlösung der verzauberten Prinzessin.
Ein Schloss, in diesem winzigen See? Ich bekomme Gänsehaut, je länger ich auf die dunkle Wasseroberfläche schaue, und das liegt nicht nur am Wetter. Mit ein bisschen Phantasie sehe ich die Türmchen und Zinnen glitzern, höre die erschrockenen Ausrufe der Untergehenden. Das Gewässer ist ungewöhnlich kreisrund, und die Vorstellung, dass sich hier der Erdboden aufgetan und einen Prunkbau verschluckt hat, ist gar nicht so abwegig. Mir gefallen die Geschichten, auch wenn ich mich, als aufgeklärte, moderne Frau, an dem Opferstatus der erwähnten Frauen stoße. Warum ist die Prinzessin ausgerechnet auf die Tragkraft eines Mannes angewiesen, um dem Fluch zu entkommen? Hätte man ihr nicht Aufgaben geben können, die sie, mit ein paar Jahrhunderten Übung, allein hätte bewerkstelligen können? Aber so funktionierte das damals nicht. Und verbannte man mich in einen dunklen See, ich wäre vermutlich völlig verloren. Mein Handyempfang lässt hier, am Rande zu Brandenburg, dem größten Funkloch Deutschlands, nämlich auch bereits zu wünschen übrig.
Bei Tageslicht strahlt die Gegend um den Teufelssee eine angenehm geheimnisvolle Atmosphäre aus. Aber bei Nacht würden mich keine zehn Pferde in die Nähe dieses Moors und des Sees bringen, denke ich. Dem Teufel, und sei es auch das meist eher harmlose Teufelchen der Sagenwelt, möchte ich lieber nicht begegnen. Aber warum heißt eigentlich das Gewässer Teufelssee?
Natürlich hatte der Gehörnte auch an diesem Ort seine Finger im Spiel – wahrscheinlich ebenso wie auf der anderen Seite der Stadt, wo sich, mitten im Grunewald, ein weiterer Teufelssee befindet. Doch in Köpenick gibt es die passende Geschichte dazu: Neben dem schon erwähnten Prinzessinnenstein soll hier einst ein weiterer großer Stein gelegen haben, den die Menschen für einen Altar des Teufels hielten. Hier treffe sich der Höllenfürst regelmäßig mit den in der Gegend ansässigen Hexen, erzählte man sich; vor allem in der Walpurgisnacht versammelten sie sich hier, um später gemeinsam zum Blocksberg im Harz zu fliegen.
Aber Hexen – das werde ich auf meiner Sagenreise noch häufiger hören – haben damals keinen guten Ruf. Die Anwohner der Umgebung wollen die Gruppe um den Bocksfuß loswerden. Der Teufel schert sich allerdings nicht um seine Reputation und verguckt sich in den Müggelbergen in eine besonders hübsche Hexe – die bei Tageslicht allerdings die Frau eines Müllers ist. Dieser hat seine Angetraute schon länger im Verdacht, in der Dunkelheit abtrünnig zu werden, und folgt ihr deshalb eines Nachts in den Wald. Wo er seine Gattin, die sich in eine andere Gestalt verwandelt hat, in inniger Umarmung mit dem Leibhaftigen beobachtet.
Für den Müller hat seine Neugier unschöne Folgen, denn plötzlich reißt ihn eine unsichtbare Hand an der Schulter und zieht ihn in die Tiefen des Sees. Er wird nie wieder gesehen. Für die anwohnenden Müggelheimer bringt der Vorfall das Fass zum Überlaufen. Um dem teuflischen Treiben endlich ein Ende zu setzen, zerstören sie den Teufelstisch. Und so kommt der See zu seinem Namen. Von dem teuflischen Treiben finden sich heute allerdings keine Spuren mehr.
Über 80 Seen gibt es im Berliner Stadtgebiet, und viele davon tragen Namen, bei denen ich mich frage, wie sie entstanden sind: der Sausuhlensee im Westend, der Karutschenpfuhl in Steglitz, der Hundekehlesee in Grunewald oder der Faule See, den es gleich dreimal gibt. Fast um jedes Gewässer rankt sich eine Geschichte, und manche davon ähneln den Sagen vom Teufelssee.
Auch im Orankesee, der im Stadtteil Hohenschönhausen liegt, begegnet man unter Umständen einer verzauberten Prinzessin. Sie heißt Oranke und kommt ursprünglich aus Norwegen. Dort war sie mit einem Wikinger liiert, doch der reiste viel und ließ die gute Oranke über viele Monate hinweg allein zu Hause zurück. Also vertrieb sie sich die Langeweile mit anderen Männern. Der Wikinger hätte sich vermutlich, wäre die Situation andersrum gewesen, ebenfalls anderen Frauen hingegeben.
Doch zu der Zeit herrschen noch klare Vorgaben: Eine Frau hat treu zu sein. Als der Wikinger Oranke beim Fremdgehen erwischt, kennt sein Zorn keine Grenzen. Er verbannt sie in den kleinen See im Nordosten Berlins – warum ausgerechnet dorthin, das ist leider nicht bekannt. Dort wohnten schon andere Nixen – ob auch sie von eifersüchtigen Ehemännern verwünscht wurden? –, und gemeinsam spielen sie in Vollmondnächten an der Wasseroberfläche.
Sagenkundige Zeitgenossen wissen: Man sollte die über- oder unterirdischen Wesen dann lieber allein lassen, um sich nicht in Gefahr zu bringen. Doch ein Wanderer, der in einer dieser Nächte am See vorbeigeht, kann sich nicht zurückhalten und beobachtet die Nixen durch das Schilf. Leider entdecken sie ihn. Und weil sie, ähnlich den Sirenen in Homers Odyssee, eine große Anziehungskraft auf ihn ausüben, folgt er ihnen bereitwillig in den See. Und weg war er. Fräulein Oranke, erzählt man sich übrigens, sitzt noch heute in Vollmondnächten am Ufer des nach ihr benannten Sees und kämmt ihr Haar. Wer aufmerksam sucht, findet vielleicht am nächsten Tag eines am Sandstrand des anliegenden Freibads?
Die beiden Sagen um den Teufelssee und den Orankesee enthalten Themen und Motive, die in zahlreichen Sagen vorkommen: Untergegangene Schlösser, verzauberte Nixen und das Spiel mit dem Teufel gibt es nicht nur in den Geschichten aus Berlin, sondern so oder so ähnlich auch im Schwarzwald oder in der Eifel. Sie spielen in einer Zeit, in der Köpenick noch nicht zu der späteren Weltmetropole Berlin gehörte und vor allem größtenteils aus Wald bestand. Ihre Protagonisten sind auf den ersten Blick nicht besonders berlintypisch, die Geschichten beinhalten sozusagen eine überregionale Moral. Oder sie spielen auf biblische Geschichten an wie die Frau von Lot, die sich während der Zerstörung der Städte Sodom und Gomorra umdreht und zur Salzsäule erstarrt. Und doch lässt sich in ihnen schon ein bisschen »Berliner Schnauze« erkennen: Lange Zeit lassen die Köpenicker den Teufel in den Müggelbergen wildern – und nehmen damit vielleicht schon das berühmte Bonmot »Jeder soll nach seiner Fasson selig werden« von Friedrich II. vorweg –, bis ihnen letztendlich die Hutschnur platzt und sie seinen Thron zerstören und ihn verjagen.
Auch die Frauenfiguren sind weniger ortstypische Charaktere denn Stereotype. Sie verkörpern die beiden Rollen, die Frauen seit Jahrhunderten spielen sollen: Entweder sind sie die sittsame Jungfrau und heilige Mutter – oder die Femme fatale, der männermordende Vamp, die lüsterne, hemmungslose Hexe. Letztere bedeutet zwar Unabhängigkeit und Selbstbestimmung, aber in vielen Fällen auch soziale Ausgrenzung – und zwar bis heute. Im Laufe meiner Reise werde ich noch etliche Male in Berührung mit der Vorstellung kommen, was oder wie eine Frau sein sollte. Aber erst einmal schaue ich bei einer Göttin vorbei, die einen feuchten Kehricht auf die Meinung anderer gibt.
Berlin ist mitten in einem Sumpf und auf märkischem Sandboden entstanden, die Stadt ist auf eher instabilen Grund gebaut und von Wasser geprägt. Spätestens seit der Jahrhundertwende wird sie auch im übertragenen Sinne oft als Sumpf bezeichnet, in den 1920er Jahren war sie außerdem berühmt-berüchtigt für ihre Ringvereine und die raubeinige Unterwelt. Aber wer weiß heute schon, dass sich mitten in Berlin auch der Eingang zur mythologischen Unterwelt und zum Reich der Toten befindet?
»Das ist die blanke Hölle!« Wann habe ich zum letzten Mal jemanden auf diese altmodische Art schimpfen gehört? Meine Großmutter hätte vermutlich große Freude daran, würde ich ihr erzählen, dass in Berlin eine ganze Wohnsiedlung so heißt: Blanke Hölle. Die zwischen 1929 und 1931 im sachlichen Stil gebauten Häuser liegen im Süden des Stadtteils Tempelhof, gleich neben einem kleinen See, der dank trockener Hitzesommer mittlerweile eher ein kleiner Tümpel ist. Er heißt »Blanke Helle« oder auch »Hels Pfuhl«. Hier soll die Totengöttin Hel zu Hause sein – und ich will ihr einen Besuch abstatten.
An einem sonnigen Frühlingstag fahre ich mit meinem klapprigen pinken Fahrrad Richtung Süden. Mein Weg führt mich durch Berlins historische Innenstadt, vorbei am Brandenburger Tor und dem Potsdamer Platz. Auf dem Mehringdamm in Kreuzberg warten Touristen wie jeden Tag in einer viele Meter langen Schlange darauf, sich einen überteuerten Gemüsedöner bestellen zu dürfen; ich weiche im letzten Moment zwei jungen Männern aus, die, ohne nach links zu schauen, auf die große Kreuzung gelaufen sind.
Ein paar hundert Meter den Tempelhofer Damm runter biege ich ab in die Gartenstadt Tempelhof und atme auf. In dem Viertel aus Einfamilienhäusern herrscht eine angenehme Ruhe, die sich spürbar von der Hektik der Innenstadt abhebt. Der Frühling hat in diesem Jahr lange auf sich warten lassen, doch jetzt, kurz nach Ostern, tragen die Bäume endlich erste Blüten. In den akkurat gepflegten Vorgärten der pastellfarbenen Häuser wachsen Osterglocken, Narzissen und Tulpen um die Wette; in der Luft liegt der Duft von Neuanfang. Auf der anderen Straßenseite auf dem Tempelhofer Feld – dieser riesigen Freifläche, um deren Erhalt die Berlinerinnen und Berliner immer wieder kämpfen müssen – drehen an diesem Tag Spaziergänger, Jogger und Windsurfer ihre Runden.
Als ich am Alboinplatz, wie der Park offiziell heißt, ankomme, bin ich überrascht von der freundlichen Atmosphäre. Die Wiese ist übersät mit kleinen blauen Blumen, vereinzelt liegen Menschen im Gras und lesen. Statt Düsternis und Verderben herrscht hier Freude und Ausgelassenheit.
Ob die dunkle Göttin Hel heute überhaupt für ein Gespräch zur Verfügung stehen wird – und ob ich ihr dafür in ihren Pfuhl folgen muss? Denn Reisen in die Unterwelt, das wussten schon die Menschen in der Antike, gehen oft nicht gut aus oder sind mit großen Opfern verbunden. Viele kommen auch gar nicht mehr zurück in die diesseitige Welt. Während ich meine Decke ausbreite und das Notizbuch aus dem Rucksack hole, denke ich an Persephone, die von Hades entführt wird, an die verzweifelte Dido und ihren Liebhaber Aeneas und natürlich an Odysseus. Und hoffe, heute an der Oberfläche bleiben zu dürfen.
Doch obwohl Hel die Unterwelt bewacht, ist ihre Sphäre deutlich neutraler, als wir sie – die wir größtenteils vom Christentum geprägt sind – interpretieren: Die Totenwelt, in unserem heutigen Sprachgebrauch oft auch Hölle genannt, war in der Nordischen Mythologie, aus der Hel stammt, kein Ort der Bestrafung. Sie bezeichnet vielmehr einen neutralen Bereich, der die Toten birgt und, wie in vielen Kulturen gängig, Teil des dreiteiligen Kosmos aus Himmel, Erde und Unterwelt ist.
Hel wurde als Tochter des Asen Loki und der Riesin Angrboda geboren, ihre Geschwister sind der Fenriswolf und die Midgardschlange. Zunächst lebte sie mit den anderen Göttern in Asgard, wurde von dort aber verbannt und gründete ihr eigenes Reich namens Helheim. Wer an Krankheit oder Altersschwäche verstarb, den holte sie dorthin. Darstellungen zeigen die Göttin als duales Wesen: Eine Körperhälfte ist hell-, die andere dunkelhäutig; manchmal ist sie auch geteilt in jung und alt, lebendig und tot. Sie wird als beschützend und nährend sowie gleichzeitig als todbringend und wütend beschrieben. Auch Helheim ist ein düsterer und trostloser, gleichzeitig aber auch herzlicher und warmer Ort. Er befindet sich unter den Wurzeln des Weltenbaums Yggdrasil.
Von Hel über Helle zu Hölle ist es ein kurzer Weg, und tatsächlich vermuten Sprachwissenschaftler, dass der Begriff Hölle auf das mittelhochdeutsche Helle und das noch ältere germanische Haljo zurückgeht – ausgehend von der mythologischen Figur der Hel. Nicht zuletzt weist auch die uralte Sage der Frau Holle, die auf die germanische Göttin Hulda verweist und den meisten heute als Grimm’sches Märchen mit glücklichem Ende bekannt ist, Ähnlichkeiten mit der Unterwelt und der Figur der Hel auf.
Doch die Sage um die »Blanke Helle« im heutigen Tempelhof bezieht sich nicht auf die Kissen ausschüttelnde alte Dame aus dem Märchen, sondern auf die ungezähmte nordische Göttin: Einst, als das Gewässer des Pfuhls noch deutlich höher stand als heute und von Berlin noch lange keine Rede war, soll an seinem Ufer ein heidnischer Priester gelebt haben. Auf einem Opferstein bringt er der Totengöttin regelmäßig Gaben, damit sie ihn beschützt und ernährt. Als Dank schickt ihm die Göttin zweimal im Jahr einen großen Stier aus den Fluten des Pfuhls, mit dessen Hilfe der Priester die umliegenden Felder pflügen und sich selbst für die kommenden Monate mit Nahrung versorgen kann. Viele Jahre lang funktioniert diese Abmachung gut. Bis eines Tages ein christlicher Mönch in der Hütte des Heiden auftaucht.
Der Priester sieht dies als Vorzeichen dafür, dass er bald das Zeitliche segnen wird, und bietet dem Mönch an, nach seinem Tod die Opfergaben für die Göttin Hel zu übernehmen. Doch darf dieser als Christ einer heidnischen Göttin huldigen? Als der Priester stirbt, weigert sich der Mönch kurzerhand, die Rolle seines Vorgängers anzutreten. Mit der Zeit geht ihm deshalb die Nahrung aus, und er fleht Gott an, ihn von seinen Qualen zu erlösen.
Ob dieser zu viel zu tun hat oder die Aufgabe gleich an seine Kollegin abgibt, wissen wir nicht. Aber Hel übernimmt das nur allzu gerne: Sie schickt den Stier erneut auf die Erde, damit er den Mönch frisst. Dann senkt sich der Boden rund um den See ab und verschlingt mit einer großen Welle den Geistlichen, Stier, Hütte und Opferstein. Seitdem, erzählte man sich noch bis ins 20. Jahrhundert hinein, fordert Hel jedes Jahr ein Menschenopfer in ihrem Tempelhofer See.
Beschützend und rachsüchtig, liebevoll zugewandt und abweisend kalt: Hel ist die Dualität in Person. Sie vereint das scheinbar Unvereinbare. Das bringt ihr viele Feinde, aber auch Freunde ein. Ist Hel also uns Menschen gar nicht so unähnlich, frage ich mich? Tragen wir nicht alle verschiedene Versionen in uns, auch je nachdem, welche gesellschaftliche Rolle wir gerade ausfüllen? Bei einem Gespräch mit meinem Chef gebe ich weniger von mir preis, als wenn ich mit meiner Mutter telefoniere; einem Fremden, der mich auf der Straße nach dem Weg fragt, begegne ich zurückhaltender als meinem Partner.
Mal bin ich die abgehärtete Journalistin, die ihr Gegenüber ohne mit der Wimper zu zucken über heikle Themen ausfragt und dabei der einen Seite Hels vermutlich sehr nah ist. Mal möchte ich mich am liebsten unter der Bettdecke verstecken, das Telefon abschalten und die Welt draußen vor der Tür lassen. Habe ich den ganzen Tag über für meinen Job bei der Tageszeitung über die Berliner Lokalpolitik geschrieben und dabei mit Zahlen und Wörtern jongliert, ziehe ich mich abends mit einem Buch in die Welt der Phantasie zurück.
»Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust«, ruft Goethes Hauptfigur im Faust an einer Stelle melodramatisch aus. In vielen Momenten meines Lebens erkenne ich mich darin wieder, auch wenn Goethe hier eher auf den Kampf zwischen Verstand und Gefühl anspielt. Die Geschichte von Hel berührt uns wahrscheinlich auch heute noch, weil sie etwas verkörpert, das in uns allen steckt: das Gute – aber eben auch das Böse.
Tatsächlich ertranken bis um die Jahrhundertwende mehrere Menschen im Pfuhl. Das Wasser stand damals noch bis an den Rand der Senke und machte ihn zu einem gefährlich tiefen Loch. Ich versuche mir vorzustellen, wie die Gegend ausgesehen haben mag, als die Sage vor vielen Jahrhunderten entstand. Sie ist nicht genau datierbar und wird oft mit »in grauer Vorzeit« eingeleitet. Heute wäre es nicht mehr lebensgefährlich, würde ich hier ins Wasser fallen; mit ein paar Schwimmzügen wäre ich wieder am Ufer.
Der Pfuhl bildete sich vor rund 20 000 Jahren während der Weichsel-Kaltzeit, als das Gebiet des Teltow, auf dem sich Berlin befindet, noch komplett mit Eis überzogen war. Das Schmelzwasser hinterließ eine Reihe von Toteislöchern in der Umgebung, zu denen auch die Blanke Helle gehört. Der Pfuhl lag später inmitten eines dichten Waldes, in einem unzugänglichen und unbesiedelten Gebiet. Auch in den folgenden Jahrhunderten blieben die heutigen Stadtteile Schöneberg und Tempelhof, die aus Straßendörfern entstanden, eine Art Wildnis.
Mittlerweile ist längst alles zusammengewachsen und von Mietskasernen und Wohnblöcken wie der erwähnten »Blanken Hölle« besiedelt. Der Park ist lediglich ein kleiner grüner Fleck inmitten des ganzen Betons, der für manche vermutlich auch eine Form der Hölle darstellt. Ob die mächtige Göttin Hel ihr Zuhause heutzutage noch wiedererkennen würde?
Schon immer haben Menschen auf der ganzen Welt in ihren Mythen mit Naturphänomenen wie Fluten, Stürmen und Vulkanausbrüchen menschliche Themen wie Strafe und Rache verhandelt. Göttinnen und Götter machten sie zur Projektionsfläche für ihre eigenen unliebsamen Anteile: Wenn man die Angst vor Bestrafung oder seine Wut auf Hel verlagert und diese in einen düsteren See versenkt, muss man sich nicht mit sich selbst und den Folgen der eigenen Taten auseinandersetzen. In der Gegenwart werden Fehler zwar seltener bei Gottheiten gesucht, dafür soll häufig ein undefiniertes »die da oben« stellvertretend die Schuld auf sich nehmen.
Doch nicht immer entstanden Sagen in der Auseinandersetzung mit existenziellen Themen. Manchmal suchten Menschen, wenn sie nicht gerade zu den faktenbasierten Wissenschaftlern gehörten, einfach nach kreativen Erklärungen für die Entstehung einer Landschaft, einer Felsformation oder eines stinkenden Sees. Mit ein bisschen Phantasie klappt das auch heute noch bei der Blanken Helle, denke ich: Vielleicht ist das undurchsichtige Gewässer einst »gekippt« und hat einen fauligen Geruch verbreitet, so dass die Assoziation mit der übelriechenden Hölle naheliegend war?
Haben Eltern womöglich auf Hel zurückgegriffen, um ihre Kinder vor Unvorsichtigkeit zu warnen? Zwar hatte das Christentum ab einem bestimmten Punkt heidnische Bräuche offiziell verdrängt oder unter neuem Namen übernommen, doch spielten Aberglaube, Sagen und Mythen bis in das 20. Jahrhundert eine wichtige Rolle im Alltag der Menschen.
Heute ist das ganz anders. Die meisten, die an diesem friedlichen Ort inmitten der Stadt auf einer Decke im Gras liegen und die Sonne genießen, haben wahrscheinlich noch nie etwas von dieser Sage gehört. Obwohl sich die Bezeichnung »Blanke Helle« bis heute gehalten hat, ein am Rande des Platzes gelegenes Restaurant so heißt und der Name auch in der Denkmalliste des Landes Berlin vermerkt ist.





























