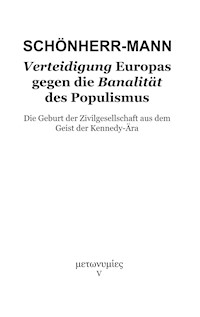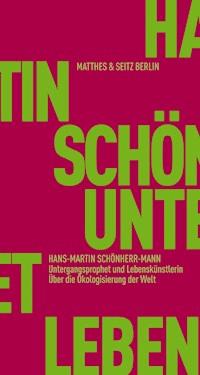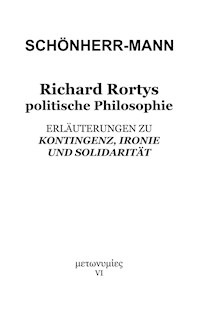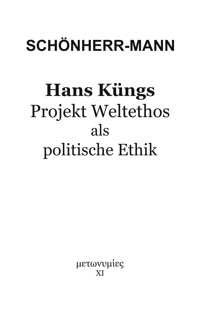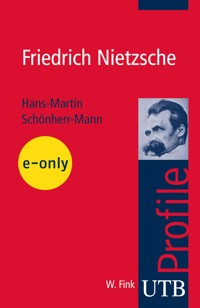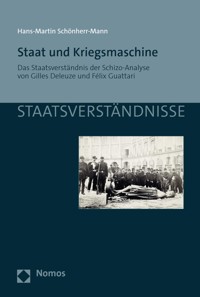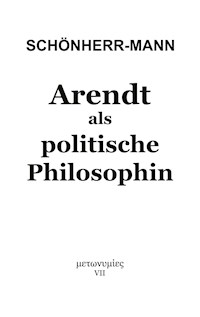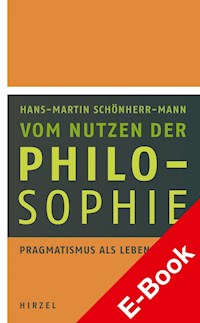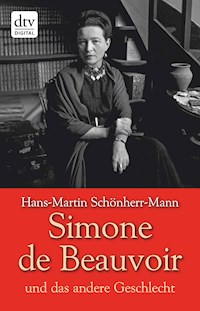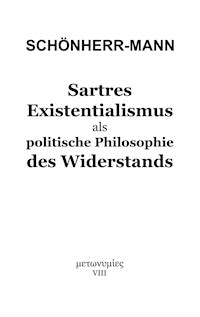
Sartres Existentialismus als politische Philosophie des Widerstands E-Book
Hans-Martin Schönherr-Mann
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch führt in den Existentialismus von Jean-Paul Sartre ein und stellt diesen ins Verhältnis zu Vorläufern, Weggefährtinnen und Nachfolgern. Die Philosophie der Freiheit unterstellt, dass jeder Mensch in der Lage ist, sein Leben selber zu gestalten und sich gegen eine autoritäre Politik zur Wehr zu setzen. Das war ursprünglich die Philosophie der Résistance, heute ist das die Philosophie der Mündigkeit, die gegen jede Art der Bevormundung Widerstand zu leisten vermag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Zum Buch: Das Buch beschränkt sich auf den Sartre der vierziger Jahre, als er die Philosophie des Existentialismus aus dem Geist der Résistance schrieb. Damit entwickelt er eine Philosophie der mündigen Bürgerin, die sich auch gegen ein terroristisches Regime zu wehren vermag. Aus der von Sartre begründeten Freiheit erwächst nicht nur die Verantwortung für das eigene Leben, das die Bürgerin nach eigenen Vorstellungen zu gestalten vermag, sondern auch die Widerstandskraft, sich nicht bevormunden lassen zu müssen. Spätestens seit den soziologisch konstatierten Individualisierungsprozessen seit dem siebziger Jahren müsste der Existentialismus, wie ihn neben Sartre auch vor allem de Beauvoir und Camus entwickelten, eine sehr aktuelle Philosophie sein. Dem ist indes kaum so. Für alle politischen und sozialen Bestrebungen hatte der Existentialismus nach dem Sieg über den Nationalsozialismus seine Schuldigkeit getan. Denn alle erwarten einen gehorsamen, von den Eliten lenkbaren Bürger. Daher gelten diese Existentialisten bis heute als die bösen Philosophen, die dem Individuum gegenüber dem Staat einen Primat einräumen. Individualismus und Hedonismus bleiben aber die einzigen Gestaltungsmöglichkeiten, wenn es letztlich keine gemeinsamen obersten Werte mehr gibt und sich jeder selber ethisch konstituieren muss.
Hans-Martin Schönherr-Mann ist Prof. für Politische Philosophie an der Univ. München, Gastprof. seit 2004 häufig an den Univ. Innsbruck, Eichstädt, Regensburg, Venice International Univ, Univ. Torino; Bücher: Gesicht und Gerechtigkeit – Emmanuel Lévinas politische Verantwortungsethik, Innsbruck University Press 2021; Nietzsche – Leben und Denken, Römerweg 2020; Dekonstruktion als Gerechtigkeit – Jacques Derridas Staatsverständnis und politische Philosophie, Nomos 2019, Michel Foucault als politischer Philosoph, IUP 2018; Untergangsprophet und Lebenskünstlerin – Über die Ökologisierung der Welt, Matthes & Seitz Berlin 2015; Albert Camus als politischer Philosoph, IUP 2015; Was ist politische Philosophie, Campus Studium 2012; Die Macht der Verantwortung, Alber 2010; Der Übermensch als Lebenskünstlerin – Nietzsche, Foucault und die Ethik, MSB 2009; Miteinander leben lernen – Die Philosophie und der Kampf der Kulturen, Piper 2008; Simone de Beauvoir und das andere Geschlecht, dtv 2007; Hannah Arendt – Wahrheit, Macht, Moral, C.H. Beck 2006; Sartre – Philosophie als Lebensform, C.H. Beck 2005
Für Irmi
Inhalt
Vorwort
I. K
APITEL
: FREIHEIT UND VERANTWORTUNG
1. Existenz ohne Essenz
2. Freiheit als Zwang
3. Die Verantwortung des Individuums
4. Die unvermeidbare Wahl
5. Verantwortung als Überforderung?
6. Das Prinzip der Selbstverantwortung
7. Verantwortung und Freiheit: Lévinas
II. K
APITEL
: ENGAGEMENT STATT PFLICHT
1. Individualismus als Egoismus?
2. Engagement oder Pflicht
3. Das ständig zu erneuernde Engagement
4. Engagement und Degagement
5. Literatur und Engagement
III. K
APITEL
: WIDERSTAND UND EMANZIPATION SARTRE UND DE BEAUVOIR
1. Der Existentialismus als Individualismus
2. Die Freiheit und ihre Feinde
3. Die Situationsabhängigkeit der Verantwortung
4. Solidarität durch die Blicke der Anderen
5. Individualismus und Universalismus
6. Das Spiel mit Gender und Sex
IV. K
APITEL
: MORAL UND GEWALT: SARTRE UND CAMUS
1. Der ethische Relativismus
2. Eine konkrete Moral von Erfahrung und Situation
3. Die Moral in der Geschichte
4. Vernünftige und unvernünftige Moral
5. Das Böse und das Gute
V. K
APITEL
: DIE MACHT DES INDIVIDUUMS SARTRE UND KIERKEGAARD
1. Sartres Unterscheidung von Ansich und Fürsich
2. Kierkegaards Unterscheidung von ästhetischer und ethischer Dimension der Existenz
3. Die zwei Grundlinien der Ethik Gemeinschaftsorientierung vs. individuelle Selbstschöpfung
4. Sartres Freiheit der Wahl im Angesicht der Kontingenzen
5. Kierkegaards Ethik der Entscheidung
6. Sartres Zwang zu Freiheit und Verantwortung
VI. K
APITEL
: FREIHEIT ALS TRANSZENDENZ SARTRE UND NIETZSCHE
1. Wirrnis oder Größenwahn
2. Neue Werte schaffen oder sich transzendieren
3. Genie oder Autor
4. Unterwerfung oder Widerständigkeit
5. Wer trägt Verantwortung?
VII. K
APITEL
: MAUVAISE FOI UND RHETORIK SARTRE UND MICHELSTAEDTER
1.
Sein und Zeit
: Ein Plagiat? Michelstaedter und Heidegger
2. Individuum und Gesellschaftsmaschine
3. Michelstaedter als Wegbereiter der Verantwortungsethik
4. Der wahre und der falsche Individualismus
5. Zwischen Mündigkeit und Widerständigkeit
VIII. K
APITEL
: DER SUBVERSIVE UNTERTAN SARTRE UND FOUCAULT
1. Politik als Bildungs- und Sprachproblem
2. Von der Mauvaise Foi zur Konflikttheorie
3. Relativismus und Gerechtigkeit
4. Ausschweifung als Widerstand
IX. K
APITEL
: BEVORMUNDUNG UND MÜNDIGKEIT SARTRE UND RANCIÈRE
1. Demokratie als Postdemokratie
2. Partizipation in der Postdemokratie
3. Der mediale Widerstand der Anteillosen als Partizipation
LITERATUR
PERSONENVERZEICHNIS
„Die tugendhaften Menschen sind
oft kleinmütige Bürger. Der wahre
Mut wurzelt in einer Ausschweifung.“ (Albert Camus)
VORWORT SARTRE UND DIE POLITISCHE PHILOSOPHIE DES WIDERSTANDS
Sartre wurde berühmt während der Zeit der Résistance. Mit seinem ersten Hauptwerk und mit dem Theaterstück Die Fliegen begründete er in einer Zeit, die vom Untertanengeist geprägt war, die Möglichkeit sich gegen jedwede Unterdrückung und Bevormundung zur Wehr zu setzen. Wie sagt doch Jupiter zu Ägist: „Wir beide lassen die Ordnung herrschen, du in Argos, ich in der Welt, und das gleiche Geheimnis lastet schwer auf unseren Herzen. ÄGIST: Ich habe kein Geheimnis. JUPITER: Doch, Das gleiche wie ich. Das schmerzliche Geheimnis der Götter und der Könige, dass nämlich die Menschen frei sind. Sie sind frei, Ägist. Du weißt es, und sie wissen es nicht. ÄGIST: Zum Donner, wenn sie es wüssten, würden sie meinen Palast an seinen vier Ecken anzünden. Seit 15 Jahren spiele ich Komödie, um ihnen ihre Macht zu verbergen.“
Nicht dass seit dem 19. Jahrhundert der Sozialismus den Aufstand nicht längst auf seine Fahnen geschrieben hätte. Aber es handelte sich um einen Aufstand der Massen, in den sich der Einzelne einzureihen hat. Er war Untertan des Aufstands, nicht der freie Bürger, der aus eigener Entscheidung sich entschließt, nicht mehr zu gehorchen, sich entweder massiv oder subversiv gegenüber den Ansprüchen der herrschenden Gewalt zu widersetzen. Und der kleinste Akt der Abweichung versteht sich als Widerstandshandlung.
Merkwürdig ist dabei, dass Sartre in die Annalen der Philosophie nicht als Denker des Widerstands eingegangen ist. Stattdessen hat man ihn als Philosophen der Freiheit taxiert und letztlich desavouiert. Wie will denn der Mensch frei sein, der doch überall in diverse Zwänge eingespannt ist. Der freie Wille wurde denn auch bis heute fleißig dementiert: Das Individuum muss sich doch als ein Teil einer Gemeinschaft verstehen, soll es anders nicht leben können.
Dass das nicht der Fall ist haben die diversen Emanzipationsbewegungen seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts vorgeführt. Aber nicht mal de Beauvoirs Hauptwerk Das andere Geschlecht wurde in diesem Sinn rezipiert. Individuelle Widerständigkeit ist politisch doch schlicht überall zu unpopulär, zu gefährlich, als dass man sie wenigstens als solche diskutieren wollte. Alle Experten wollen den Bürgerinnen vorschreiben, wie sie zu leben haben, ökologische, soziale, ökonomische oder traditionelle. Daher dürfen sie nicht mündig sein.
Individuelle Rechte sollte der Staat zugestehen. Nicht dass er sich gezwungen sehen könnte, diese zu achten, weil er sich sonst mit dem Widerstand der Bürgerinnen konfrontiert sehen könnte und diese wohl oder übel zugestehen müsste. Dabei sind Menschenrechte nur dann den Namen wert, wenn die Bürgerinnen diese erkämpfen und nicht mehr zulassen, dass sie wieder aufgehoben würden. Aber der Staat will keineswegs akzeptieren, dass er nicht schalten und walten kann, wie er will.
Von Sartre und den französischen Existentialisten kann man indes lernen, dass Rechte nur dann Rechte sind, wenn sie von den Bürgerinnen erkämpft und verteidigt werden, nicht wenn sie von Gnaden des Staates gewährt werden, die dieser jederzeit wieder rückgängig machen kann.
Daher ist Sartre der Philosoph des Widerstands, weniger der Freiheit – das selbstredend auch. Aber die Grundlage der Freiheit ist nicht der Staat, der zur Not alles beschließen kann, was er gerade für geboten hält, sondern die individuelle Macht, sich dem Staat zu widersetzen, wenn dieser die individuellen Rechte, die das Individuum erkämpft, auszuhebeln versucht. Menschenrechte, Menschenwürde und letztlich Demokratie in keinem etatistischen Sinn beruhen auf der individuellen Fähigkeit, sich diese Rechte zu erkämpfen und zu verteidigen. Diese Aufgabe übernehmen Staaten und dann können sie diese Rechte einschränken – und zwar nach Belieben.
Sartres Philosophie bietet hier einen Ansatzpunkt, wie sich die Bürgerinnen dem widersetzen können. Das versucht dieses Buch vorzuführen. Die ersten zwei Kapitel führen in das Denken von Sartre ein, in sein Freiheit- und Verantwortungsverständnis wie in seinen Begriff des Engagements. Kapitel drei und vier gehen vor allem auf de Beauvoir und Camus in ihrem Verhältnis zu Sartre ein – die Mitbegründer einer Philosophie des Widerstands wie der Emanzipation.
Im fünften, sechsten, und siebten Kapitel geht es um die historischen Wegbereiter des existentialistischen Denkens, nämlich Kierkegaard, der aus protestantischer Perspektive dem Individuum attestiert, sein Leben selber gestalten zu können. Nietzsche verachtet den gehorsamen Untertan seiner Zeit, eine Verachtung, die sich auch aus Sartres Denken ableiten lässt: der unmündige Bürger, Prototyp Eichmann in Jerusalem. Michelstaedter entwickelt ein Denken der Selbstentfaltung und Verantwortung für sich selbst, das dem Existentialismus den Weg in den Widerstand weist. Foucault ist nicht einfach ein Denker der Macht und der Disziplinierung, sondern er sieht, just weil das Individuum diese Macht realisieren muss, Chancen, dass das Individuum auf vielfältige Weise sich der Entmündigung widersetzen kann. Das letzte Kapitel, das Sartre ins Verhältnis zu Rancière setzt, zeigt zugleich weitere Perspektiven der Emanzipation wie der Demokratie auf, wenn diese staatlicherseits unter Druck gesetzt werden.
I. KAPITEL
FREIHEIT UND VERANTWORTUNG
Die großen Herausforderungen des 20. Jahrhunderts, der Totalitarismus, insbesondere der nationalsozialistische Rassismus, später die Gefährdung der Biosphäre haben eine Wende des ethischen Denkens von der Prinzipienethik hin zu einer Verantwortungsethik beschleunigt, die als erster Max Weber um 1920 thematisiert. Angesichts der großen sozialen Verwerfungen und Krisen forderte er einen charismatischen Führer, der aber nicht irgendwelche Ideologien bzw. ideale Prinzipien verwirklichen, sondern sich an den realen Folgen seines Handelns orientieren sollte, die er dann auch zu verantworten hätte. Emmanuel Lévinas ruft angesichts des Holocaust das Individuum in die Verantwortung für den anderen, hilflosen verfolgten Menschen. In ähnlicher Weise attestiert auch Hans Jonas der Menschheit, die Verantwortung für die Biosphäre wie den Bestand der Menschheit zu tragen.
In dieser Abkehr des ethischen Diskurses von einer reinen Prinzipienethik hin zu einer sicher eher utilitaristischen Verantwortungsethik spielt Jean-Paul Sartre eine wichtige Rolle, obgleich diese weder in den Kreisen der Experten noch in einer breiteren Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Sartres Philosophie in den vierziger Jahren gilt als Philosophie der Freiheit, kaum als Ethik der Verantwortung, obgleich das Thema Verantwortung sein erstes Hauptwerk Das Sein und das Nichts durchzieht und sich keinesfalls im schmalen Kapitel „Freiheit und Verantwortlichkeit“ gegen Ende des Buches erschöpft.
Vielleicht geriet seine frühe Philosophie auch daher bald in Vergessenheit, nicht nur weil er sich selbst von ihr bei seinen Annäherungen an den Marxismus seit den fünfziger Jahren jedenfalls teilweise distanzierte: Von der Freiheit hörte man gern, nicht so gern von der Verantwortlichkeit: noch dazu, wenn Sartre als erster jeden Menschen mit der Verantwortung für sein gesamtes Leben belastete. So befreite er die Verantwortung nicht nur aus der elitären Perspektive Max Webers. Vielmehr stimmte er einen Ton an, der bis heute in der Öffentlichkeit immer stärker nachhallt, wenn Verantwortlichkeit von allen verlangt wird: vom einsamen Raucher bis zum Arbeitsplätze abbauenden Konzernlenker.1
1. Existenz ohne Essenz
Doch wenn der Mensch plötzlich für sein ganzes Leben verantwortlich sein soll, ist er dann wirklich noch frei? Passt die Verantwortung überhaupt zu Sartres Freiheitskonzept? Schenkten die Zeitgenossen nicht zu recht ihre Aufmerksamkeit lieber seinen Freiheitsideen, nach denen sie nicht bloß ein vorgeprägtes Wesen auszufüllen hätten, sie dieses vielmehr selber bestimmen können?
Sartres berühmte Feststellung lautet denn auch: die Existenz geht der Essenz voraus. Diverse moderne Weltbilder wie der Marxismus unterstellen dem Menschen ein arbeitendes und ein soziales Wesen. Der Nationalismus begreift den Menschen als seinem Volk dienendes Wesen, während der Liberalismus das Individuum zum Selbstzweck erhebt. Alle solche Bestimmungen sind für Sartre nachträgliche Interpretationen. Vielmehr existiert der Mensch in der Welt, ohne dass er wüsste, was für ein Wesen er besitzt, ob er soziale oder individuelle, religiöse oder natürliche Anlagen hat. Der Mensch sieht sich in die Welt geworfen und muss sich seine Orientierungen selber suchen und zusammenstellen. Ob dieser Geworfenheit bleibt dem Menschen nichts anderes, als seine Existenz selbst zu gestalten, d.h. sein Wesen erst aufzubauen.
Klingt eine solche These nicht reichlich absurd angesichts dessen, dass die Menschen in ihre Umwelt tief verstrickt und eingebunden sind? Doch die zentrale Erfahrung, die Sartre in Krieg, Kriegsgefangenschaft und der unmittelbaren Zeit danach erlebte, lässt das Gegenteil ahnen: Ob die Individuen oder die Gemeinschaft, ganz Frankreich liegt in Agonie angesichts des unglaublich schnellen und verheerenden Zusammenbruchs. Der Faschismus trampelt über alle Werte des alten Europas hinweg, besonders jene der Grande Nation von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Selbst der Papst arrangiert sich mit den Nazis. Weder die Geschichte noch die Institutionen verkörpern glaubhaft weiterhin gemeinsame oberste ethische Werte. Den Sinn der Geschichte wie deren Ethos schreiben offenbar die neuen Sieger nach den Gesetzen der Grausamkeit. Nicht nur Sartre sah sich seines Wesens beraubt. Eine ganze Nation schwankt zwischen Kollaboration, die im Regime von Vichy ihr Symbol besitzt, und Widerständigkeit, die einerseits mit General Charles de Gaulle in London und seiner Bewegung France libre ihre äußere Formierung erlebt und die andererseits in der Résistance ein Angebot an den einzelnen darstellt, bei der doch jeder zu einer einsamen Entscheidung gezwungen ist. Denn dem Widerstand muss man sich freiwillig anschließen. Kein äußerer Zwang erleichtert das Leben, dem sich die Untertanen letztlich gerne ausgeliefert sahen. Selbst muss, kann man nichts tun. Die Welt wird von den großen Mächten regiert. Die Individuen spielen für sich alleine keine Rolle.
1942 schreibt Sartre sein Hauptwerk Das Sein und das Nichts, den Roman Der Aufschub und sein erstes richtiges Theaterstück Die Fliegen, das ihm 1943 seinen ersten öffentlichen Theatererfolg bescheren wird. Diese Werke prägt also die Erfahrung der Hoffnungslosigkeit, der totalen Unterdrückung durch Nazi-Deutschland. In der Zeit, in der sie entstanden, 1942, lag das Ende der Nazi-Diktatur noch in unabsehbar weiter Ferne.
Mangelt aber den Menschen daher nicht primär die Freiheit und weniger das Wesen? Doch wenn ihnen keine höhere Instanz mehr einen Lebenssinn zu verleihen vermag, sehen sich die Menschen zwangsläufig auf die Situation reduziert, in der sie nun mal leben. Gerade im Angesicht der Gefahr – gleichgültig ob diese von der Gestapo oder feindlichem Artilleriefeuer ausgeht – spürt man die nackte Existenz, die auf dem Spiel steht, während alle Hoffnungen und Träume gleichgültig verschwimmen. Sartre folgt hier Edmund Husserls Phänomenologie, mit der er sich seit Anfang der dreißiger Jahre kurz nach dem Ende seines Studiums an der französischen Elitehochschule ENS beschäftigt: Der Mensch erfährt die Dinge, schlicht wie sie ihm erscheinen. Wesenheiten, die etwa hinter diesen Erscheinungen lägen, lassen sich nicht wahrnehmen und spielen für Husserl keine Rolle. Vielmehr fallen Wesen und Erscheinung zusammen, mit der Folge für Sartre, dass der Mensch genau das sieht, was ihm erscheint, was existiert. Hinter diesem Existieren braucht man kein weiteres Wesen, keinen Sinn zu suchen, den es nicht gibt, so dass man ihn auch nicht wahrnehmen kann.
Weder von der bloßen Existenz noch von seinem Bewusstsein aus eröffnen sich dem Menschen Sinne des Lebens oder Wesenheiten seiner Existenz. Ich bin der, der ich bin. Ich existiere. Ich lebe in dieser Welt, ohne dass sich mir ein höherer Sinn davon automatisch erschließen würde: Die Existenz geht der Essenz voraus. Sartre schreibt in Das Sein und das Nichts: „Das Bewusstsein ist ein Sein, dessen Existenz die Essenz setzt, und umgekehrt ist es Bewusstsein von einem Sein, dessen Essenz die Existenz impliziert, das heißt, dessen Erscheinung verlangt zu sein.“2
Aber heißt Freiheit nicht, sein Wesen entfalten und ausleben zu dürfen? So stellen es sich die diversen Spielarten des Humanismus vor, die Sartre aber bereits in seinem Frühwerk in den dreißiger Jahren scharf angreift. Dagegen gestaltet für Sartre jeder Mensch seine Zukunft mit Hilfe von Entwürfen und Plänen, die er dann zu realisieren trachtet. Darin siedelt für Sartre die Freiheit. Denn der moderne Mensch sieht sich ständig gezwungen, über seine Existenz zu reflektieren, da er mit sich selbst gar nicht im reinen sein kann, weil er Bewusstsein seiner Existenz selbst ist, aber seine Existenz mit seinem Bewusstsein gar nicht in Einklang stehen kann: Es gibt kein richtiges Bewusstsein seiner selbst. Weil durch den Menschen immer ein Riss geht, muss er ständig über seine Situation, über seine Möglichkeiten nachdenken, ohne dass sich das jemals erschöpfte. Sartre erkennt, dass der moderne Mensch in einer reflexionsorientierten Lebensform lebt, was sich höchstens verdrängen lässt, dann aber Schwierigkeiten macht. Aber wenn ich meine Existenz reflektiere, dann kann ich sie auch ablehnen oder verbessern. Genau dadurch verleihe ich meiner Existenz Wesenhaftigkeit bzw. Sinn. Wie sagt doch Sartre: Die Existenz geht der Essenz voraus. Derart stellt für Sartre die Freiheit eine Veränderungsmöglichkeit der Existenz dar, die er Transzendenz nennt – ein im Existentialismus beliebter Begriff, den Sartre aber jeglicher religiöser Perspektiven enthebt, die er bei Gabriel Marcel und Karl Jaspers besitzt.
1 Vgl. hierzu: Hans-Martin Schönherr-Mann, Sartre – Philosophie als Lebensform, München 2005 (C.H. Beck)
2 Jean-Paul Sartre, Das Sein und das Nichts – Versuch einer phänomenologischen Ontologie (1943), Gesammelte Werke Philosophische Schriften I, Bd. 3, Reinbek 1993, 36
2. Freiheit als Zwang
Wo aber bleibt die Freiheit als gestalterische Kraft im Zustand extremer Unterdrückung? Doch Sartre behauptet arrogant: Der Mensch bleibe sogar in größter Knechtschaft frei, also unter der Herrschaft des Nationalsozialismus. Das Bewusstsein, erlaubt dem Menschen, sich zu verändern, sich anders zu gestalten, als es ihm seine Umwelt vorschreibt, also sich auch gegen den größten äußeren Druck aufzulehnen. Der Mensch kann sich gegenüber Unterdrückern wehren, eine Freiheit, die sich wirklich erst dann in ihrer vollen Tragweite zeigt, wenn eine äußere Unterdrückung den einzelnen Menschen auf sich selbst zurückwirft.
Aber Sartre gelingt es mit seiner phänomenologischen Orientierung diese Freiheit des Menschen nicht nur metaphysisch abstrakt, sondern im Detail beschreibend vorzuführen. Mag sich das Handeln des einzelnen wissenschaftlich vollständig aus dessen Entwicklung und seiner Situation ergeben, in der er lebt, und keinerlei Platz für die Freiheit lassen. Doch der junge Mann, der Sartre um Rat fragte, ob er sich dem Widerstand anschließen soll, obgleich ihn seine kranke alleinstehende Mutter dringend braucht, steht vor einer noch offenen Entscheidung, die auch nicht vorausberechnet werden kann: ein Symbol für die Freiheit. Abgesehen davon verfügt keine Wissenschaft über eine vollständige Information, weil eine solche logisch unmöglich ist, auch deswegen, weil Sätze und Sachverhalte nicht übereinstimmen; denn sie sind ja nicht dasselbe.
Es handelt sich also nicht um die Willensfreiheit Kants, wo der rein vernunftbestimmte Wille in die Welt eingreift – wenn man das als Willensfreiheit verstehen will, sieht Arendt das anders –, ohne dass man dafür eine Ursache angeben könnte. Sartres Freiheitsverständnis ist bescheidener und kennt keine Ebene des rein Vernünftigen. Vielmehr stellt Freiheit einen autonomen Reflexionsprozess des Individuums dar, der zu Handlungen führen soll. Insofern erkämpft sich der Mensch die Freiheit auch nicht, sowenig wie der Staat sie ihm erst verleiht. Freiheit stellt kein Recht dar, das dem Menschen von Natur aus als Wesen eignen würde, wie es liberale Naturrechtstheorien behaupten.
Wenn man unter Humanismus Menschenbilder versteht, die das Wesen des Menschen mit bestimmten Inhalten versehen, dann ist Sartre kein Humanist. Wenn man aber Sartres Bewusstseinsstruktur, in der die Freiheit gründen soll, mit den Wesensbegriffen des Humanismus parallelisiert, dann lässt sich der Existentialismus Sartres auch als Humanismus verstehen. Am 29. Oktober 1945 hielt Sartre einen spektakulären Vortrag unter dem Titel: Der Existentialismus ist ein Humanismus. Er stellt gegen Schluss seines Vortrags fest: „Es gibt aber einen anderen Sinn von Humanismus, der im Grund folgendes meint: der Mensch ist ständig außerhalb seiner selbst; indem er sich entwirft und verliert außerhalb seiner selbst, bringt er den Menschen zur Existenz, und andererseits kann er existieren, indem er transzendente Ziele verfolgt.“3 Bereits Das Sein und das Nichts wandelte jenen extremen atomistischen und antihumanistischen Individualismus seiner frühen Jahre in die Suche nach der individuellen Verantwortung angesichts einer gemeinsamen Geschichte, einer gemeinsamen nazi-deutschen Bedrohung. Taktisch klug schließt er im Herbst 1945 daran an und versucht dem Vorwurf des Pessimismus, der Verzweiflung wie einer negativen Weltsicht dadurch zu entgehen, dass er den Existentialismus nicht nur als Humanismus tituliert, sondern auch als konstruktiven Optimismus individueller Freiheit und Verantwortung propagiert.
Welche Freiheit bleibt aber dem Menschen, wenn ihm ein vorbestimmtes Wesen fehlt? Sieht sich der Mensch dann nicht noch hilfloser dem Trubel der Ereignisse ausgeliefert, in dem er bestenfalls mitschwimmen kann? Freiheit hängt für Sartre allerdings nicht vom individuellen Willen, vom Selbstverständnis oder den politischen und sozialen Verhältnissen ab. Freiheit gehört vielmehr zur individuellen Existenz. In diesem Sinne fällt der berühmte Satz: „Frei sein heißt zum Freisein verurteilt sein.“4 Der Mensch kann sich daher auch nicht von der Freiheit befreien, nicht nicht frei sein. So erweist sich die Freiheit als eine Obsession des Menschen, die ihn nicht verlässt und der er nicht entgeht, wie untertänig er sich auch benimmt.
Die Tatsache, der Freiheit nicht ausweichen zu können, letztlich den Zwang zur Freiheit, der dieser harte Grenzen zieht, sie womöglich aufzuheben droht, das nennt Sartre die Faktizität der Freiheit. Die Freiheit hat zu sein, aber nur indem der Mensch ständig seine Existenz überschreitet, sie also formt. Ununterbrochen muss der Mensch sich selbst schaffen. Ich zitiere den folgenden Satz aus der ersten Übersetzung von Das Sein und das Nichts, den Justus Streller schöner formuliert: „Die Freiheit ist (. . .) das Nichts, das im Herzen des Menschen (. . .) die menschliche Realität zwingt, sich zu machen, anstatt zu sein.“5 Diese Struktur der Freiheit ist aber für Sartre nicht das Wesen des Menschen, sondern die Bedingung der Möglichkeit, sein Wesen selbst erst zu erfinden.
Was bleibt von der Freiheit, die sich zwar durch das ganze Leben zieht, aber keine wesentlichen politischen oder metaphysischen Gehalte mehr birgt? Freiheit hat für Sartre nichts mit Sklaverei oder Gefangenschaft zu tun, politischer Unterdrückung oder dem Akt der Revolution. Der Sklave besitzt immer die Freiheit, sich gegen die Sklaverei aufzulehnen. Zur Unfreiheit gerät die Sklaverei nur im Licht des Zweckes, sich zu befreien. Die Wahl, Sklave zu bleiben, drückt umgekehrt auch die Wirklichkeit der Freiheit aus – Thesen, die Sartre natürlich einigen Spott einbrachten, mit denen er sich auch immer wieder auseinandersetzte. Manche derartigen Thesen hat er ja auch später widerrufen. Natürlich war man in den vierziger Jahren, aber auch in den Jahrzehnten danach viel zu sehr auf die allseits bedrohte politische Freiheit konzentriert. Sartre antwortet auf diese Herausforderung mit einem strukturell individualistischen Verständnis von Freiheit. In Die Fliegen, das die antike Orest-Sage aufgreift, finden sich folgende Worte: „JUPITER: (. . .) Das schmerzliche Geheimnis der Götter und der Könige, dass nämlich die Menschen frei sind. Sie sind frei, Ägist. Du weißt es, und sie wissen es nicht.“6
3. Die Verantwortung des Individuums
Führt eine solche Freiheit nicht in die Anarchie? Wie soll sie sich als verantwortungsvoll erweisen? Doch dieses „Loch im Herzen der Menschen“, dieser Zwang, seine Lebenssituation gestalten zu müssen, überfällt das Individuum sowohl von außen wie innerlich, und verlangt, dass es sich macht, anstatt nur zu sein. Dabei hält der Zwang auch die entsprechende Sanktion parat, nämlich die Verantwortung, die jeder für sein Handeln trägt. Jeder muss sich realisieren und für das, was bei den diversen Versuchen herauskommt, wird man zur Rechenschaft gezogen. Wann immer eine Möglichkeit besteht, anderes zu unternehmen, wächst jedem nicht nur die Verantwortung für seine Pläne und Entwürfe zu, sondern vor allem für die konkreten Folgen der Handlungen, die diesen Entwürfen entspringen. Es reicht längst nicht mehr, das Gute zu wollen. Vielmehr gilt es, mit Leidenschaft und Klugheit das Gute umzusetzen. Was sich als ethisches Kriterium erhält, das konzentriert sich primär auf die Folgen des Handelns, hat diese zum Maßstab erkoren, somit den Erfolg des Handelns. Doch dadurch erschwert sich ethisches Handeln erheblich.
Etwa seit 1900 entfaltet der Begriff der Verantwortung in der Ethik eine erstaunliche Dynamik, die als erster Max Weber diagnostiziert und die um die Mitte des Jahrhunderts nicht durch Zufall Sartre vorantreibt. Denn die ethische Situation hat sich grundlegend gewandelt: im Abschied von normativen Regelsammlungen hin zur Achtung auf die realen Wirkungen des Handelns, von der Unterwerfung unter ein allgemeines Sittengesetz zur individuellen Verantwortung für das eigene Tun mit all seinen Fern- und Nebenwirkungen. Diese Verschiebung selbst hat Sartre wohl nicht erkannt. Aber er sah sich mit einer Situation konfrontiert, in der die individuelle Verantwortung plötzlich ausuferte, und zwar angesichts des totalen Wertezerfalls unter der Vorherrschaft des Nationalsozialismus. So bringt er denn genau diese ethische Situation auf den Begriff.
Aber zersetzt die Verantwortung nicht die Ethik als solche? So insistiert der katholische Philosoph Robert Spaemann auf einem Primat der Prinzipienethik gegenüber der Verantwortung. Der Schutz des menschlichen Lebens beispielsweise genießt unbedingte Priorität, so dass man damit nicht andere vorteilhafte Handlungsfolgen verrechnen darf. Spaemann schreibt 1989, „dass zwar die Sittlichkeit einer Handlungsweise immer abhängig ist von der Situation, bestimmte Handlungsweisen dagegen immer unsittlich sind und wir daher die Folgen von deren Unterlassung nicht zu verantworten haben.“7 An Abtreibungen beispielsweise, so die Auffassung der römischen Kurie, darf man sich in keiner Weise beteiligen. Sollte diese Haltung die Zahl der Abtreibungen erhöhen, so wäre man dafür schlicht nicht verantwortlich. Vom Standpunkt der Absolutheit der Werte führt die Orientierung an den Folgen in einen Werterelativismus, somit zur Auflösung eben höchster, bzw. gar absoluter Werte. Vom Standpunkt des Werteabsolutismus wie auch tendenziell des Werteuniversalismus führt die ethische Orientierung an den Handlungsfolgen immer in eine relativistische Ethik. Und ethischer Relativist will irgendwie niemand sein, was man mit Sartres Begriff der Unaufrichtigkeit beschreiben kann. So wird der ethische Diskurs von unglaublich vielen Illusionen angetrieben.
Doch bereits Max Weber erkennt, dass man in der säkularen Welt stärker auf die Folgen der Handlungen als auf deren Prinzipien achten muss. Seine Verantwortungsethik 1919 entwickelt er aber ausschließlich für den leitenden Ökonom oder führenden Politiker, nicht für den Beamten, Soldaten oder Arbeiter. Dabei beschränkt Weber die Verantwortung auf die überschaubaren Folgen des Handelns. Ferne Auswirkungen spielen keine Rolle, dürfen daher dem Politiker auch nicht angerechnet werden.
Für Sartre, als er Das Sein und das Nichts schreibt, drängt sich die Verantwortung jedem auf, weil in Frankreich unter der nazi-deutschen Besatzungsmacht keine institutionelle sittliche Autorität mehr existierte, die allgemein anerkannte Werte repräsentiert hätte, was Spaemann natürlich anders sehen würde, kann sich die Heilige Kirche durch ein Konkordat mit dem langjährigen Nazi-Kanzler gar nicht ethisch desavouieren so wenig wie durch die in den letzten Jahrzehnten bekannt gewordenen Missbrauchsfälle. Dagegen gewinnt die Verantwortung als solche einen allgemeinen Charakter, der jeden Menschen angeht: Indem der Mensch zur Freiheit verurteilt ist, entgeht er auch der Verantwortung nicht. Der Mensch findet sich in diese ungeordnete, höchst unheilige Welt geworfen, die ihm keine Vorschriften machen kann. Das zwingt ihn zur individuellen Entscheidung, zum eigenständigen Handeln, das er dann auch zu verantworten hat. Insofern demokratisiert Sartre die Verantwortung – allerdings in einer Zeit, die Demokratie noch weniger als Mündigkeit des einzelnen, denn als eine andere Technik der Herrschaft verstand, so dass man Sartres Appell an die Selbstverantwortlichkeit geflissentlich überhörte.
3 Sartre, Der Existentialismus ist ein Humanismus (1945), Gesammelte Werke Philosophische Schriften I, Bd. 4, Reinbek 1994, 141
4 Sartre, Das Sein und das Nichts (1943), 1993, 253
5 Sartre, Das Sein und das Nichts (1943), übers. v. Justus Streller, Reinbek 1962, 561
6 Sartre, Die Fliegen (1943), Gesammelte Dramen, Hamburg 1969, 47
7 Robert Spaemann, Glück und Wohlwollen, Stuttgart 1989, 237
4. Die unvermeidbare Wahl
Da der Mensch frei ist, muss er sich zwischen den sich ihm bietenden Optionen entscheiden, eine Wahl, die ihm von keiner Autorität vorgegeben wird, die er somit selber zu verantworten hat. Wahl stellt einen wesentlichen Begriff in Sartres Existenzanalyse dar. Nicht nur fehlen Autoritäten, die die Wahl leiten. Sie lässt sich auch nicht aus den vorliegenden Informationen ableiten. Letztlich muss man doch selber entscheiden, was man wirklich tun will. Insofern erscheint die Wahl in letzter Konsequenz willkürlich. Auch wenn es zunächst überraschen mag, genau dadurch, nämlich weil der Mensch selber und für sich die Entscheidung treffen muss, sich dabei letztlich auf nichts berufen kann, auf keine Autorität und auf keine Information, die bestenfalls als Ratgeber fungieren, ist er für sie verantwortlich. Es gibt nun mal kein allgemeines Gutes, an dem man sich orientieren könnte, wie es sich Leo Strauss vorstellt.
Da die Entscheidung selbstverständlich vor der Tat fallen muss, die Entscheidung aber an der Tat bzw. deren Folgen gemessen wird, gewährleistet nichts die Güte der Entscheidung von vornherein, keine Orientierung an obersten Normen oder Werten, wie es Spaemann unterstellt. Insofern gibt es keine ethischen Sicherheiten mehr, mit einer Entscheidung auf der Seite des Guten zu stehen. Was Gut oder was Böse ist, entscheidet sich selbst erst nach der Tat – eine ziemlich ungewisse Zukunft, in die Sartres literarische Helden schreiten, in die Sartre selbst schreitet – man denke an seine Verstrickungen in den Stalinismus, an seine politischen Engagements auch für diverse gewalttätige revolutionäre Organisationen, die er zu verantworten hat, und die ihm seine Feinde bis heute vorhalten.
Solche Ungewissheit drängt sich umso mehr auf, wenn Sartre die Verantwortung auch noch weit über die individuelle Situation hinaus auszudehnen scheint. Indem der Mensch dazu verurteilt ist, frei zu sein, lastet gar das gesamte Gewicht der Welt auf ihm. Der Mensch ist nicht nur für sich selbst, sondern für das Geschehen um ihn herum verantwortlich. Klingt dergleichen nicht auch als eine unmäßige Überdehnung der Verantwortung?
Sartre geht es freilich weniger um die fernen Zusammenhänge, die vorausschauend zu beachten und zu verantworten sind, als vielmehr um Widrigkeiten, die den Menschen animieren, die Schuld für sein Scheitern, die Verantwortung für sein Handeln nicht bei sich selbst zu suchen, sondern sich zu exkulpieren und folglich die Verantwortung abzuschieben. Doch der Mensch befindet sich immer in Situation – ebenfalls ein wichtiger Terminus von Sartres Existenzanalyse –, die er mit allen Widrigkeiten annehmen muss, selbst wenn sie noch so unerträglich erscheinen, selbst wenn sie ihn noch so sehr bloßstellen. Trotzdem muss er diese Situation verantworten, denn er bestimmt sie durch seine Entwürfe, Ziele und Zwecke: Nur wenn ich über den Berg will, wird er zum Hindernis. Wie immer der Mensch lebt, wie immer er sich fühlt, er kann sich darüber nicht sinnvoll beklagen; denn er hat das ganz alleine durch seinen Entwurf gewählt. Keine fremden dunklen Mächte bestimmten sein Geschick. Sartre hat derart das Bewusstsein des 20. Jahrhunderts auf den Begriff gebracht: der Mensch ist für alles um sich herum verantwortlich.
Wenn der Mensch seine Verantwortung übernimmt, akzeptiert er damit keinen Anspruch, den vielleicht andere Menschen an ihn herantragen. Nein, die Übernahme von Verantwortung ist ein logischer Zwang, der sich aus der Struktur der Freiheit ergibt, dem man eben nicht entgehen kann, in den man sich zu schicken hat: Der Untertan muss für die Untaten seines Herren grade stehen; denn er hat an ihnen teilgenommen und erst recht, wenn das noch aktiv als Soldat geschah mit der Hoffnung auf Eroberung, Beute oder gesteigertes Selbstbewusstsein. Alles was dem Menschen passiert, geschieht ihm durch sich selbst, durch seine Freiheit, seine Wahl, seine Entwürfe. Er dürfte sich im besten Fall über seine Wahl bekümmern, nicht über die Reaktion seiner Umwelt. Aber darüber in ein Klagelied zu verfallen, dass ihm die Welt womöglich feindlich gesonnen sei, wäre unsinnig.
So erklärt Sartre den Menschen schlicht für alles verantwortlich, außer für seine Verantwortlichkeit als solche. Die Motive seiner Handlungen siedeln im Menschen, nicht aber der Grund seiner selbst. Doch der Mensch bleibt noch für die Bemühung verantwortlich, der Verantwortung fliehen zu wollen. „Wir können uns als Fliehenden, Ungreifbaren, Zögernden usw. wählen; wir können sogar wählen, uns nicht zu wählen: in diesen verschiedenen Fällen werden Zwecke jenseits einer faktischen Situation gesetzt, und die Verantwortung für diese Zwecke fällt uns zu: was auch unser Sein sein mag, es ist Wahl; und es hängt von uns ab, uns als ‚groß‘ oder ‚edel‘ oder ‚niedrig‘ und ‚gedemütigt‘ zu wählen.“8 Oder entgeht jemand den Schuldzuweisungen seiner Umwelt?
5. Verantwortung als Überforderung?
Zeigt sich nicht genau an dieser Stelle, dass Sartres Verantwortungsbegriff viele Menschen überfordert? Hebt diese Überforderung nicht seinen Freiheitsbegriff auf, der die Menschen – das würden Christen wie Marxisten dagegen einwenden – aus ihren sozialen Bindungen reißt und atomisiert? So nimmt Sartres Konzept von Verantwortlichkeit in der Tat elitäre Züge an. Doch einerseits kämpft Sartre sein Leben lang um eine Rückkopplung des Individuums an die Gesellschaft – ein Bemühen, in dem sich geradezu religiös messianische Ansprüche abzeichnen. Andererseits beschreibt Sartre eine ethische Lebensform, deren implizite normative Forderungen nach Verantwortlichkeit sich an alle Menschen und keinesfalls wie bei Nietzsche nur an dessen Verkünder der ewigen Wiederkunft richten. Alle Menschen befinden sich in derselben Situation des Zwangs zur Wahl, des Zwangs zur Freiheit und vor allem der unabwendbaren, unübertragbaren Verantwortlichkeit für die eigene Situation in die der Mensch geworfen wurde.
Insofern ähnelt hier Sartres Ethik auch der des Aristoteles, für den sich ein echtes ethisches Problem nur unter Gleichen, unter den Athener Bürgern einstellt. Deren hierarchisches Verhältnis zu Frauen, Kindern und Sklaven konstituiert eigentlich gar keine richtige ethische Beziehung, da es sich ja um eine Beziehung zu Abhängigen handelt. Auch Sartre verfolgt eine solche Ethik der Gleichen, nach der die Menschen in ihrer jeweiligen Situation selber das wählen, was sie für richtig halten. Sartre gelang es nicht, eine imperativische Ethik wie diejenige Kants zu entwickeln. Aber er treibt den Gedanken der Verantwortung demokratisch über Webers elitäre Beschränkung hinaus und antizipiert damit einen zentralen Terminus, der heute in aller Munde ist.
In diesem Sinn inspiriert von dem Krieg, in den er selbst geworfen wurde, der ihn mit sich riss und für den er eben doch die Verantwortung übernehmen muss, schreibt Sartre über diesen Krieg, über Menschen in diesem Krieg, über deren Freiheit und Verantwortlichkeit. Denn ein solches soziales und politisches Ereignis bricht nicht bloß von außen über mich herein. Sartre fragt nicht nach meinen früheren Verstrickungen, die mich mit Schuld beladen. Nein, die Schuld bzw. die Verantwortung generiert sich perspektivisch durch mein Verhältnis, das ich hier und jetzt und zukünftig zu diesem Krieg einnehme. Sobald ich mich in einen Krieg einziehen lasse, mache ich daher diesen Krieg zu meinem Krieg. Denn ich habe immer die Möglichkeit zur Fahnenflucht oder zum Selbstmord.
Sartre argumentiert bewusst mit den Extremsituationen, die ihm ob seiner Kriegs- und Widerstandserfahrungen nicht nur nahe lagen, die ihm während der Niederschrift von Das Sein und das Nichts auch täglich begegneten. Diese Extremsituationen gewährleisten die ultimative Wahlmöglichkeit und damit eine seltsame Freiheit letzter Instanz: Eine Situation muss unter dem Licht des Ausnahmezustands bzw. des individuellen Todes beurteilt werden, in den ich mich theoretisch immer flüchten kann. Hier scheint seine Argumentation derjenigen Carl Schmitts zu ähneln, der indes das Politische in seiner Macht gegenüber dem Einzelnen durch den Ausnahmezustand definiert: Die berühmte Definition lautet: „Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet“9